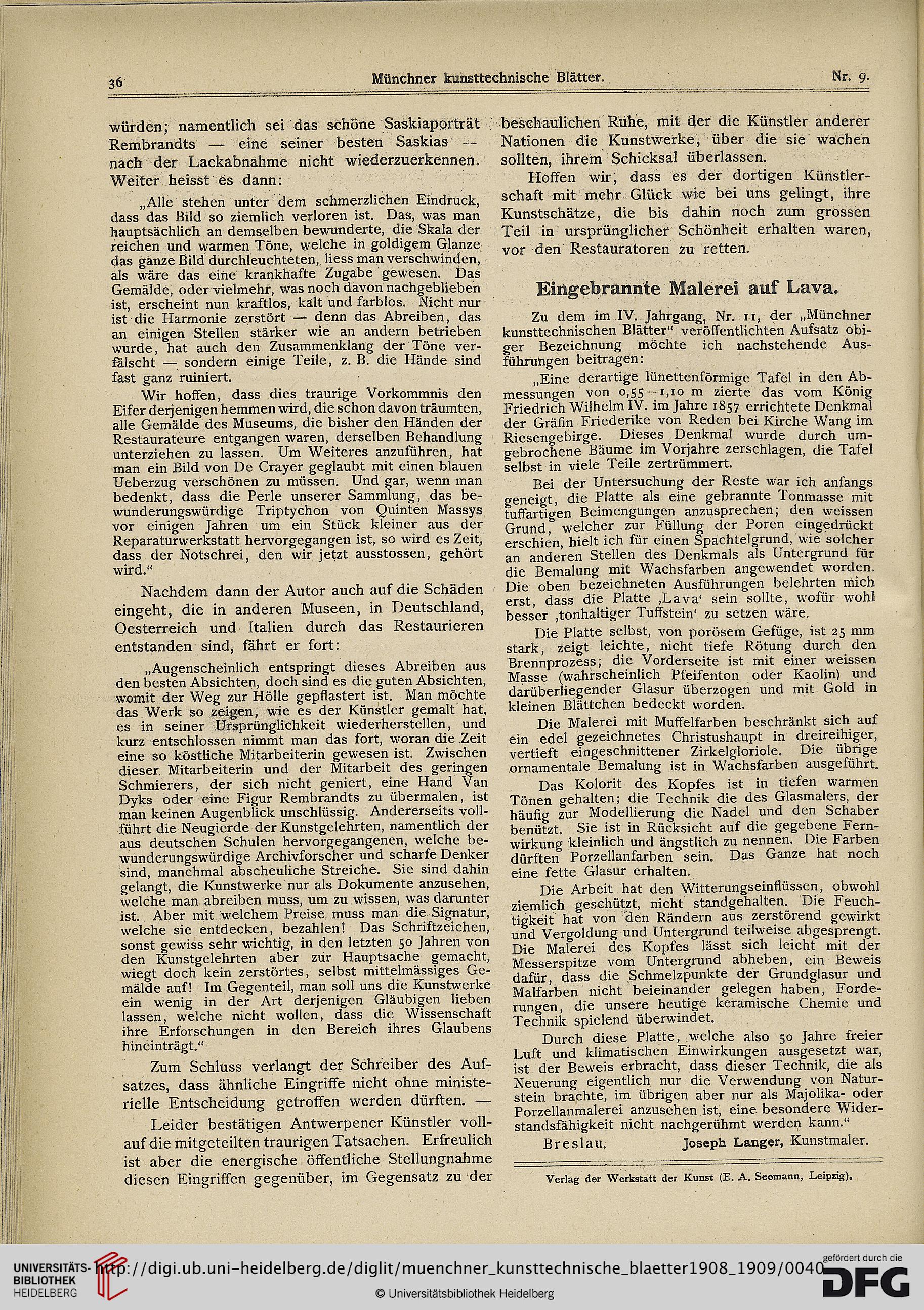36
Münchner kunsttechnische Biätter.
Nr. 9.
würden; namentlich sei das schöne Saskiaporträt
Rembrandts — eine seiner besten Saskias —
nach der Lackabnahme nicht wiederzuerkennen.
Weiter heisst es dann:
„Alte stehen unter dem schmerzlichen Eindruck,
dass das Bild so ziemlich verioren ist. Das, was man
hauptsächlich an demselben bewunderte, die Skala der
reichen und warmen Töne, welche in goldigem Glanze
das ganze Bild durchleuchteten, liess man verschwinden,
als wäre das eine krankhafte Zugabe gewesen. Das
Gemälde, oder vielmehr, was noch davon nachgeblieben
ist, erscheint nun kraftlos, kalt und farblos. Nicht nur
ist die Harmonie zerstört — denn das Abreiben, das
an einigen Steilen stärker wie an andern betrieben
wurde, hat auch den Zusammenklang der Töne ver-
fälscht — sondern einige Teile, z. B. die Hände sind
fast ganz ruiniert.
Wir hoffen, dass dies traurige Vorkommnis den
Eifer derjenigen hemmen wird, die schon davon träumten,
alle Gemälde des Museums, die bisher den Händen der
Restaurateure entgangen waren, derselben Behandlung
unterziehen zu lassen. Um Weiteres anzuführen, hat
man ein Bild von De Crayer geglaubt mit einen blauen
Ueberzug verschönen zu müssen. Und gar, wenn man
bedenkt, dass die Perle unserer Sammlung, das be-
wunderungswürdige Triptychon von Quinten Massys
vor einigen Jahren um ein Stück kleiner aus der
Reparaturwerkstatt hervorgegangen ist, so wird es Zeit,
dass der Notschrei, den wir jetzt ausstossen, gehört
wird."
Nachdem dann der Autor auch auf die Schäden
eingeht, die in anderen Museen, in Deutschland,
Oesterreich und Italien durch das Restaurieren
entstanden sind, fahrt er fort:
„Augenscheinlich entspringt dieses Abreiben aus
den besten Absichten, doch sind es die guten Absichten,
womit der Weg zur Hölle gepflastert ist. Man möchte
das Werk so zeigen, wie es der Künstler gemalt hat.
es in seiner Ursprünglichkeit wiederherstellen, und
kurz entschlossen nimmt man das fort, woran die Zeit
eine so köstliche Mitarbeiterin gewesen ist. Zwischen
dieser Mitarbeiterin und der Mitarbeit des geringen
Schmierers, der sich nicht geniert, eine Hand Van
Dyks oder eine Figur Rembrandts zu übermalen, ist
man keinen Augenblick unschlüssig. Andererseits voll-
führt die Neugierde der Kunstgelehrten, namentlich der
aus deutschen Schulen hervorgegangenen, welche be-
wunderungswürdige Archivforscher und scharfe Denker
sind, manchmal abscheuliche Streiche. Sie sind dahin
gelangt, die Kunstwerke nur als Dokumente anzusehen,
welche man abreiben muss, um zu wissen, was darunter
ist. Aber mit welchem Preise muss man die Signatur,
welche sie entdecken, bezahlen! Das Schriftzeichen,
sonst gewiss sehr wichtig, in den letzten 50 Jahren von
den Kunstgelehrten aber zur Hauptsache gemacht,
wiegt doch kein zerstörtes, selbst mittelmässiges Ge-
mälde auf! Im Gegenteil, man soll uns die Kunstwerke
ein wenig in der Art derjenigen Gläubigen lieben
lassen, welche nicht wollen, dass die Wissenschaft
ihre Erforschungen in den Bereich ihres Glaubens
hineinträgt."
Zum Schluss verlangt der Schreiber des Auf-
satzes, dass ähnliche Eingriffe nicht ohne ministe-
rielle Entscheidung getroffen werden dürften. —
Leider bestätigen Antwerpener Künstler voll-
auf die mitgeteilten traurigen Tatsachen. Erfreulich
ist aber die energische öffentliche Stellungnahme
diesen Eingriffen gegenüber, im Gegensatz zu der
beschaulichen Ruhe, mit der die Künstler anderer
Nationen die Kunstwerke, über die sie wachen
sollten, ihrem Schicksal überlassen.
Hoffen wir, dass es der dortigen Künstler-
schaft mit mehr Glück wie bei uns gelingt, ihre
Kunstschätze, die bis dahin noch zum grossen
Teil in ursprünglicher Schönheit erhalten waren,
vor den Restauratoren zu retten.
Eingebrannte Malerei auf Lava.
Zu dem im IV. Jahrgang, Nr. n, der „Münchner
kunsttechnischen Blätter" veröffentlichten Aufsatz obi-
ger Bezeichnung möchte ich nachstehende Aus-
führungen beitragen:
„Eine derartige lünettenförmige Tafel in den Ab-
messungen von 0,55—:,!o m zierte das vom König
Friedrich Wilhelm iV. im Jahre 1857 errichtete Denkmal
der Gräfin Friederike von Reden bei Kirche Wang im
Riesengebirge. Dieses Denkmal wurde durch um-
gebrochene Bäume im Vorjahre zerschlagen, die Tafel
selbst in viele Teile zertrümmert.
Bei der Untersuchung der Reste war ich anfangs
geneigt, die Platte als eine gebrannte Tonmasse mit
tuffartigen Beimengungen anzusprechen; den weissen
Grund, welcher zur Füllung der Poren eingedrückt
erschien, hielt ich für einen Spachtelgrund, wie solcher
an anderen Stellen des Denkmals als Untergrund für
die Bemalung mit Wachsfarben angewendet worden.
Die oben bezeichneten Ausführungen belehrten mich
erst, dass die Platte ,Lava' sein sollte, wofür wohl
besser .tonhaltiger Tuffstein' zu setzen wäre.
Die Platte selbst, von porösem Gefüge, ist 25 mm
stark, zeigt leichte, nicht tiefe Rötung durch den
Brennprozess; die Vorderseite ist mit einer weissen
Masse (wahrscheinlich Pfeifenton oder Kaolin) und
darüberliegender Glasur überzogen und mit Gold in
kleinen Blättchen bedeckt worden.
Die Malerei mit Muffelfarben beschränkt sich auf
ein edel gezeichnetes Christushaupt in dreireihiger,
vertieft eingeschnittener Zirkelgloriole. Die übrige
ornamentale Bemalung ist in Wachsfarben ausgeführt.
Das Kolorit des Kopfes ist in tiefen warmen
Tönen gehalten; die Technik die des Glasmalers, der
häufig zur Modellierung die Nadel und den Schaber
benützt. Sie ist in Rücksicht auf die gegebene Fern-
wirkung kleinlich und ängstlich zu nennen. Die Farben
dürften Porzellanfarben sein. Das Ganze hat noch
eine fette Glasur erhalten.
Die Arbeit hat den Witterungseinflüssen, obwohl
ziemlich geschützt, nicht standgehalten. Die Feuch-
tigkeit hat von den Rändern aus zerstörend gewirkt
und Vergoldung und Untergrund teilweise abgesprengt.
Die Malerei des Kopfes lässt sich leicht mit der
Messerspitze vom Untergrund abheben, ein Beweis
dafür, dass die Schmelzpunkte der Grundglasur und
Malfarben nicht beieinander gelegen haben, Forde-
rungen, die unsere heutige keramische Chemie und
Technik spielend überwindet.
Durch diese Platte, welche also 50 Jahre freier
Luft und klimatischen Einwirkungen ausgesetzt war,
ist der Beweis erbracht, dass dieser Technik, die als
Neuerung eigentlich nur die Verwendung von Natur-
stein brachte, im übrigen aber nur als Majolika- oder
Porzellanmalerei anzusehen ist, eine besondere Wider-
standsfähigkeit nicht nachgerühmt werden kann."
Breslau. Joseph Langer, Kunstmaler.
Verlag der Werkstatt der Kunst (E. A. Seemann, Leipzig).
Münchner kunsttechnische Biätter.
Nr. 9.
würden; namentlich sei das schöne Saskiaporträt
Rembrandts — eine seiner besten Saskias —
nach der Lackabnahme nicht wiederzuerkennen.
Weiter heisst es dann:
„Alte stehen unter dem schmerzlichen Eindruck,
dass das Bild so ziemlich verioren ist. Das, was man
hauptsächlich an demselben bewunderte, die Skala der
reichen und warmen Töne, welche in goldigem Glanze
das ganze Bild durchleuchteten, liess man verschwinden,
als wäre das eine krankhafte Zugabe gewesen. Das
Gemälde, oder vielmehr, was noch davon nachgeblieben
ist, erscheint nun kraftlos, kalt und farblos. Nicht nur
ist die Harmonie zerstört — denn das Abreiben, das
an einigen Steilen stärker wie an andern betrieben
wurde, hat auch den Zusammenklang der Töne ver-
fälscht — sondern einige Teile, z. B. die Hände sind
fast ganz ruiniert.
Wir hoffen, dass dies traurige Vorkommnis den
Eifer derjenigen hemmen wird, die schon davon träumten,
alle Gemälde des Museums, die bisher den Händen der
Restaurateure entgangen waren, derselben Behandlung
unterziehen zu lassen. Um Weiteres anzuführen, hat
man ein Bild von De Crayer geglaubt mit einen blauen
Ueberzug verschönen zu müssen. Und gar, wenn man
bedenkt, dass die Perle unserer Sammlung, das be-
wunderungswürdige Triptychon von Quinten Massys
vor einigen Jahren um ein Stück kleiner aus der
Reparaturwerkstatt hervorgegangen ist, so wird es Zeit,
dass der Notschrei, den wir jetzt ausstossen, gehört
wird."
Nachdem dann der Autor auch auf die Schäden
eingeht, die in anderen Museen, in Deutschland,
Oesterreich und Italien durch das Restaurieren
entstanden sind, fahrt er fort:
„Augenscheinlich entspringt dieses Abreiben aus
den besten Absichten, doch sind es die guten Absichten,
womit der Weg zur Hölle gepflastert ist. Man möchte
das Werk so zeigen, wie es der Künstler gemalt hat.
es in seiner Ursprünglichkeit wiederherstellen, und
kurz entschlossen nimmt man das fort, woran die Zeit
eine so köstliche Mitarbeiterin gewesen ist. Zwischen
dieser Mitarbeiterin und der Mitarbeit des geringen
Schmierers, der sich nicht geniert, eine Hand Van
Dyks oder eine Figur Rembrandts zu übermalen, ist
man keinen Augenblick unschlüssig. Andererseits voll-
führt die Neugierde der Kunstgelehrten, namentlich der
aus deutschen Schulen hervorgegangenen, welche be-
wunderungswürdige Archivforscher und scharfe Denker
sind, manchmal abscheuliche Streiche. Sie sind dahin
gelangt, die Kunstwerke nur als Dokumente anzusehen,
welche man abreiben muss, um zu wissen, was darunter
ist. Aber mit welchem Preise muss man die Signatur,
welche sie entdecken, bezahlen! Das Schriftzeichen,
sonst gewiss sehr wichtig, in den letzten 50 Jahren von
den Kunstgelehrten aber zur Hauptsache gemacht,
wiegt doch kein zerstörtes, selbst mittelmässiges Ge-
mälde auf! Im Gegenteil, man soll uns die Kunstwerke
ein wenig in der Art derjenigen Gläubigen lieben
lassen, welche nicht wollen, dass die Wissenschaft
ihre Erforschungen in den Bereich ihres Glaubens
hineinträgt."
Zum Schluss verlangt der Schreiber des Auf-
satzes, dass ähnliche Eingriffe nicht ohne ministe-
rielle Entscheidung getroffen werden dürften. —
Leider bestätigen Antwerpener Künstler voll-
auf die mitgeteilten traurigen Tatsachen. Erfreulich
ist aber die energische öffentliche Stellungnahme
diesen Eingriffen gegenüber, im Gegensatz zu der
beschaulichen Ruhe, mit der die Künstler anderer
Nationen die Kunstwerke, über die sie wachen
sollten, ihrem Schicksal überlassen.
Hoffen wir, dass es der dortigen Künstler-
schaft mit mehr Glück wie bei uns gelingt, ihre
Kunstschätze, die bis dahin noch zum grossen
Teil in ursprünglicher Schönheit erhalten waren,
vor den Restauratoren zu retten.
Eingebrannte Malerei auf Lava.
Zu dem im IV. Jahrgang, Nr. n, der „Münchner
kunsttechnischen Blätter" veröffentlichten Aufsatz obi-
ger Bezeichnung möchte ich nachstehende Aus-
führungen beitragen:
„Eine derartige lünettenförmige Tafel in den Ab-
messungen von 0,55—:,!o m zierte das vom König
Friedrich Wilhelm iV. im Jahre 1857 errichtete Denkmal
der Gräfin Friederike von Reden bei Kirche Wang im
Riesengebirge. Dieses Denkmal wurde durch um-
gebrochene Bäume im Vorjahre zerschlagen, die Tafel
selbst in viele Teile zertrümmert.
Bei der Untersuchung der Reste war ich anfangs
geneigt, die Platte als eine gebrannte Tonmasse mit
tuffartigen Beimengungen anzusprechen; den weissen
Grund, welcher zur Füllung der Poren eingedrückt
erschien, hielt ich für einen Spachtelgrund, wie solcher
an anderen Stellen des Denkmals als Untergrund für
die Bemalung mit Wachsfarben angewendet worden.
Die oben bezeichneten Ausführungen belehrten mich
erst, dass die Platte ,Lava' sein sollte, wofür wohl
besser .tonhaltiger Tuffstein' zu setzen wäre.
Die Platte selbst, von porösem Gefüge, ist 25 mm
stark, zeigt leichte, nicht tiefe Rötung durch den
Brennprozess; die Vorderseite ist mit einer weissen
Masse (wahrscheinlich Pfeifenton oder Kaolin) und
darüberliegender Glasur überzogen und mit Gold in
kleinen Blättchen bedeckt worden.
Die Malerei mit Muffelfarben beschränkt sich auf
ein edel gezeichnetes Christushaupt in dreireihiger,
vertieft eingeschnittener Zirkelgloriole. Die übrige
ornamentale Bemalung ist in Wachsfarben ausgeführt.
Das Kolorit des Kopfes ist in tiefen warmen
Tönen gehalten; die Technik die des Glasmalers, der
häufig zur Modellierung die Nadel und den Schaber
benützt. Sie ist in Rücksicht auf die gegebene Fern-
wirkung kleinlich und ängstlich zu nennen. Die Farben
dürften Porzellanfarben sein. Das Ganze hat noch
eine fette Glasur erhalten.
Die Arbeit hat den Witterungseinflüssen, obwohl
ziemlich geschützt, nicht standgehalten. Die Feuch-
tigkeit hat von den Rändern aus zerstörend gewirkt
und Vergoldung und Untergrund teilweise abgesprengt.
Die Malerei des Kopfes lässt sich leicht mit der
Messerspitze vom Untergrund abheben, ein Beweis
dafür, dass die Schmelzpunkte der Grundglasur und
Malfarben nicht beieinander gelegen haben, Forde-
rungen, die unsere heutige keramische Chemie und
Technik spielend überwindet.
Durch diese Platte, welche also 50 Jahre freier
Luft und klimatischen Einwirkungen ausgesetzt war,
ist der Beweis erbracht, dass dieser Technik, die als
Neuerung eigentlich nur die Verwendung von Natur-
stein brachte, im übrigen aber nur als Majolika- oder
Porzellanmalerei anzusehen ist, eine besondere Wider-
standsfähigkeit nicht nachgerühmt werden kann."
Breslau. Joseph Langer, Kunstmaler.
Verlag der Werkstatt der Kunst (E. A. Seemann, Leipzig).