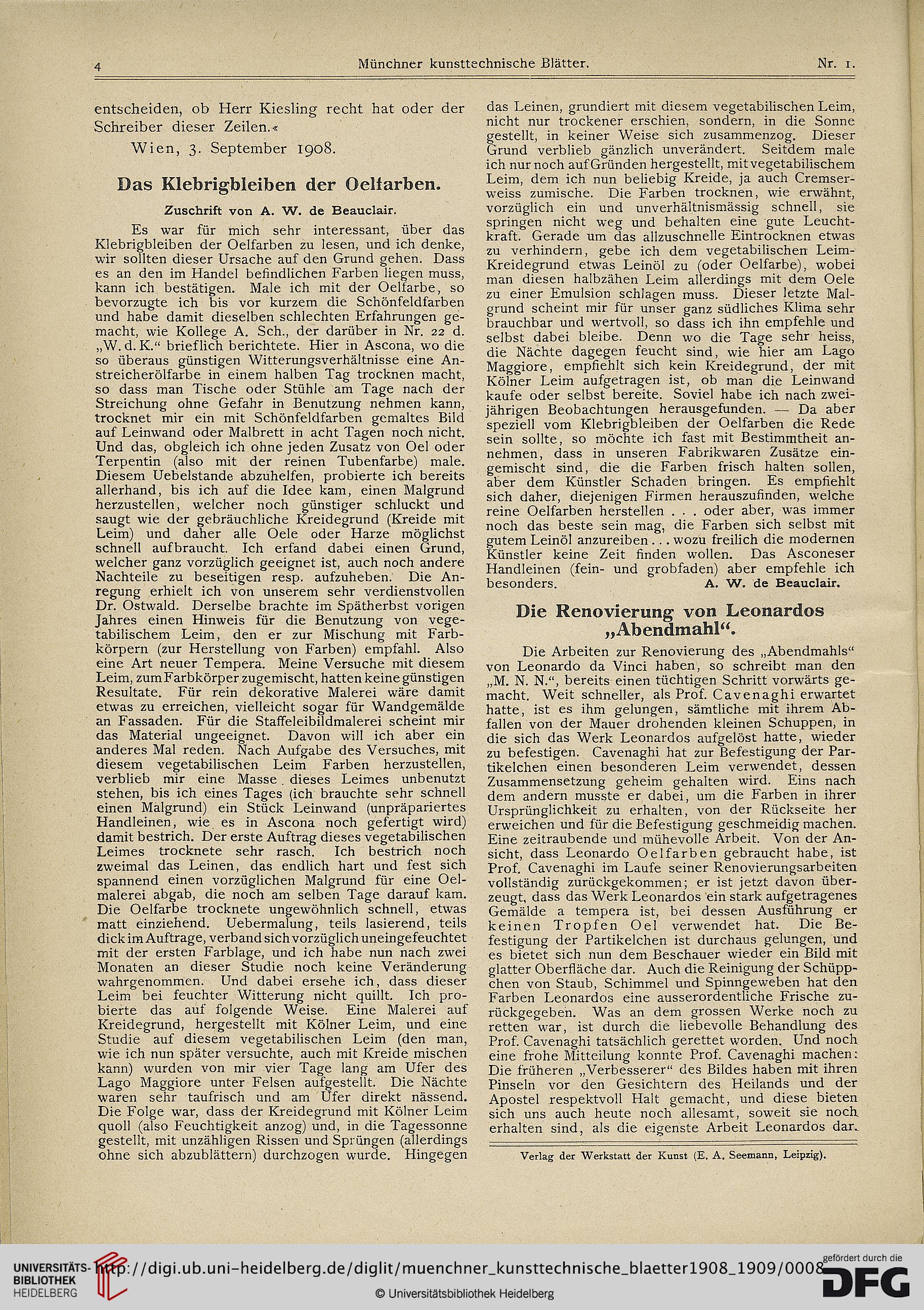4
Münchner kunsttechnische Blätter.
Nr. i.
entscheiden, ob Herr Kiesling recht hat oder der
Schreiber dieser Zeilen.-:
Wien, 3. September 1908.
Das Klebrigbleiben der Oeliarben.
Zuschrift von A. W. de Beauclair.
Es war für mich sehr interessant, über das
Klebrigbleiben der Oelfarben zu lesen, und ich denke,
wir sollten dieser Ursache auf den Grund gehen. Dass
es an den im Handel befindlichen Farben liegen muss,
kann ich bestätigen. Male ich mit der Oelfarbe, so
bevorzugte ich bis vor kurzem die Schönfeldfarben
und habe damit dieselben schlechten Erfahrungen ge-
macht, wie Kollege A. Sch., der darüber in Nr. 22 d.
„W. d. K." brieflich berichtete. Hier in Ascona, wo die
so überaus günstigen Witterungsverhältnisse eine An-
streicherölfarbe in einem halben Tag trocknen macht,
so dass man Tische oder Stühle am Tage nach der
Streichung ohne Gefahr in Benutzung nehmen kann,
trocknet mir ein mit Schönfeldfarben gemaltes Bild
auf Leinwand oder Malbrett in acht Tagen noch nicht.
Und das, obgleich ich ohne jeden Zusatz von Oel oder
Terpentin (also mit der reinen Tubenfarbe) male.
Diesem Uebelstande abzuhelfen, probierte ich bereits
allerhand, bis ich auf die Idee kam, einen Malgrund
herzustellen, welcher noch günstiger schluckt und
saugt wie der gebräuchliche Kreidegrund (Kreide mit
Leim) und daher alle Oele oder Harze möglichst
schnell aufbraucht. Ich erfand dabei einen Grund,
welcher ganz vorzüglich geeignet ist, auch noch andere
Nachteile zu beseitigen resp. aufzuheben. Die An-
regung erhielt ich von unserem sehr verdienstvollen
Dr. Ostwald. Derselbe brachte im Spätherbst vorigen
Jahres einen Hinweis für die Benutzung von vege-
tabilischem Leim, den er zur Mischung mit Farb-
körpern (zur Herstellung von Farben) empfahl. Also
eine Art neuer Tempera. Meine Versuche mit diesem
Leim, zumFarbkörper zugemischt, hatten keine günstigen
Resultate. Für rein dekorative Malerei wäre damit
etwas zu erreichen, vielleicht sogar für Wandgemälde
an Fassaden. Für die Staffeleibildmalerei scheint mir
das Material ungeeignet. Davon will ich aber ein
anderes Mal reden. Nach Aufgabe des Versuches, mit
diesem vegetabilischen Leim Farben herzustellen,
verblieb mir eine Masse dieses Leimes unbenutzt
stehen, bis ich eines Tages (ich brauchte sehr schnell
einen Malgrund) ein Stück Leinwand (unpräpariertes
Handleinen, wie es in Ascona noch gefertigt wird)
damit bestrich. Der erste Auftrag dieses vegetabilischen
Leimes trocknete sehr rasch. Ich bestrich noch
zweimal das Leinen, das endlich hart und fest sich
spannend einen vorzüglichen Malgrund für eine Oel-
malerei abgab, die noch am selben Tage darauf kam.
Die Oelfarbe trocknete ungewöhnlich schnell, etwas
matt einziehend. Uebermalung, teils lasierend, teils
dick im Aufträge, verband sich vorzüglich uneingefeuchtet
mit der ersten Farblage, und ich habe nun nach zwei
Monaten an dieser Studie noch keine Veränderung
wahrgenommen. Und dabei ersehe ich, dass dieser
Leim bei feuchter Witterung nicht quillt. Ich pro-
bierte das auf folgende Weise. Eine Malerei auf
Kreidegrund, hergestellt mit Kölner Leim, und eine
Studie auf diesem vegetabilischen Leim (den man,
wie ich nun später versuchte, auch mit Kreide mischen
kann) wurden von mir vier Tage lang am Ufer des
Lago Maggiore unter Felsen aufgestelit. Die Nächte
waren sehr taufrisch und am Ufer direkt nässend.
Die Folge war, dass der Kreidegrund mit Kölner Leim
quoll (also Feuchtigkeit anzog) und, in die Tagessonne
gestellt, mit unzähligen Rissen und Sprüngen (allerdings
ohne sich abzublättern) durchzogen wurde. Hingegen
das Leinen, grundiert mit diesem vegetabilischen Leim,
nicht nur trockener erschien, sondern, in die Sonne
gestellt, in keiner Weise sich zusammenzog. Dieser
Grund verblieb gänzlich unverändert. Seitdem male
ich nur noch aufGründen hergestellt, mit vegetabilischem
Leim, dem ich nun beliebig Kreide, ja auch Cremser-
weiss zumische. Die Farben trocknen, wie erwähnt,
vorzüglich ein und unverhältnismässig schnell, sie
springen nicht weg und behalten eine gute Leucht-
kraft. Gerade um das allzuschnelle Eintrocknen etwas
zu verhindern, gebe ich dem vegetabilischen Leim-
Kreidegrund etwas Leinöl zu (oder Oelfarbe), wobei
man diesen halbzähen Leim allerdings mit dem Oele
zu einer Emulsion schlagen muss. Dieser letzte Mal-
grund scheint mir für unser ganz südliches Klima sehr
brauchbar und wertvoll, so dass ich ihn empfehle und
selbst dabei bleibe. Denn wo die Tage sehr heiss,
die Nächte dagegen feucht sind, wie hier am Lago
Maggiore, empfiehlt sich kein Kreidegrund, der mit
Kölner Leim aufgetragen ist, ob man die Leinwand
kaufe oder selbst bereite. Soviel habe ich nach zwei-
jährigen Beobachtungen herausgefunden. — Da aber
speziell vom Klebrigbleiben der Oelfarben die Rede
sein sollte, so möchte ich fast mit Bestimmtheit an-
nehmen, dass in unseren Fabrikwaren Zusätze ein-
gemischt sind, die die Farben frisch halten sollen,
aber dem Künstler Schaden bringen. Es empfiehlt
sich daher, diejenigen Firmen herauszufinden, welche
reine Oelfarben herstellen . . . oder aber, was immer
noch das beste sein mag, die Farben sich selbst mit
gutem Leinöl anzureiben ... wozu freilich die modernen
Künstler keine Zeit finden woollen. Das Asconeser
Handleinen (fein- und grobfaden) aber empfehle ich
besonders. A. W. de Beauclair.
Die Renovierung von Leonardos
„Abendmahl".
Die Arbeiten zur Renovierung des „Abendmahls"
von Leonardo da Vinci haben, so schreibt man den
„M. N. N.", bereits einen tüchtigen Schritt vorwärts ge-
macht. Weit schneller, als Prof. Cavenaghi erwartet
hatte, ist es ihm gelungen, sämtliche mit ihrem Ab-
fallen von der Mauer drohenden kleinen Schuppen, in
die sich das Werk Leonardos aufgelöst hatte, wieder
zu befestigen. Cavenaghi hat zur Befestigung der Par-
tikelchen einen besonderen Leim verwendet, dessen
Zusammensetzung geheim gehalten wird. Eins nach
dem andern musste er dabei, um die Farben in ihrer
Ursprünglichkeit zu erhalten, von der Rückseite her
erweichen und für die Befestigung geschmeidig machen.
Eine zeitraubende und mühevolle Arbeit. Von der An-
sicht, dass Leonardo Oelfarben gebraucht habe, ist
Prof. Cavenaghi im Laufe seiner Renovierungsarbeiten
vollständig zurückgekommen; er ist jetzt davon über-
zeugt, dass das Werk Leonardos ein stark aufgetragenes
Gemälde a tempera ist, bei dessen Ausführung er
keinen Tropfen Oel verwendet hat. Die Be-
festigung der Partikelchen ist durchaus gelungen, und
es bietet sich nun dem Beschauer wieder ein Bild mit
glatter Oberfläche dar. Auch die Reinigung der Schüpp-
chen von Staub, Schimmel und Spinngeweben hat den
Farben Leonardos eine ausserordentliche Frische zu-
rückgegeben. Was an dem grossen Werke noch zu
retten war, ist durch die liebevolle Behandlung des
Prof. Cavenaghi tatsächlich gerettet worden. Und noch
eine frohe Mitteilung konnte Prof. Cavenaghi machen:
Die früheren „Verbesserer" des Bildes haben mit ihren
Pinseln vor den Gesichtern des Heilands und der
Apostel respektvoll Halt gemacht, und diese bieten
sich uns auch heute noch allesamt, soweit sie noch
erhalten sind, als die eigenste Arbeit Leonardos dar.
Verlag der Werkstatt der Kunst (E. A. Seemann, Leipzig).
Münchner kunsttechnische Blätter.
Nr. i.
entscheiden, ob Herr Kiesling recht hat oder der
Schreiber dieser Zeilen.-:
Wien, 3. September 1908.
Das Klebrigbleiben der Oeliarben.
Zuschrift von A. W. de Beauclair.
Es war für mich sehr interessant, über das
Klebrigbleiben der Oelfarben zu lesen, und ich denke,
wir sollten dieser Ursache auf den Grund gehen. Dass
es an den im Handel befindlichen Farben liegen muss,
kann ich bestätigen. Male ich mit der Oelfarbe, so
bevorzugte ich bis vor kurzem die Schönfeldfarben
und habe damit dieselben schlechten Erfahrungen ge-
macht, wie Kollege A. Sch., der darüber in Nr. 22 d.
„W. d. K." brieflich berichtete. Hier in Ascona, wo die
so überaus günstigen Witterungsverhältnisse eine An-
streicherölfarbe in einem halben Tag trocknen macht,
so dass man Tische oder Stühle am Tage nach der
Streichung ohne Gefahr in Benutzung nehmen kann,
trocknet mir ein mit Schönfeldfarben gemaltes Bild
auf Leinwand oder Malbrett in acht Tagen noch nicht.
Und das, obgleich ich ohne jeden Zusatz von Oel oder
Terpentin (also mit der reinen Tubenfarbe) male.
Diesem Uebelstande abzuhelfen, probierte ich bereits
allerhand, bis ich auf die Idee kam, einen Malgrund
herzustellen, welcher noch günstiger schluckt und
saugt wie der gebräuchliche Kreidegrund (Kreide mit
Leim) und daher alle Oele oder Harze möglichst
schnell aufbraucht. Ich erfand dabei einen Grund,
welcher ganz vorzüglich geeignet ist, auch noch andere
Nachteile zu beseitigen resp. aufzuheben. Die An-
regung erhielt ich von unserem sehr verdienstvollen
Dr. Ostwald. Derselbe brachte im Spätherbst vorigen
Jahres einen Hinweis für die Benutzung von vege-
tabilischem Leim, den er zur Mischung mit Farb-
körpern (zur Herstellung von Farben) empfahl. Also
eine Art neuer Tempera. Meine Versuche mit diesem
Leim, zumFarbkörper zugemischt, hatten keine günstigen
Resultate. Für rein dekorative Malerei wäre damit
etwas zu erreichen, vielleicht sogar für Wandgemälde
an Fassaden. Für die Staffeleibildmalerei scheint mir
das Material ungeeignet. Davon will ich aber ein
anderes Mal reden. Nach Aufgabe des Versuches, mit
diesem vegetabilischen Leim Farben herzustellen,
verblieb mir eine Masse dieses Leimes unbenutzt
stehen, bis ich eines Tages (ich brauchte sehr schnell
einen Malgrund) ein Stück Leinwand (unpräpariertes
Handleinen, wie es in Ascona noch gefertigt wird)
damit bestrich. Der erste Auftrag dieses vegetabilischen
Leimes trocknete sehr rasch. Ich bestrich noch
zweimal das Leinen, das endlich hart und fest sich
spannend einen vorzüglichen Malgrund für eine Oel-
malerei abgab, die noch am selben Tage darauf kam.
Die Oelfarbe trocknete ungewöhnlich schnell, etwas
matt einziehend. Uebermalung, teils lasierend, teils
dick im Aufträge, verband sich vorzüglich uneingefeuchtet
mit der ersten Farblage, und ich habe nun nach zwei
Monaten an dieser Studie noch keine Veränderung
wahrgenommen. Und dabei ersehe ich, dass dieser
Leim bei feuchter Witterung nicht quillt. Ich pro-
bierte das auf folgende Weise. Eine Malerei auf
Kreidegrund, hergestellt mit Kölner Leim, und eine
Studie auf diesem vegetabilischen Leim (den man,
wie ich nun später versuchte, auch mit Kreide mischen
kann) wurden von mir vier Tage lang am Ufer des
Lago Maggiore unter Felsen aufgestelit. Die Nächte
waren sehr taufrisch und am Ufer direkt nässend.
Die Folge war, dass der Kreidegrund mit Kölner Leim
quoll (also Feuchtigkeit anzog) und, in die Tagessonne
gestellt, mit unzähligen Rissen und Sprüngen (allerdings
ohne sich abzublättern) durchzogen wurde. Hingegen
das Leinen, grundiert mit diesem vegetabilischen Leim,
nicht nur trockener erschien, sondern, in die Sonne
gestellt, in keiner Weise sich zusammenzog. Dieser
Grund verblieb gänzlich unverändert. Seitdem male
ich nur noch aufGründen hergestellt, mit vegetabilischem
Leim, dem ich nun beliebig Kreide, ja auch Cremser-
weiss zumische. Die Farben trocknen, wie erwähnt,
vorzüglich ein und unverhältnismässig schnell, sie
springen nicht weg und behalten eine gute Leucht-
kraft. Gerade um das allzuschnelle Eintrocknen etwas
zu verhindern, gebe ich dem vegetabilischen Leim-
Kreidegrund etwas Leinöl zu (oder Oelfarbe), wobei
man diesen halbzähen Leim allerdings mit dem Oele
zu einer Emulsion schlagen muss. Dieser letzte Mal-
grund scheint mir für unser ganz südliches Klima sehr
brauchbar und wertvoll, so dass ich ihn empfehle und
selbst dabei bleibe. Denn wo die Tage sehr heiss,
die Nächte dagegen feucht sind, wie hier am Lago
Maggiore, empfiehlt sich kein Kreidegrund, der mit
Kölner Leim aufgetragen ist, ob man die Leinwand
kaufe oder selbst bereite. Soviel habe ich nach zwei-
jährigen Beobachtungen herausgefunden. — Da aber
speziell vom Klebrigbleiben der Oelfarben die Rede
sein sollte, so möchte ich fast mit Bestimmtheit an-
nehmen, dass in unseren Fabrikwaren Zusätze ein-
gemischt sind, die die Farben frisch halten sollen,
aber dem Künstler Schaden bringen. Es empfiehlt
sich daher, diejenigen Firmen herauszufinden, welche
reine Oelfarben herstellen . . . oder aber, was immer
noch das beste sein mag, die Farben sich selbst mit
gutem Leinöl anzureiben ... wozu freilich die modernen
Künstler keine Zeit finden woollen. Das Asconeser
Handleinen (fein- und grobfaden) aber empfehle ich
besonders. A. W. de Beauclair.
Die Renovierung von Leonardos
„Abendmahl".
Die Arbeiten zur Renovierung des „Abendmahls"
von Leonardo da Vinci haben, so schreibt man den
„M. N. N.", bereits einen tüchtigen Schritt vorwärts ge-
macht. Weit schneller, als Prof. Cavenaghi erwartet
hatte, ist es ihm gelungen, sämtliche mit ihrem Ab-
fallen von der Mauer drohenden kleinen Schuppen, in
die sich das Werk Leonardos aufgelöst hatte, wieder
zu befestigen. Cavenaghi hat zur Befestigung der Par-
tikelchen einen besonderen Leim verwendet, dessen
Zusammensetzung geheim gehalten wird. Eins nach
dem andern musste er dabei, um die Farben in ihrer
Ursprünglichkeit zu erhalten, von der Rückseite her
erweichen und für die Befestigung geschmeidig machen.
Eine zeitraubende und mühevolle Arbeit. Von der An-
sicht, dass Leonardo Oelfarben gebraucht habe, ist
Prof. Cavenaghi im Laufe seiner Renovierungsarbeiten
vollständig zurückgekommen; er ist jetzt davon über-
zeugt, dass das Werk Leonardos ein stark aufgetragenes
Gemälde a tempera ist, bei dessen Ausführung er
keinen Tropfen Oel verwendet hat. Die Be-
festigung der Partikelchen ist durchaus gelungen, und
es bietet sich nun dem Beschauer wieder ein Bild mit
glatter Oberfläche dar. Auch die Reinigung der Schüpp-
chen von Staub, Schimmel und Spinngeweben hat den
Farben Leonardos eine ausserordentliche Frische zu-
rückgegeben. Was an dem grossen Werke noch zu
retten war, ist durch die liebevolle Behandlung des
Prof. Cavenaghi tatsächlich gerettet worden. Und noch
eine frohe Mitteilung konnte Prof. Cavenaghi machen:
Die früheren „Verbesserer" des Bildes haben mit ihren
Pinseln vor den Gesichtern des Heilands und der
Apostel respektvoll Halt gemacht, und diese bieten
sich uns auch heute noch allesamt, soweit sie noch
erhalten sind, als die eigenste Arbeit Leonardos dar.
Verlag der Werkstatt der Kunst (E. A. Seemann, Leipzig).