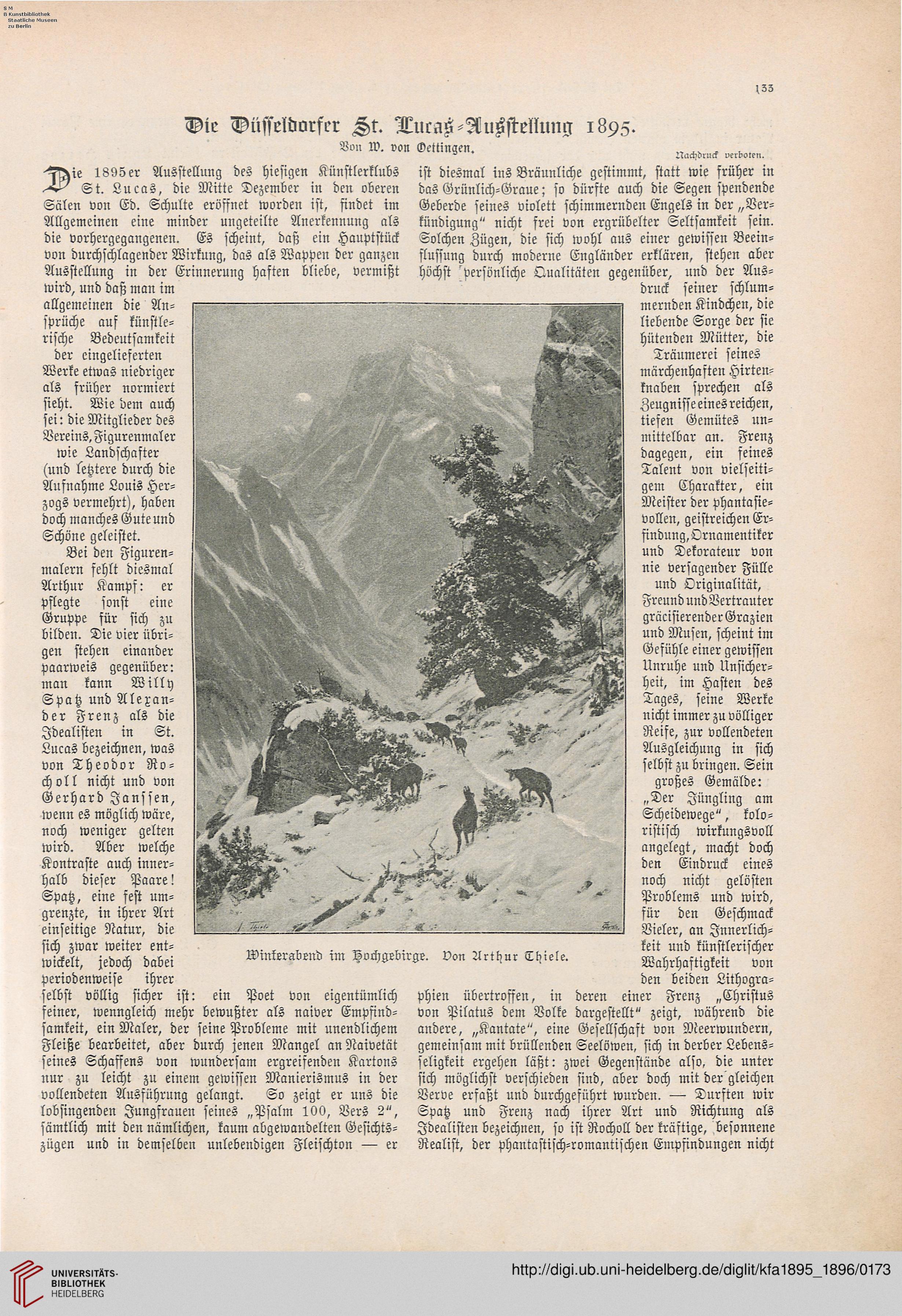1ZZ
Die Düsseldorfer St. Lmus-Ausstellung 1895.
Von 1V. von Dettingen.
ie 1895 er Ausstellung des hiesigen Künstlerklubs
St. Lucas, die Mitte Dezember in den oberen
Sälen von Ed. Schulte eröffnet worden ist, findet im
Allgemeinen eine minder ungeteilte Anerkennung als
die vorhergegangenen. Es scheint, daß ein Hauptstück
von durchschlagender Wirkung, das als Wappen der ganzen
Ausstellung in der Erinnerung haften bliebe, vermißt
wird, und daß man im
allgemeinen die An-
sprüche auf künstle-
rische Bedeutsamkeit
der cingelieferten
Werke etwas niedriger
als früher normiert
sieht. Wie dem auch
sei: die Mitglieder des
Vereins, Figurenmaler
wie Landschafter
(und letztere durch die
Aufnahme Louis Her-
zogs vermehrt), haben
doch manches Guteund
Schöne geleistet.
Bei den Figuren-
malern fehlt diesmal
Arthur Kampf: er
pflegte sonst eine
Gruppe für sich zu
bilden. Die vier übri-
gen stehen einander
paarweis gegenüber:
man kann Willy
Spatz und Alexan-
der Frenz als die
Idealisten in St.
Lucas bezeichnen, was
von Theodor Ro-
ch oll nicht und von
Gerhard Janssen,
wenn es möglich wäre,
noch weniger gelten
wird. Aber welche
Kontraste auch inner-
halb dieser Paare!
Spatz, eine fest um-
grenzte, in ihrer Art
einseitige Natur, die
sich zwar weiter ent-
wickelt, jedoch dabei
periodenweise ihrer
selbst völlig sicher ist: ein Poet von eigentümlich
feiner, wenngleich mehr bewußter als naiver Empfind-
samkeit, ein Maler, der seine Probleme mit unendlichem
Fleiße bearbeitet, aber durch jenen Mangel an Naivetät
seines Schaffens von wundersam ergreifenden Kartons
nur zu leicht zu einem gewissen Manierismus in der
vollendeten Ausführung gelangt. So zeigt er uns die
lobsingenden Jungfrauen seines „Psalm 100, Vers 2",
sämtlich mit den nämlichen, kaum abgewandelten Gesichts-
zügen und in demselben unlebendigen Fleischton — er
ist diesmal ins Bräunliche gestimmt, statt wie früher in
das Grünlich-Graue; so dürfte auch die Segen spendende
Geberde seines violett schimmernden Engels in der „Ver-
kündigung" nicht frei von ergrübelter Seltsamkeit sein.
Solchen Zügen, die sich wohl aus einer gewissen Beein-
flussung durch moderne Engländer erklären, stehen aber
höchst persönliche Qualitäten gegenüber, und der Aus-
druck seiner schlum-
mernden Kindchen, die
liebende Sorge der sie
hütenden Mütter, die
Träumerei seines
märchenhaften Hirten-
knaben sprechen als
Zeugnisseeines reichen,
tiefen Gemütes un-
mittelbar an. Frenz
dagegen, ein feines
Talent von vielseiti-
gem Charakter, ein
Meister der phantasie-
vollen, geistreichen Er-
findung, Ornamentiker
und Dekorateur von
nie versagender Fülle
und Originalität,
Freund und Vertrauter
gräcisierender Grazien
und Musen, scheint im
Gefühle einer gewissen
Unruhe und Unsicher-
heit, im Hasten des
Tages, seine Werke
nicht immer zu völliger
Reife, zur vollendeten
Ausgleichung in sich
selbst zu bringen. Sein
großes Gemälde:
„Der Jüngling am
Scheidewege", kolo-
ristisch wirkungsvoll
angelegt, macht doch
den Eindruck eines
noch nicht gelösten
Problems und wird,
für den Geschmack
Vieler, an Innerlich-
keit und künstlerischer
Wahrhaftigkeit von
den beiden Lithogra-
phien übertroffen, in deren einer Frenz „Christus
von Pilatus dem Volke dargestellt" zeigt, während die
andere, „Kantate", eine Gesellschaft von Meerwundern,
gemeinsam mit brüllenden Seelöwen, sich in derber Lebens-
seligkeit ergehen läßt: zwei Gegenstände also, die unter
sich möglichst verschieden sind, aber doch mit der gleichen
Verve erfaßt und durchgeführt wurden. — Durften wir
Spatz und Frenz nach ihrer Art und Richtung als
Idealisten bezeichnen, so ist Rocholl der kräftige, besonnene
Realist, der phantastisch-romantischen Empfindungen nicht
Winterabend im Hochgebirge, von Arthur Thiele.
Die Düsseldorfer St. Lmus-Ausstellung 1895.
Von 1V. von Dettingen.
ie 1895 er Ausstellung des hiesigen Künstlerklubs
St. Lucas, die Mitte Dezember in den oberen
Sälen von Ed. Schulte eröffnet worden ist, findet im
Allgemeinen eine minder ungeteilte Anerkennung als
die vorhergegangenen. Es scheint, daß ein Hauptstück
von durchschlagender Wirkung, das als Wappen der ganzen
Ausstellung in der Erinnerung haften bliebe, vermißt
wird, und daß man im
allgemeinen die An-
sprüche auf künstle-
rische Bedeutsamkeit
der cingelieferten
Werke etwas niedriger
als früher normiert
sieht. Wie dem auch
sei: die Mitglieder des
Vereins, Figurenmaler
wie Landschafter
(und letztere durch die
Aufnahme Louis Her-
zogs vermehrt), haben
doch manches Guteund
Schöne geleistet.
Bei den Figuren-
malern fehlt diesmal
Arthur Kampf: er
pflegte sonst eine
Gruppe für sich zu
bilden. Die vier übri-
gen stehen einander
paarweis gegenüber:
man kann Willy
Spatz und Alexan-
der Frenz als die
Idealisten in St.
Lucas bezeichnen, was
von Theodor Ro-
ch oll nicht und von
Gerhard Janssen,
wenn es möglich wäre,
noch weniger gelten
wird. Aber welche
Kontraste auch inner-
halb dieser Paare!
Spatz, eine fest um-
grenzte, in ihrer Art
einseitige Natur, die
sich zwar weiter ent-
wickelt, jedoch dabei
periodenweise ihrer
selbst völlig sicher ist: ein Poet von eigentümlich
feiner, wenngleich mehr bewußter als naiver Empfind-
samkeit, ein Maler, der seine Probleme mit unendlichem
Fleiße bearbeitet, aber durch jenen Mangel an Naivetät
seines Schaffens von wundersam ergreifenden Kartons
nur zu leicht zu einem gewissen Manierismus in der
vollendeten Ausführung gelangt. So zeigt er uns die
lobsingenden Jungfrauen seines „Psalm 100, Vers 2",
sämtlich mit den nämlichen, kaum abgewandelten Gesichts-
zügen und in demselben unlebendigen Fleischton — er
ist diesmal ins Bräunliche gestimmt, statt wie früher in
das Grünlich-Graue; so dürfte auch die Segen spendende
Geberde seines violett schimmernden Engels in der „Ver-
kündigung" nicht frei von ergrübelter Seltsamkeit sein.
Solchen Zügen, die sich wohl aus einer gewissen Beein-
flussung durch moderne Engländer erklären, stehen aber
höchst persönliche Qualitäten gegenüber, und der Aus-
druck seiner schlum-
mernden Kindchen, die
liebende Sorge der sie
hütenden Mütter, die
Träumerei seines
märchenhaften Hirten-
knaben sprechen als
Zeugnisseeines reichen,
tiefen Gemütes un-
mittelbar an. Frenz
dagegen, ein feines
Talent von vielseiti-
gem Charakter, ein
Meister der phantasie-
vollen, geistreichen Er-
findung, Ornamentiker
und Dekorateur von
nie versagender Fülle
und Originalität,
Freund und Vertrauter
gräcisierender Grazien
und Musen, scheint im
Gefühle einer gewissen
Unruhe und Unsicher-
heit, im Hasten des
Tages, seine Werke
nicht immer zu völliger
Reife, zur vollendeten
Ausgleichung in sich
selbst zu bringen. Sein
großes Gemälde:
„Der Jüngling am
Scheidewege", kolo-
ristisch wirkungsvoll
angelegt, macht doch
den Eindruck eines
noch nicht gelösten
Problems und wird,
für den Geschmack
Vieler, an Innerlich-
keit und künstlerischer
Wahrhaftigkeit von
den beiden Lithogra-
phien übertroffen, in deren einer Frenz „Christus
von Pilatus dem Volke dargestellt" zeigt, während die
andere, „Kantate", eine Gesellschaft von Meerwundern,
gemeinsam mit brüllenden Seelöwen, sich in derber Lebens-
seligkeit ergehen läßt: zwei Gegenstände also, die unter
sich möglichst verschieden sind, aber doch mit der gleichen
Verve erfaßt und durchgeführt wurden. — Durften wir
Spatz und Frenz nach ihrer Art und Richtung als
Idealisten bezeichnen, so ist Rocholl der kräftige, besonnene
Realist, der phantastisch-romantischen Empfindungen nicht
Winterabend im Hochgebirge, von Arthur Thiele.