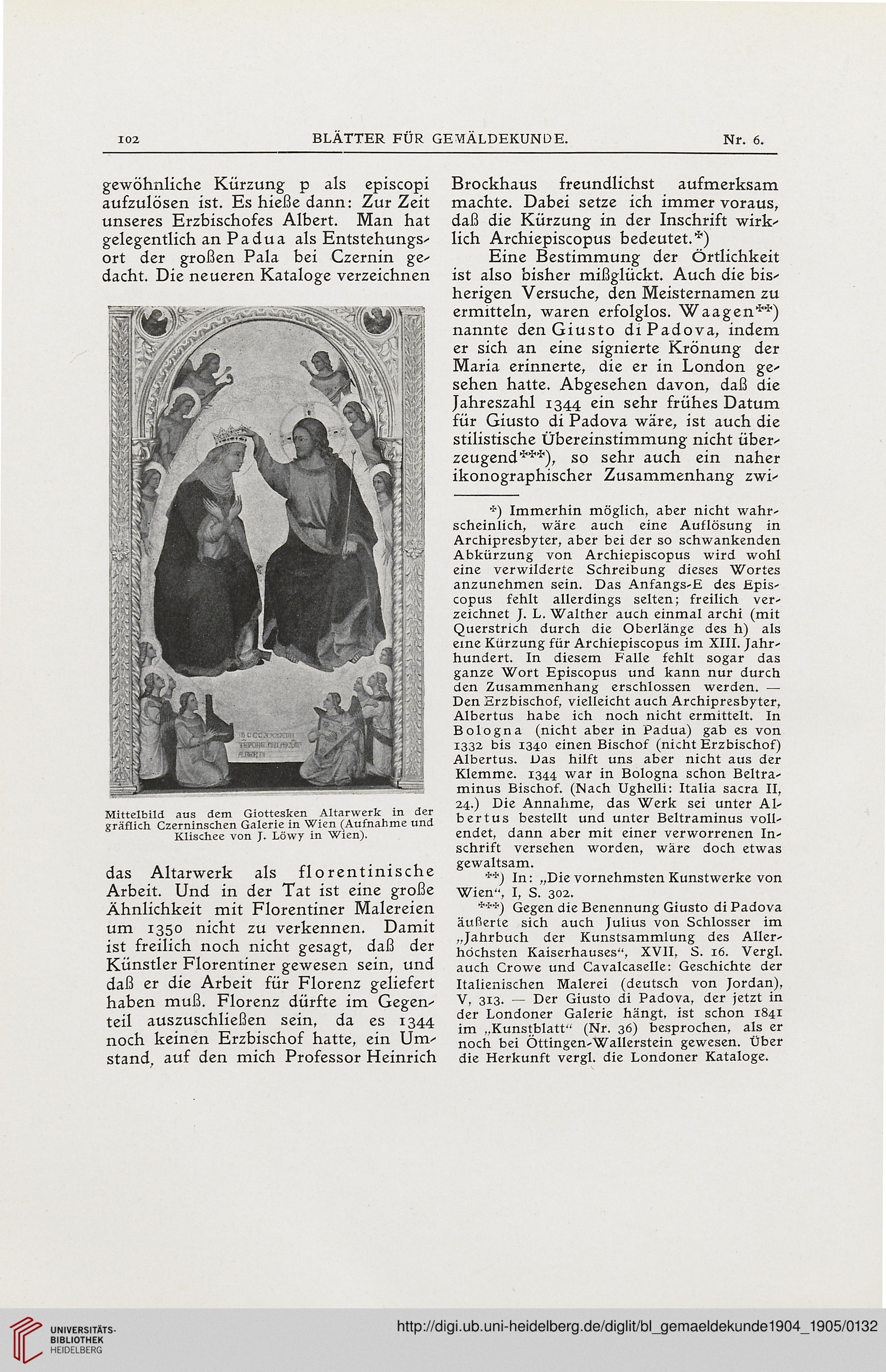102
Nr. 6.
BLÄTTER FÜR GEMÄLDEKUNDE.
gewöhnliche Kürzung p als episcopi
aufzulösen ist. Es hieße dann: Zur Zeit
unseres Erzbischofes Albert. Man hat
gelegentlich an Padua als Entstehungs-
ort der großen Pala bei Czernin ge-
dacht. Die neueren Kataloge verzeichnen
Mittelbild aus dem Giottesken Altarwerk in der
gräflich Czerninschen Galerie in Wien (Aufnahme und
Klischee von J. Löwy in Wien),
das Altarwerk als fl o rentinische
Arbeit. Und in der Tat ist eine große
Ähnlichkeit mit Florentiner Malereien
um 1350 nicht zu verkennen. Damit
ist freilich noch nicht gesagt, daß der
Künstler Florentiner gewesen sein, und
daß er die Arbeit für Florenz geliefert
haben muß. Florenz dürfte im Gegen-
teil auszuschließen sein, da es 1344
noch keinen Erzbischof hatte, ein Um-
stand, auf den mich Professor Heinrich
Brockhaus freundlichst aufmerksam
machte. Dabei setze ich immer voraus,
daß die Kürzung in der Inschrift wirk-
lich Archiepiscopus bedeutet.*)
Eine Bestimmung der Örtlichkeit
ist also bisher mißglückt. Auch die bis-
herigen Versuche, den Meisternamen zu
ermitteln, waren erfolglos. Waagen**)
nannte den Giusto diPadova, indem
er sich an eine signierte Krönung der
Maria erinnerte, die er in London ge-
sehen hatte. Abgesehen davon, daß die
Jahreszahl 1344 ein sehr frühes Datum
für Giusto di Padova wäre, ist auch die
stilistische Übereinstimmung nicht über-
zeugend***), so sehr auch ein naher
ikonographischer Zusammenhang zwi-
*) Immerhin möglich, aber nicht wahr-
scheinlich, wäre auch eine Auflösung in
Archipresbyter, aber bei der so schwankenden
Abkürzung von Archiepiscopus wird wohl
eine verwilderte Schreibung dieses Wortes
anzunehmen sein. Das Anfangs-E des Epis-
copus fehlt allerdings selten; freilich ver-
zeichnet J. L. Walther auch einmal archi (mit
Querstrich durch die Oberlänge des h) als
eine Kürzung für Archiepiscopus im XIII. Jahr-
hundert. In diesem Falle fehlt sogar das
ganze Wort Episcopus und kann nur durch
den Zusammenhang erschlossen werden. —
Den Erzbischof, vielleicht auch Archipresbyter,
Albertus habe ich noch nicht ermittelt. In
Bologna (nicht aber in Padua) gab es von
1332 bis 1340 einen Bischof (nicht Erzbischof)
Albertus. Das hilft uns aber nicht aus der
Klemme. 1344 war in Bologna schon Beltra-
minus Bischof. (Nach Ughelli: Italia sacra II,
24.) Die Annahme, das Werk sei unter Al-
bertus bestellt und unter Beltraminus voll-
endet, dann aber mit einer verworrenen In-
schrift versehen worden, wäre doch etwas
gewaltsam.
**) In: „Die vornehmsten Kunstwerke von
Wien“, I, S. 302.
***) Gegen die Benennung Giusto di Padova
äußerte sich auch Julius von Schlosser im
„Jahrbuch der Kunstsammlung des Aller-
höchsten Kaiserhauses“, XVII, S. 16. Vergl.
auch Crowe und Cavalcaselle: Geschichte der
Italienischen Malerei (deutsch von Jordan),
V, 313. — Der Giusto di Padova, der jetzt in
der Londoner Galerie hängt, ist schon 1841
im „Kunstblatt“ (Nr. 36) besprochen, als er
noch bei Öttingen-Wallerstein gewesen. Über
die Herkunft vergl. die Londoner Kataloge.
Nr. 6.
BLÄTTER FÜR GEMÄLDEKUNDE.
gewöhnliche Kürzung p als episcopi
aufzulösen ist. Es hieße dann: Zur Zeit
unseres Erzbischofes Albert. Man hat
gelegentlich an Padua als Entstehungs-
ort der großen Pala bei Czernin ge-
dacht. Die neueren Kataloge verzeichnen
Mittelbild aus dem Giottesken Altarwerk in der
gräflich Czerninschen Galerie in Wien (Aufnahme und
Klischee von J. Löwy in Wien),
das Altarwerk als fl o rentinische
Arbeit. Und in der Tat ist eine große
Ähnlichkeit mit Florentiner Malereien
um 1350 nicht zu verkennen. Damit
ist freilich noch nicht gesagt, daß der
Künstler Florentiner gewesen sein, und
daß er die Arbeit für Florenz geliefert
haben muß. Florenz dürfte im Gegen-
teil auszuschließen sein, da es 1344
noch keinen Erzbischof hatte, ein Um-
stand, auf den mich Professor Heinrich
Brockhaus freundlichst aufmerksam
machte. Dabei setze ich immer voraus,
daß die Kürzung in der Inschrift wirk-
lich Archiepiscopus bedeutet.*)
Eine Bestimmung der Örtlichkeit
ist also bisher mißglückt. Auch die bis-
herigen Versuche, den Meisternamen zu
ermitteln, waren erfolglos. Waagen**)
nannte den Giusto diPadova, indem
er sich an eine signierte Krönung der
Maria erinnerte, die er in London ge-
sehen hatte. Abgesehen davon, daß die
Jahreszahl 1344 ein sehr frühes Datum
für Giusto di Padova wäre, ist auch die
stilistische Übereinstimmung nicht über-
zeugend***), so sehr auch ein naher
ikonographischer Zusammenhang zwi-
*) Immerhin möglich, aber nicht wahr-
scheinlich, wäre auch eine Auflösung in
Archipresbyter, aber bei der so schwankenden
Abkürzung von Archiepiscopus wird wohl
eine verwilderte Schreibung dieses Wortes
anzunehmen sein. Das Anfangs-E des Epis-
copus fehlt allerdings selten; freilich ver-
zeichnet J. L. Walther auch einmal archi (mit
Querstrich durch die Oberlänge des h) als
eine Kürzung für Archiepiscopus im XIII. Jahr-
hundert. In diesem Falle fehlt sogar das
ganze Wort Episcopus und kann nur durch
den Zusammenhang erschlossen werden. —
Den Erzbischof, vielleicht auch Archipresbyter,
Albertus habe ich noch nicht ermittelt. In
Bologna (nicht aber in Padua) gab es von
1332 bis 1340 einen Bischof (nicht Erzbischof)
Albertus. Das hilft uns aber nicht aus der
Klemme. 1344 war in Bologna schon Beltra-
minus Bischof. (Nach Ughelli: Italia sacra II,
24.) Die Annahme, das Werk sei unter Al-
bertus bestellt und unter Beltraminus voll-
endet, dann aber mit einer verworrenen In-
schrift versehen worden, wäre doch etwas
gewaltsam.
**) In: „Die vornehmsten Kunstwerke von
Wien“, I, S. 302.
***) Gegen die Benennung Giusto di Padova
äußerte sich auch Julius von Schlosser im
„Jahrbuch der Kunstsammlung des Aller-
höchsten Kaiserhauses“, XVII, S. 16. Vergl.
auch Crowe und Cavalcaselle: Geschichte der
Italienischen Malerei (deutsch von Jordan),
V, 313. — Der Giusto di Padova, der jetzt in
der Londoner Galerie hängt, ist schon 1841
im „Kunstblatt“ (Nr. 36) besprochen, als er
noch bei Öttingen-Wallerstein gewesen. Über
die Herkunft vergl. die Londoner Kataloge.