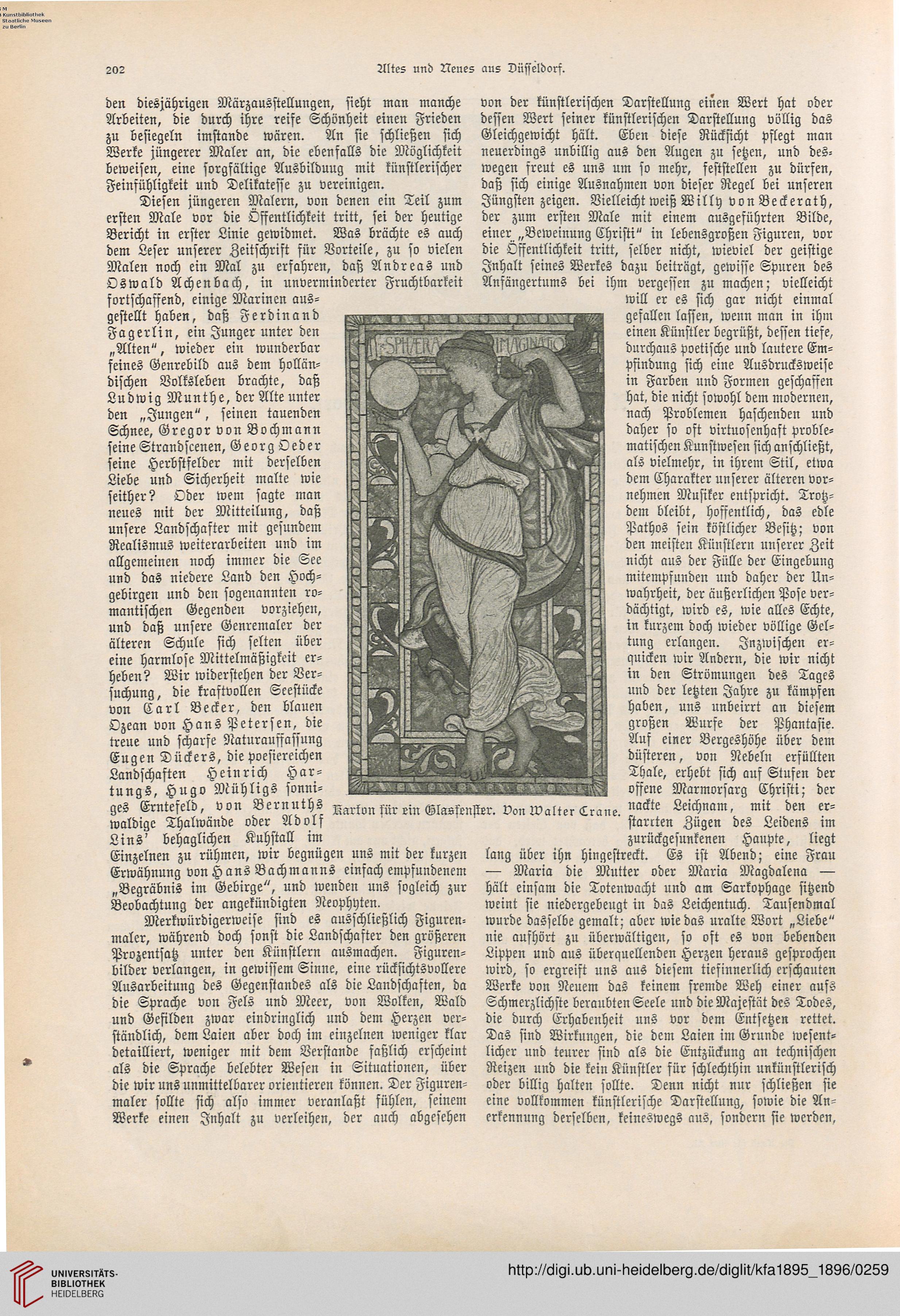202
Altes und Neues aus Düsseldorf.
den diesjährigen Märzausstellungen, sieht man manche
Arbeiten, die durch ihre reife Schönheit einen Frieden
zu besiegeln imstande wären. An sie schließen sich
Werke jüngerer Maler an, die ebenfalls die Möglichkeit
beweisen, eine sorgfältige Ausbildung mit künstlerischer
Feinfühligkeit und Delikatesse zu vereinigen.
Diesen jüngeren Malern, von denen ein Teil zum
ersten Male vor die Öffentlichkeit tritt, sei der heutige
Bericht in erster Linie gewidmet. Was brächte es auch
dem Leser unserer Zeitschrift für Vorteile, zu so vielen
Malen noch ein Mal zu erfahren, daß Andreas und
Oswald Achenbach, in unverminderter Fruchtbarkeit
fortschaffend, einige Marinen aus-
gestellt haben, daß Ferdinand
Fagerlin, ein Junger unter den
„Alten", wieder ein wunderbar
feines Genrebild aus dem hollän-
dischen Volksleben brachte, daß
Ludwig Munthe, der Alte unter
den „Jungen", seinen tauenden
Schnee, Gregor von Bochmann
seine Strandscenen, Georg Oeder
seine Herbstfelder mit derselben
Liebe und Sicherheit malte wie
seither? Oder wem sagte man
neues nnt der Mitteilung, daß
unsere Landschafter mit gesundem
Realismus Weiterarbeiten und im
allgemeinen noch immer die See
und das niedere Land den Hoch-
gebirgen und den sogenannten ro-
mantischen Gegenden vorziehen,
und daß unsere Genremaler der
älteren Schule sich selten über
eine harmlose Mittelmäßigkeit er-
heben? Wir widerstehen der Ver-
suchung, die kraftvollen Scestücke
von Carl Becker, den blauen
Ozean von Hans Petersen, die
treue und scharfe Naturauffassung
Eugen Dückers, die poesiereichen
Landschaften Heinrich Har-
tungs, Hugo Mühligs sonni-
ges Erntefeld, von Bernuths
waldige Thalwände oder Adolf
Lins' behaglichen Kuhstall im
Einzelnen zu rühmen, wir begnügen uns mit der kurzen
Erwähnung von H ans Bachmanns einfach empfundenem
„Begräbnis im Gebirge", und wenden uns sogleich zur
Beobachtung der angekündigten Ncophyten.
Merkwürdigerweise sind es ausschließlich Figuren-
maler, während doch sonst die Landschafter den größeren
Prozentsatz unter den Künstlern ausmachen. Figuren-
bilder verlangen, in gewissem Sinne, eine rücksichtsvollere
Ausarbeitung des Gegenstandes als die Landschaften, da
die Sprache von Fels und Meer, von Wolken, Wald
und Gefilden zwar eindringlich und dem Herzen ver-
ständlich, dem Laien aber doch im einzelnen weniger klar
detailliert, weniger mit dem Verstände faßlich erscheint
als die Sprache belebter Wesen in Situationen, über
die wir uns unmittelbarer orientieren können. Der Figuren-
maler sollte sich also immer veranlaßt fühlen, seinem
Werke einen Inhalt zu verleihen, der auch abgesehen
von der künstlerischen Darstellung einen Wert hat oder
dessen Wert seiner künstlerischen Darstellung völlig das
Gleichgewicht hält. Eben diese Rücksicht Pflegt man
neuerdings unbillig aus den Augen zu setzen, und des-
wegen freut es uns um so mehr, feststellen zu dürfen,
daß sich einige Ausnahmen von dieser Regel bei unseren
Jüngsten zeigen. Vielleicht weiß Willy vonBeckerath,
der zum ersten Male mit einem ausgeführten Bilde,
einer „Beweinung Christi" in lebensgroßen Figuren, vor
die Öffentlichkeit tritt, selber nicht, wieviel der geistige
Inhalt seines Werkes dazu beiträgt, gewisse Spuren des
Anfängertums bei ihm vergessen zu machen; vielleicht
will er es sich gar nicht einmal
gefallen lassen, wenn man in ihm
einen Künstler begrüßt, dessen tiefe,
durchaus poetische und lautere Em-
pfindung sich eine Ausdrucksweise
in Farben und Formen geschaffen
hat, die nicht sowohl dem modernen,
nach Problemen haschenden und
daher so oft Virtuosenhaft proble-
matischen Kunstwesen sich anschließt,
als vielmehr, in ihrem Stil, etwa
dem Charakter unserer älteren vor-
nehmen Musiker entspricht. Trotz-
dem bleibt, hoffentlich, das edle
Pathos sein köstlicher Besitz; von
den meisten Künstlern unserer Zeit
nicht aus der Fülle der Eingebung
mitempfunden und daher der Un-
wahrheit, der äußerlichen Pose ver-
dächtigt, wird es, wie alles Echte,
in kurzem doch wieder völlige Gel-
tung erlangen. Inzwischen er-
quicken wir Andern, die wir nicht
in den Strömungen des Tages
und der letzten Jahre zu kämpfen
haben, uns unbeirrt an diesem
großen Wurfe der Phantasie.
Auf einer Bergeshöhe über dem
düsteren, von Nebeln erfüllten
Thale, erhebt sich auf Stufen der
offene Marmorsarg Christi; der
nackte Leichnam, mit den er-
starrten Zügen des Leidens im
zurückgesunkenen Haupte, liegt
lang über ihn hingestreckt. Es ist Abend; eine Frau
— Maria die Mutter oder Maria Magdalena —
hält einsam die Totenwacht und am Sarkophage sitzend
weint sie niedergebeugt in das Leichentuch. Tausendmal
wurde dasselbe gemalt; aber Wiedas uralte Wort „Liebe"
nie aufhört zu überwältigen, so oft es von bebenden
Lippen und aus überquellenden Herzen heraus gesprochen
wird, so ergreift uns aus diesem tiefinnerlich erschauten
Werke von Neuem das keinem fremde Weh einer aufs
Schmerzlichste beraubten Seele und die Majestät des Todes,
die durch Erhabenheit uns vor dem Entsetzen rettet.
Das sind Wirkungen, die dem Laien im Grunde wesent-
licher und teurer sind als die Entzückung an technischen
Reizen und die kein Künstler für schlechthin unkünstlerisch
oder billig halten sollte. Denn nicht nur schließen sie
eine vollkommen künstlerische Darstellung, sowie die An-
erkennung derselben, keineswegs aus, sondern sie werden.
Altes und Neues aus Düsseldorf.
den diesjährigen Märzausstellungen, sieht man manche
Arbeiten, die durch ihre reife Schönheit einen Frieden
zu besiegeln imstande wären. An sie schließen sich
Werke jüngerer Maler an, die ebenfalls die Möglichkeit
beweisen, eine sorgfältige Ausbildung mit künstlerischer
Feinfühligkeit und Delikatesse zu vereinigen.
Diesen jüngeren Malern, von denen ein Teil zum
ersten Male vor die Öffentlichkeit tritt, sei der heutige
Bericht in erster Linie gewidmet. Was brächte es auch
dem Leser unserer Zeitschrift für Vorteile, zu so vielen
Malen noch ein Mal zu erfahren, daß Andreas und
Oswald Achenbach, in unverminderter Fruchtbarkeit
fortschaffend, einige Marinen aus-
gestellt haben, daß Ferdinand
Fagerlin, ein Junger unter den
„Alten", wieder ein wunderbar
feines Genrebild aus dem hollän-
dischen Volksleben brachte, daß
Ludwig Munthe, der Alte unter
den „Jungen", seinen tauenden
Schnee, Gregor von Bochmann
seine Strandscenen, Georg Oeder
seine Herbstfelder mit derselben
Liebe und Sicherheit malte wie
seither? Oder wem sagte man
neues nnt der Mitteilung, daß
unsere Landschafter mit gesundem
Realismus Weiterarbeiten und im
allgemeinen noch immer die See
und das niedere Land den Hoch-
gebirgen und den sogenannten ro-
mantischen Gegenden vorziehen,
und daß unsere Genremaler der
älteren Schule sich selten über
eine harmlose Mittelmäßigkeit er-
heben? Wir widerstehen der Ver-
suchung, die kraftvollen Scestücke
von Carl Becker, den blauen
Ozean von Hans Petersen, die
treue und scharfe Naturauffassung
Eugen Dückers, die poesiereichen
Landschaften Heinrich Har-
tungs, Hugo Mühligs sonni-
ges Erntefeld, von Bernuths
waldige Thalwände oder Adolf
Lins' behaglichen Kuhstall im
Einzelnen zu rühmen, wir begnügen uns mit der kurzen
Erwähnung von H ans Bachmanns einfach empfundenem
„Begräbnis im Gebirge", und wenden uns sogleich zur
Beobachtung der angekündigten Ncophyten.
Merkwürdigerweise sind es ausschließlich Figuren-
maler, während doch sonst die Landschafter den größeren
Prozentsatz unter den Künstlern ausmachen. Figuren-
bilder verlangen, in gewissem Sinne, eine rücksichtsvollere
Ausarbeitung des Gegenstandes als die Landschaften, da
die Sprache von Fels und Meer, von Wolken, Wald
und Gefilden zwar eindringlich und dem Herzen ver-
ständlich, dem Laien aber doch im einzelnen weniger klar
detailliert, weniger mit dem Verstände faßlich erscheint
als die Sprache belebter Wesen in Situationen, über
die wir uns unmittelbarer orientieren können. Der Figuren-
maler sollte sich also immer veranlaßt fühlen, seinem
Werke einen Inhalt zu verleihen, der auch abgesehen
von der künstlerischen Darstellung einen Wert hat oder
dessen Wert seiner künstlerischen Darstellung völlig das
Gleichgewicht hält. Eben diese Rücksicht Pflegt man
neuerdings unbillig aus den Augen zu setzen, und des-
wegen freut es uns um so mehr, feststellen zu dürfen,
daß sich einige Ausnahmen von dieser Regel bei unseren
Jüngsten zeigen. Vielleicht weiß Willy vonBeckerath,
der zum ersten Male mit einem ausgeführten Bilde,
einer „Beweinung Christi" in lebensgroßen Figuren, vor
die Öffentlichkeit tritt, selber nicht, wieviel der geistige
Inhalt seines Werkes dazu beiträgt, gewisse Spuren des
Anfängertums bei ihm vergessen zu machen; vielleicht
will er es sich gar nicht einmal
gefallen lassen, wenn man in ihm
einen Künstler begrüßt, dessen tiefe,
durchaus poetische und lautere Em-
pfindung sich eine Ausdrucksweise
in Farben und Formen geschaffen
hat, die nicht sowohl dem modernen,
nach Problemen haschenden und
daher so oft Virtuosenhaft proble-
matischen Kunstwesen sich anschließt,
als vielmehr, in ihrem Stil, etwa
dem Charakter unserer älteren vor-
nehmen Musiker entspricht. Trotz-
dem bleibt, hoffentlich, das edle
Pathos sein köstlicher Besitz; von
den meisten Künstlern unserer Zeit
nicht aus der Fülle der Eingebung
mitempfunden und daher der Un-
wahrheit, der äußerlichen Pose ver-
dächtigt, wird es, wie alles Echte,
in kurzem doch wieder völlige Gel-
tung erlangen. Inzwischen er-
quicken wir Andern, die wir nicht
in den Strömungen des Tages
und der letzten Jahre zu kämpfen
haben, uns unbeirrt an diesem
großen Wurfe der Phantasie.
Auf einer Bergeshöhe über dem
düsteren, von Nebeln erfüllten
Thale, erhebt sich auf Stufen der
offene Marmorsarg Christi; der
nackte Leichnam, mit den er-
starrten Zügen des Leidens im
zurückgesunkenen Haupte, liegt
lang über ihn hingestreckt. Es ist Abend; eine Frau
— Maria die Mutter oder Maria Magdalena —
hält einsam die Totenwacht und am Sarkophage sitzend
weint sie niedergebeugt in das Leichentuch. Tausendmal
wurde dasselbe gemalt; aber Wiedas uralte Wort „Liebe"
nie aufhört zu überwältigen, so oft es von bebenden
Lippen und aus überquellenden Herzen heraus gesprochen
wird, so ergreift uns aus diesem tiefinnerlich erschauten
Werke von Neuem das keinem fremde Weh einer aufs
Schmerzlichste beraubten Seele und die Majestät des Todes,
die durch Erhabenheit uns vor dem Entsetzen rettet.
Das sind Wirkungen, die dem Laien im Grunde wesent-
licher und teurer sind als die Entzückung an technischen
Reizen und die kein Künstler für schlechthin unkünstlerisch
oder billig halten sollte. Denn nicht nur schließen sie
eine vollkommen künstlerische Darstellung, sowie die An-
erkennung derselben, keineswegs aus, sondern sie werden.