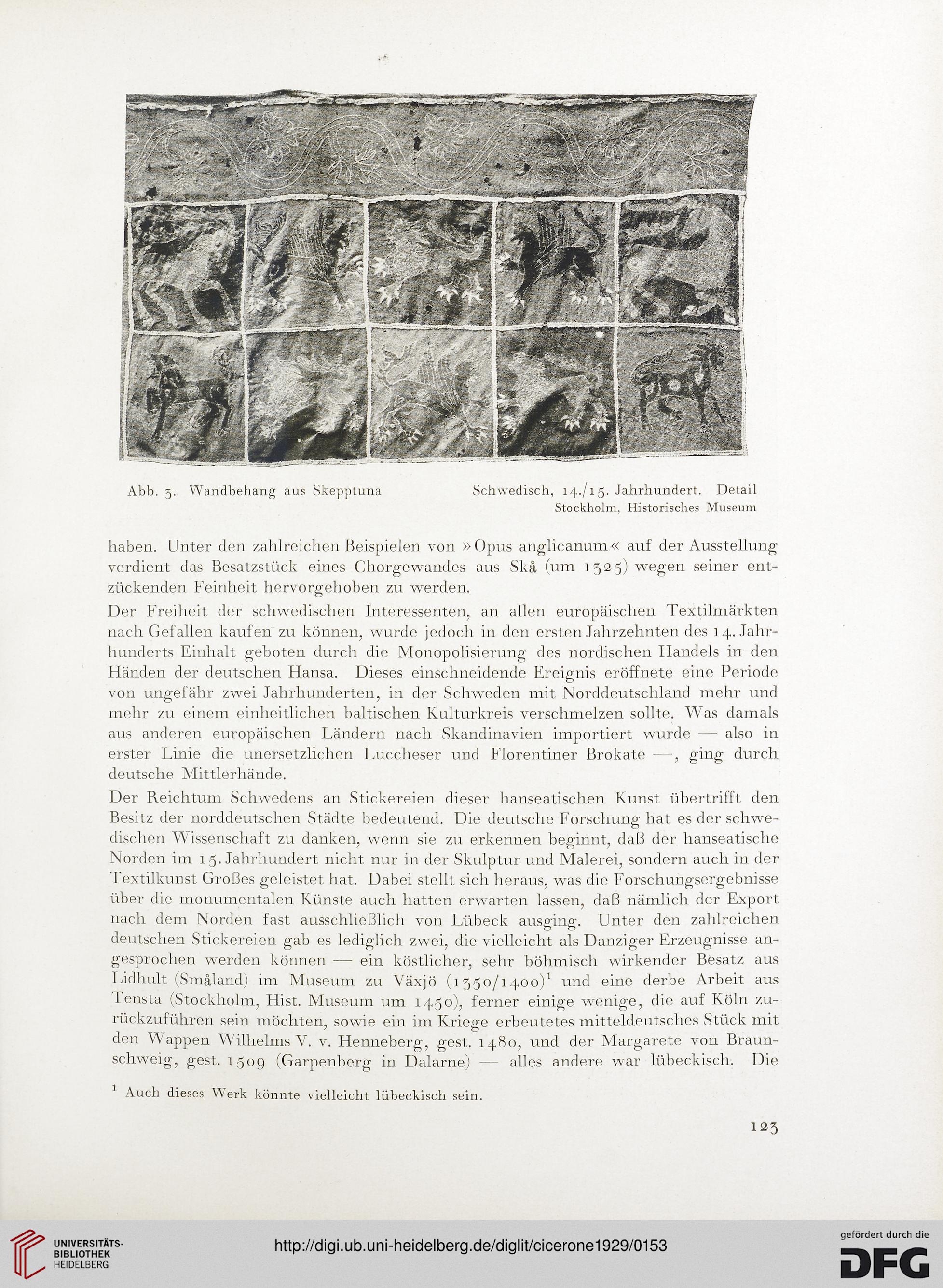Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 21.1929
Cite this page
Please cite this page by using the following URL/DOI:
https://doi.org/10.11588/diglit.41323#0153
DOI issue:
Heft 5
DOI article:Paatz, Walter: Ausstellung kirchlicher Textilkunst in Stockholm
DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.41323#0153
Abb. 3. Wandbehang aus Skepptuna Schwedisch, 14./15. Jahrhundert. Detail
Stockholm, Historisches Museum
haben. Unter den zahlreichen Beispielen von »Opus angli canum« auf der Ausstellung-
verdient das Besatzstück eines Chorgewandes aus Ska (um 1525) wegen seiner ent-
zückenden Feinheit hervorgehoben zu werden.
Der Freiheit der schwedischen Interessenten, an allen europäischen Textilmärkten
nach Gefallen kaufen zu können, wurde jedoch in den ersten Jahrzehnten des 14. Jahr-
hunderts Einhalt geboten durch die Monopolisierung des nordischen Handels in den
Händen der deutschen Hansa. Dieses einschneidende Ereignis eröffnete eine Periode
von ungefähr zwei Jahrhunderten, in der Schweden mit Norddeutschland mehr und
mehr zu einem einheitlichen baltischen Kulturkreis verschmelzen sollte. Was damals
aus anderen europäischen Ländern nach Skandinavien importiert wurde —- also in
erster Linie die unersetzlichen Luccheser und Florentiner Brokate —, ging durch
deutsche Mittlerhände.
Der Reichtum Schwedens an Stickereien dieser hanseatischen Kunst übertrifft den
Besitz der norddeutschen Städte bedeutend. Die deutsche Forschung hat es der schwe-
dischen Wissenschaft zu danken, wenn sie zu erkennen beginnt, daß der hanseatische
Norden im 15. Jahrhundert nicht nur in der Skulptur und Malerei, sondern auch in der
I extilkunst Großes geleistet hat. Dabei stellt sich heraus, was die Forschungsergebnisse
über die monumentalen Künste auch hatten erwarten lassen, daß nämlich der Export
nach dem Norden fast ausschließlich von Lübeck ausging. Unter den zahlreichen
deutschen Stickereien gab es lediglich zwei, die vielleicht als Danziger Erzeugnisse an-
gesprochen werden können — ein köstlicher, sehr böhmisch wirkender Besatz aus
Lidhult (Smäland) im Museum zu Växjö (1350/1400)1 und eine derbe Arbeit aus
I ensta (Stockholm, Hist. Museum um 1450), ferner einige wenige, die auf Köln zu-
rückzuführen sein möchten, sowie ein im Kriege erbeutetes mitteldeutsches Stück mit
den Wappen Wilhelms V. v. Henneberg, gest. 1480, und der Margarete von Braun-
schweig, gest. 1509 (Garpenberg in Dalarne) — alles andere war lübeckisch. Die
Auch dieses Werk könnte vielleicht lübeckisch sein.
123