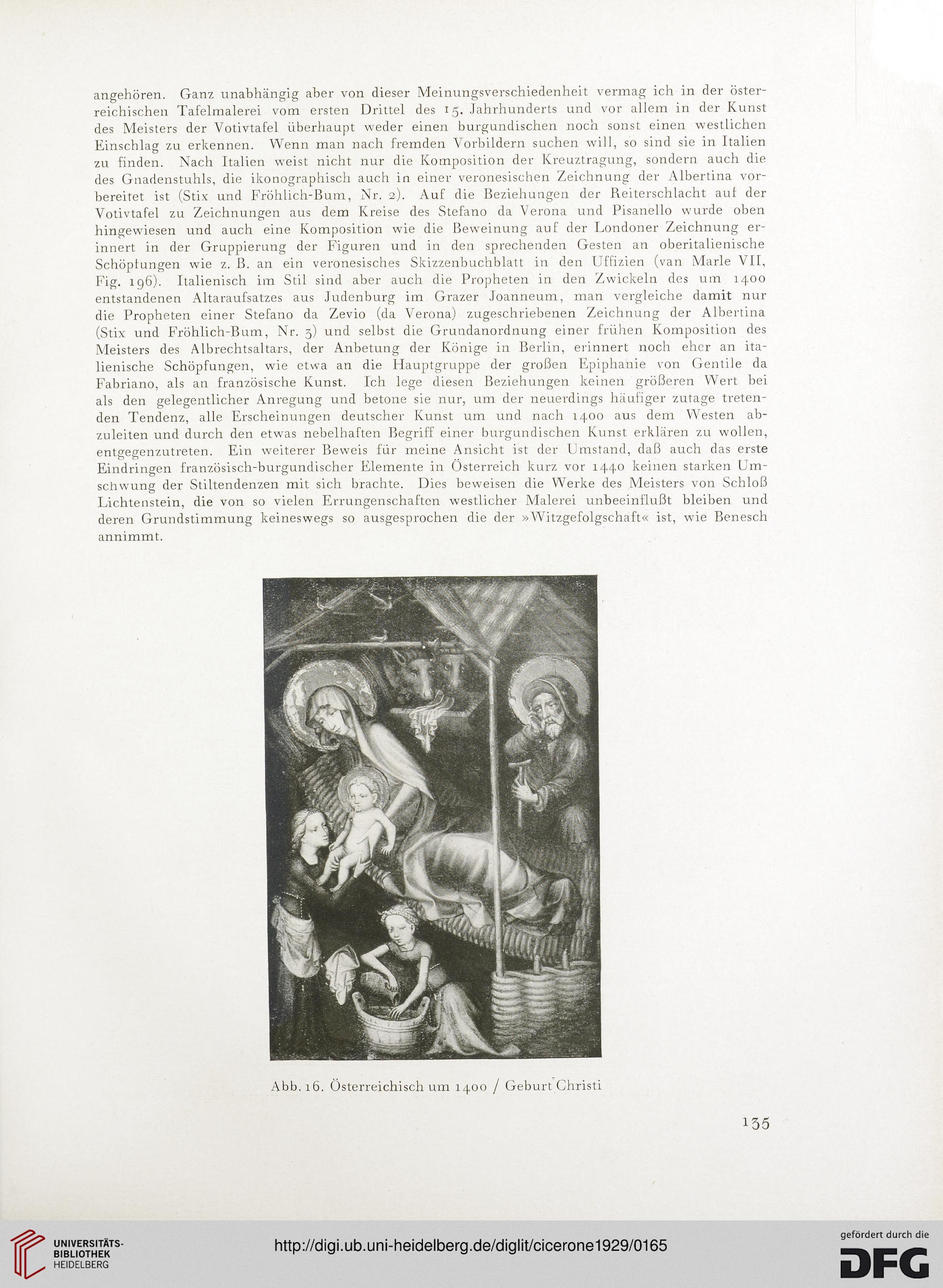Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 21.1929
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.41323#0165
DOI Heft:
Heft 5
DOI Artikel:Baldass, Ludwig: Die Wiener Tafelmalerei von 1410-1460, 2: (Neuerwerbungen des Wiener kunsthistorischen Museums)
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.41323#0165
angehören. Ganz unabhängig aber von dieser Meinungsverschiedenheit vermag ich in der öster-
reichischen Tafelmalerei vom ersten Drittel des 15. Jahrhunderts und vor allem in der Kunst
des Meisters der Votivtafel überhaupt weder einen burgundischen noch sonst einen westlichen
Einschlag zu erkennen. Wenn man nach fremden Vorbildern suchen will, so sind sie in Italien
zu finden. Nach Italien weist nicht nur die Komposition der Kreuztragung, sondern auch die
des Gnadenstuhls, die ikonographisch auch in einer veronesischen Zeichnung der Albertina vor-
bereitet ist (Stix und Fröhlich-Bum, Nr. 2). Auf die Beziehungen der Reiterschlacht auf der
Votivtafel zu Zeichnungen aus dem Kreise des Stefano da Verona und Pisanello wurde oben
hingewiesen und auch eine Komposition wie die Beweinung auf der Londoner Zeichnung er-
innert in der Gruppierung der Figuren und in den sprechenden Gesten an oberitalienische
Schöpfungen wie z. ß. an ein veronesisches Skizzenbuchblatt in den Uffizien (van Marie VII,
Fig. 196). Italienisch im Stil sind aber auch die Propheten in den Zwickeln des um 1400
entstandenen Altaraufsatzes aus Judenburg im Grazer Joanneum, man vergleiche damit nur
die Propheten einer Stefano da Zevio (da Verona) zugeschriebenen Zeichnung der Albertina
(Stix und Fröhlich-Bum, Nr. 3) und selbst die Grundanordnung einer frühen Komposition des
Meisters des Albrechtsaltars, der Anbetung der Könige in Berlin, erinnert noch eher an ita-
lienische Schöpfungen, wie etwa an die Hauptgruppe der großen Epiphanie von Gentile da
Fabriano, als an französische Kunst. Ich lege diesen Beziehungen keinen größeren Wert bei
als den gelegentlicher Anregung und betone sie nur, um der neuerdings häufiger zutage treten-
den Tendenz, alle Erscheinungen deutscher Kunst um und nach 1400 aus dem Westen ab-
zuleiten und durch den etwas nebelhaften Begriff einer burgundischen Kunst erklären zu wollen,
entgegenzutreten. Ein weiterer Beweis für meine Ansicht ist der Umstand, daß auch das erste
Eindringen französisch-burgundischer Elemente in Österreich kurz vor 1440 keinen starken Um-
schwung der Stiltendenzen mit sich brachte. Dies beweisen die Werke des Meisters von Schloß
Lichtenstein, die von so vielen Errungenschaften westlicher Malerei unbeeinflußt bleiben und
deren Grundstimmung keineswegs so ausgespi'ochen die der »Witzgefolgschaft« ist, wie Benesch
annimmt.
Abb. 16. Österreichisch um 1400 / Geburt Christi
155
reichischen Tafelmalerei vom ersten Drittel des 15. Jahrhunderts und vor allem in der Kunst
des Meisters der Votivtafel überhaupt weder einen burgundischen noch sonst einen westlichen
Einschlag zu erkennen. Wenn man nach fremden Vorbildern suchen will, so sind sie in Italien
zu finden. Nach Italien weist nicht nur die Komposition der Kreuztragung, sondern auch die
des Gnadenstuhls, die ikonographisch auch in einer veronesischen Zeichnung der Albertina vor-
bereitet ist (Stix und Fröhlich-Bum, Nr. 2). Auf die Beziehungen der Reiterschlacht auf der
Votivtafel zu Zeichnungen aus dem Kreise des Stefano da Verona und Pisanello wurde oben
hingewiesen und auch eine Komposition wie die Beweinung auf der Londoner Zeichnung er-
innert in der Gruppierung der Figuren und in den sprechenden Gesten an oberitalienische
Schöpfungen wie z. ß. an ein veronesisches Skizzenbuchblatt in den Uffizien (van Marie VII,
Fig. 196). Italienisch im Stil sind aber auch die Propheten in den Zwickeln des um 1400
entstandenen Altaraufsatzes aus Judenburg im Grazer Joanneum, man vergleiche damit nur
die Propheten einer Stefano da Zevio (da Verona) zugeschriebenen Zeichnung der Albertina
(Stix und Fröhlich-Bum, Nr. 3) und selbst die Grundanordnung einer frühen Komposition des
Meisters des Albrechtsaltars, der Anbetung der Könige in Berlin, erinnert noch eher an ita-
lienische Schöpfungen, wie etwa an die Hauptgruppe der großen Epiphanie von Gentile da
Fabriano, als an französische Kunst. Ich lege diesen Beziehungen keinen größeren Wert bei
als den gelegentlicher Anregung und betone sie nur, um der neuerdings häufiger zutage treten-
den Tendenz, alle Erscheinungen deutscher Kunst um und nach 1400 aus dem Westen ab-
zuleiten und durch den etwas nebelhaften Begriff einer burgundischen Kunst erklären zu wollen,
entgegenzutreten. Ein weiterer Beweis für meine Ansicht ist der Umstand, daß auch das erste
Eindringen französisch-burgundischer Elemente in Österreich kurz vor 1440 keinen starken Um-
schwung der Stiltendenzen mit sich brachte. Dies beweisen die Werke des Meisters von Schloß
Lichtenstein, die von so vielen Errungenschaften westlicher Malerei unbeeinflußt bleiben und
deren Grundstimmung keineswegs so ausgespi'ochen die der »Witzgefolgschaft« ist, wie Benesch
annimmt.
Abb. 16. Österreichisch um 1400 / Geburt Christi
155