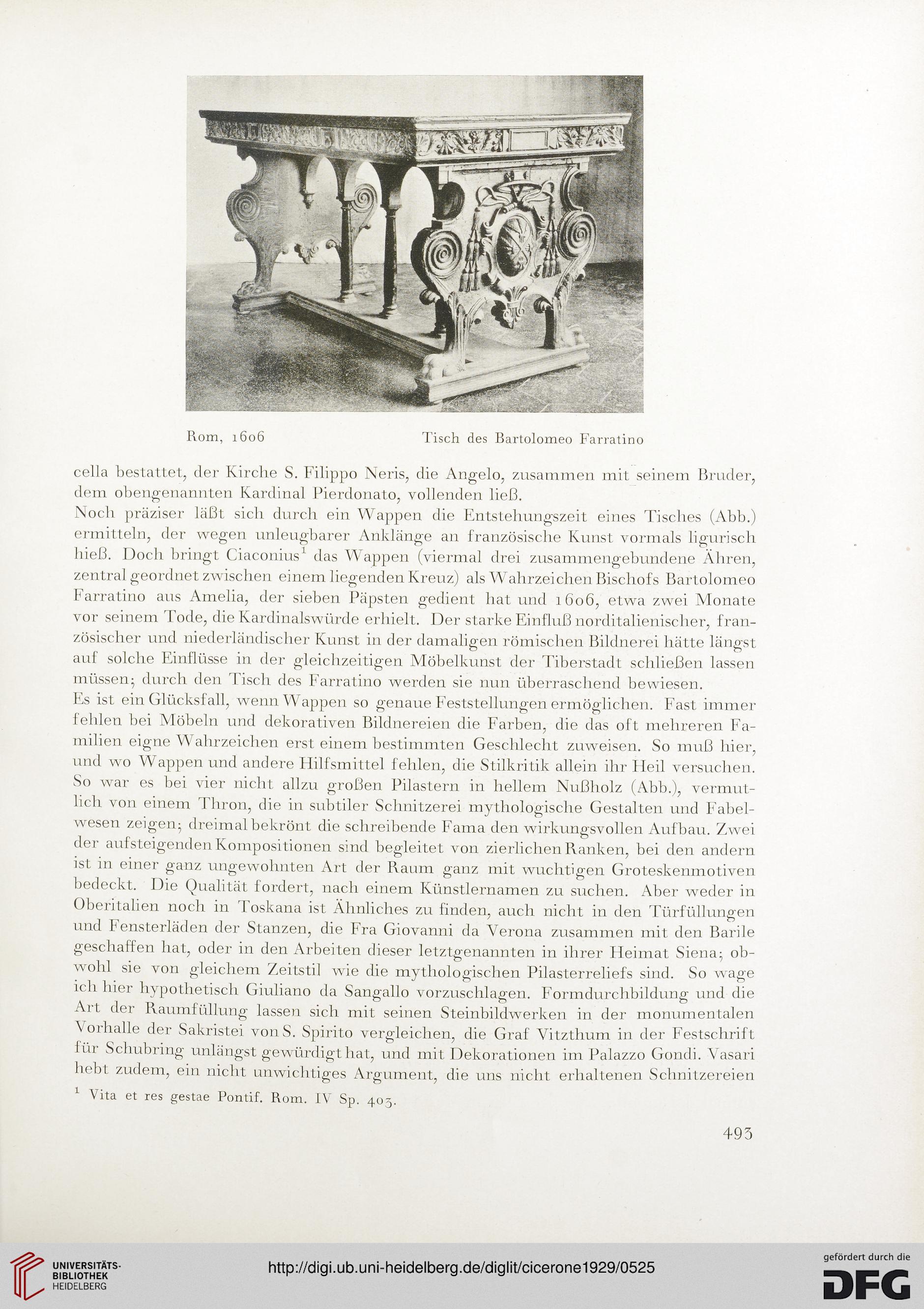Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 21.1929
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.41323#0525
DOI Heft:
Heft 17
DOI Artikel:Schottmüller, Frida: Bildwerke und Ausstattungsstücke der Sammlung Eduard Simon
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.41323#0525
Rom, 1606 Tisch des Bartolomeo Farratino
cella bestattet, der Kirche S. Filippo Neris, die Angelo, zusammen mit seinem Bruder,
dem obengenannten Kardinal Pierdonato, vollenden ließ.
Noch präziser läßt sich durch ein Wappen die Entstehungszeit eines Tisches (Abb.)
ermitteln, der wegen unleugbarer Anklänge an französische Kunst vormals ligurisch
hieß. Doch bringt Ciaconius1 das Wappen (viermal drei zusammengebundene Ähren,
zentral geordnet zwischen einem liegenden Kreuz) als Walirzeichen Bischofs Bartolomeo
Farratino aus Amelia, der sieben Päpsten gedient hat und 1606, etwa zwei Monate
vor seinem Tode, die Kardinalswürde erhielt. Der starke Einfluß norditalienischer, fran-
zösischer und niederländischer Kunst in der damaligen römischen Bildnerei hätte längst
auf solche Einflüsse in der gleichzeitigen Möbelkunst der Tiberstadt schließen lassen
müssen- durch den Tisch des Farratino werden sie nun überraschend bewiesen.
Es ist ein Glücksfall, wenn Wappen so genaue Feststellungen ermöglichen. Fast immer
fehlen bei Möbeln und dekorativen Bildnereien die Farben, die das oft mehreren Fa-
milien eigne Wahrzeichen erst einem bestimmten Geschlecht zuweisen. So muß hier,
und wo Wappen und andere Hilfsmittel fehlen, che Stilkritik allein ihr Heil versuchen.
So war es bei vier nicht allzu großen Pilastern in hellem Nußholz (Abb.), vermut-
lich von einem Thron, die in subtiler Schnitzerei mythologische Gestalten und Fabel-
wesen zeigen- dreimal bekrönt die schreibende Fama den wirkungsvollen Aufbau. Zwei
der aufsteigenden Kompositionen sind begleitet von zierlichen Ranken, bei den andern
ist in einer ganz ungewohnten Art der Raum ganz mit wuchtigen Groteskenmotiven
bedeckt. Die Qualität fordert, nach einem Künstlernamen zu suchen. Aber weder in
Oberitalien noch in Toskana ist Ähnliches zu finden, auch nicht in den Türfüllungen
und Fensterläden der Stanzen, die Fra Giovanni da Verona zusammen mit den Barde
geschaffen hat, oder in den Arbeiten dieser letztgenannten in ihrer Heimat Siena $ ob-
wohl sie von gleichem Zeitstd wie die mythologischen Pilasterreliefs sind. So wrage
ich hier hypothetisch Giuliano da Sangallo vorzuschlagen. Formdurchbildung und die
Art der Raumfüllung lassen sich mit seinen Steinbildwerken in der monumentalen
Vorhalle der Sakristei vonS. Spirito vergleichen, die Graf Vitzthum in der Festschrift
für Schubring unlängst gewürdigt hat, und mit Dekorationen im Palazzo Gondi. V asari
hebt zudem, ein nicht unwichtiges Argument, die uns nicht erhaltenen Schnitzereien
1 Vita et res gestae Pontif. Rom. IV Sp. 403.
493