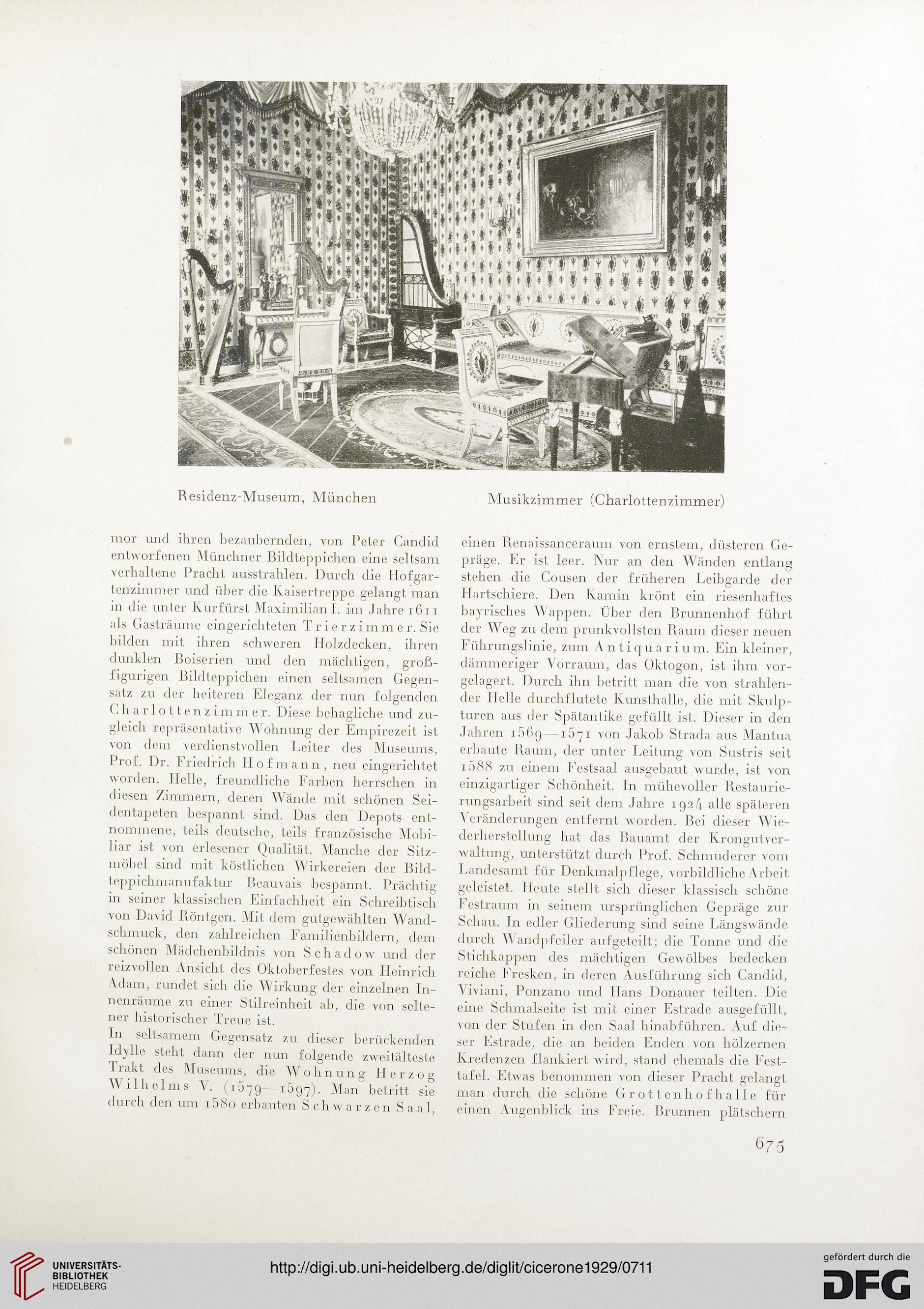Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 21.1929
Cite this page
Please cite this page by using the following URL/DOI:
https://doi.org/10.11588/diglit.41323#0711
DOI issue:
Heft 23
DOI article:Wilm, Hubert: Die neuen Räume im Münchner Residenz-Museum
DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.41323#0711
Residenz-Museum, München
Musikzimmer (Charlottenzimmer)
mor und ihren bezaubernden, von Peter Candid
entworfenen Münchner Bildteppichen eine seltsam
verhaltene Pracht ausstrahlen. Durch die Ilofgar-
tenzimmer und über die Kaisertreppe gelangt man
in die unter Kurfürst Maximilian I. im Jahre 1611
als Gasträume eingerichteten Trierzimmer. Sie
bilden mit ihren schweren Holzdecken, ihren
dunklen Boiserien und den mächtigen, groß-
figurigen Bildteppichen einen seltsamen Gegen-
satz zu der heiteren Eleganz der nun folgenden
Charlottenzim m e r. Diese behagliche und zu-
gleich repräsentative Wohnung der Empirezeit ist
von dem verdienstvollen Leiter des Museums,
Prof. Dr. Friedrich Ilofmann, neu eingerichtet
worden. Helle, freundliche Farben herrschen in
diesen Zimmern, deren Wände mit schönen Sei-
dentapeten bespannt sind. Das den Depots ent-
nommene, teils deutsche, teils französische Mobi-
liar ist von erlesener Qualität. Manche der Sitz-
möbel sind mit köstlichen Wirkereien der Bild-
teppiclnnanufaktur Beauvais bespannt. Prächtig
in seiner klassischen Einfachheit ein Schreibtisch
von David Röntgen. Mit dem gutgewählten Wand-
schmuck, den zahlreichen Eamilienbildern, dem
schönen Mädchenbildnis von Schadow und der
reizvollen Ansicht des Oktoberfestes von Heinrich
Adam, rundet sich die Wirkung der einzelnen In-
nenräume zu einer Stilreinheit ab, die von selte-
ner historischer Treue ist.
ln seltsamem Gegensatz zu dieser berückenden
Idylle steht dann der nun folgende Zweitälteste
lrakt des Museums, die Wohnung Herzog
Wilhelms Y. (1679—1597). Man betritt sie
durch den um 1580 erbauten Schwarzen Saal,
einen Renaissanceraum von ernstem, düsteren Ge-
präge. Er ist leer. Nur an den Wänden entlang
stehen die Cousen der früheren Leibgarde der
Hartschiere. Den Kamin krönt ein riesenhaftes
bayrisches Wappen. Über den Brunnenhof führt
der Weg zu dem prunkvollsten Raum dieser neuen
Führungslinie, zum Antiquarium. Ein kleiner,
dämmeriger Vorraum, das Oktogon, ist ihm vor-
gelagert. Durch ihn betritt man die von strahlen-
der Helle durchflutete Kunsthalle, die mit Skulp-
turen aus der Spätantike gefüllt ist. Dieser in den
Jahren 1669—1571 von Jakob Strada aus Mantua
erbaute Raum, der unter Leitung von Sustris seit
i588 zu einem Festsaal ausgebaut wurde, ist von
einzigartiger Schönheit. In mühevoller Restaurie-
rungsarbeit sind seit dem Jahre 1924 alle späteren
Veränderungen entfernt worden. Bei dieser Wie-
derherstellung hat das Bauamt der Krongutver-
waltung, unterstützt durch Prof. Schmuderer vom
Landesamt für Denkmalpflege, vorbildliche Arbeit
geleistet. Heute stellt sich dieser klassisch schöne
Festraum in seinem ursprünglichen Gepräge zur
Schau. In edler Gliederung sind seine Längswände
durch Wandpfeiler auf geteilt; die Tonne und die
Stichkappen des mächtigen Gewölbes bedecken
reiche Fresken, in deren Ausführung sich Candid,
Viviani, Ponzano und Hans Donauer teilten. Die
eine Schmalseite ist mit einer Estrade ausgefüllt,
von der Stufen in den Saal hinabführen. Auf die-
ser Estrade, die an beiden Enden von hölzernen
Kredenzen flankiert wird, stand ehemals die Fest-
tafel. Etwas benommen von dieser Pracht gelangt
man durch die schöne Grottenhofhalle für
einen Augenblick ins Freie. Brunnen plätschern
675