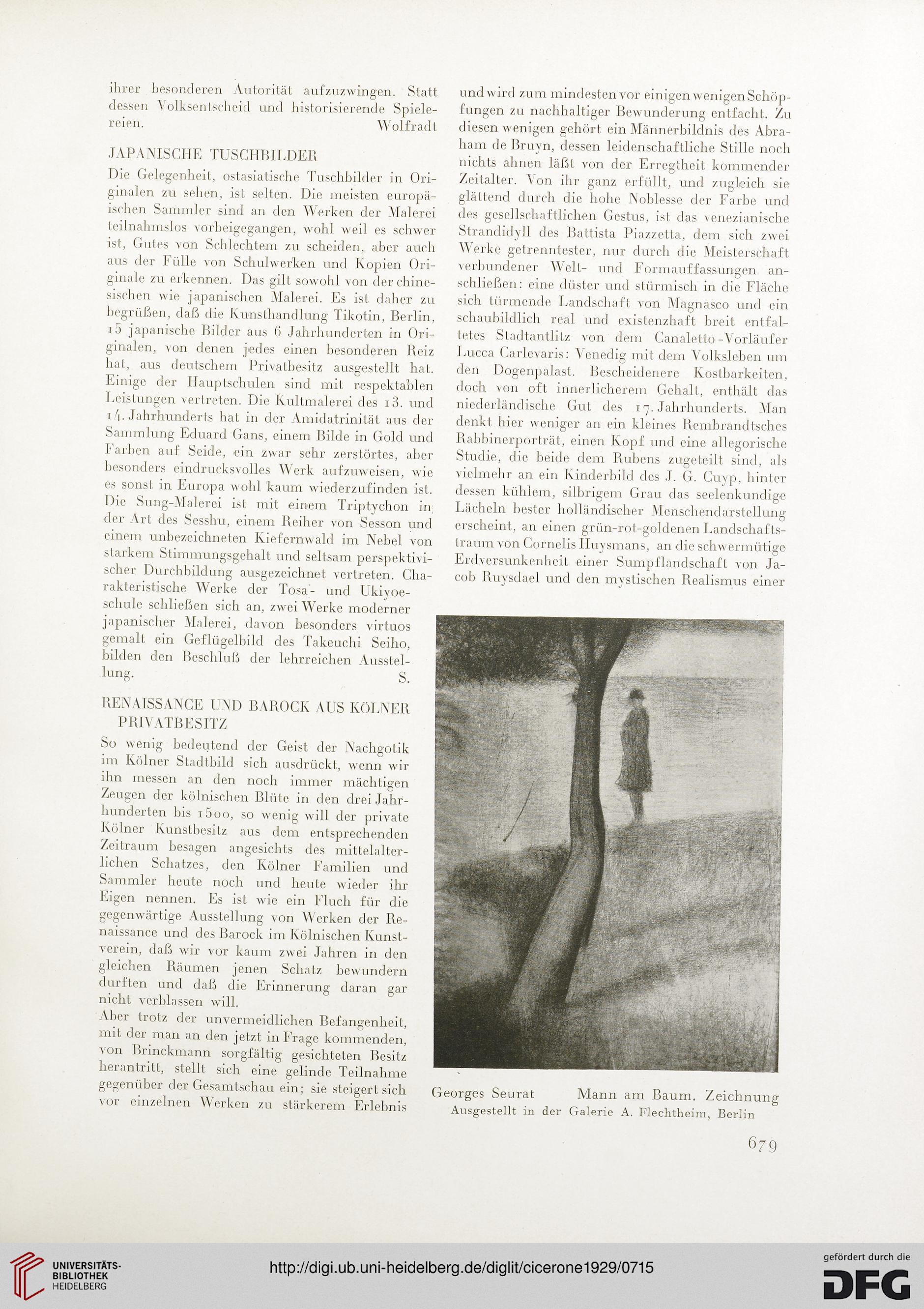ihrer besonderen Autorität aufzuzwingen. Statt
dessen Volksentscheid und historisierende Spiele-
reien. Wolfradt
JAPANISCHE TUSCHBILDER
Die Gelegenheit, ostasiatische Tuschbilder in Ori-
ginalen zu sehen, ist selten. Die meisten europä-
ischen Sammler sind an den Werken der Malerei
teilnahmslos vorbeigegangen, wohl weil es schwer
ist, Gutes von Schlechtem zu scheiden, aber auch
aus der Fülle von Schulwerken und Kopien Ori-
ginale zu erkennen. Das gilt sowohl von der chine-
sischen wie japanischen Malerei. Es ist daher zu
begrüßen, daß die Kunsthandlung Tikotin, Berlin,
i5 japanische Bilder aus 6 Jahrhunderten in Ori-
ginalen, von denen jedes einen besonderen Reiz
hat, aus deutschem Privatbesitz ausgestellt hat.
Einige der Hauptschulen sind mit respektablen
Leistungen vertreten. Die Kultmalerei des i3. und
14. Jahrhunderts hat in der Amidatrinität aus der
Sammlung Eduard Gans, einem Bilde in Gold und
Farben auf Seide, ein zwar sehr zerstörtes, aber
besonders eindrucksvolles Werk aufzuweisen, wie
es sonst in Europa wohl kaum wiederzufinden ist.
Die Sung-Malerei ist mit einem Triptychon in
der Art des Sesshu, einem Reiher von Sesson und
einem unbezeichneten Kiefernwald im Nebel von
starkem Stimmungsgehalt und seltsam perspektivi-
scher Durchbildung ausgezeichnet vertreten. Cha-
rakteristische Werke der Tosa- und Ukiyoe-
schule schließen sich an, zwei Werke moderner
japanischer Malerei, davon besonders virtuos
gemalt ein Geflügelbild des Takeuchi Seiho,
bilden den Beschluß der lehrreichen Ausstel-
lung. S.
RENAISSANCE UND BAROCK AUS KÖLNER
PRIVATBESITZ
So wenig bedeutend der Geist der Nachgotik
im Kölner Stadtbild sich ausdrückt, wenn wir
ihn messen an den noch immer mächtigen
Zeugen der kölnischen Blüte in den drei Jahr-
hunderten bis iöoo, so wenig will der private
Kölner Kunstbesitz aus dem entsprechenden
Zeitraum besagen angesichts des mittelalter-
lichen Schatzes, den Kölner Familien und
Sammler heute noch und heute wieder ihr
Eigen nennen. Es ist wie ein Fluch für die
gegenwärtige Ausstellung von Werken der Re-
naissance und des Barock im Kölnischen Kunst-
verein, daß wir vor kaum zwei Jahren in den
gleichen Räumen jenen Schatz bewundern
durften und daß die Erinnerung daran gar
nicht verblassen will.
Aber trotz der unvermeidlichen Befangenheit,
mit der man an den jetzt in Frage kommenden,
von Brinckmann sorgfältig gesichteten Besitz
herantritt, stellt sich eine gelinde Teilnahme
gegenüber der Gesamtschau ein; sie steigert sich
vor einzelnen Werken zu stärkerem Erlebnis
und wird zum mindesten vor einigen wenigen Schöp-
fungen zu nachhaltiger Bewunderung entfacht. Zu
diesen wenigen gehört ein Männerbildnis des Abra-
ham de Bruyn, dessen leidenschaftliche Stille noch
nichts ahnen läßt von der Erregtheit kommender
Zeitalter. Aon ihr ganz erfüllt, und zugleich sie
glättend durch die hohe Noblesse der Farbe und
des gesellschaf tlichen Gestus, ist das venezianische
Strandidyll des Battista Piazzetta, dem sich zwei
Werke getrenntester, nur durch die Meisterschaft
verbundener Welt- und Formauffassungen an-
schließen: eine düster und stürmisch in die Fläche
sich türmende Landschaft von Magnasco und ein
schaubildlich real und existenzhaft breit entfal-
tetes Stadtantlitz von dem Canaletto -Vorläufer
Lucca Carlevaris: Venedig mit dem Volksleben um
den Dogenpalast. Bescheidenere Kostbarkeiten,
doch von oft innerlicherem Gehalt, enthält das
niederländische Gut des 17. Jahrhunderts. Man
denkt hier weniger an ein kleines Rembrandtsches
Rabbinerporträt, einen Kopf und eine allegorische
Studie, die beide dem Pvubens zugeteilt sind, als
vielmehr an ein Kinderbild des J. G. Cuyp, hinter
dessen kühlem, silbrigem Grau das seelenkundige
Lächeln bester holländischer Menschendarstellung
erscheint, an einen grün-rot-goldenen Landschafts-
traum von Cornelis IJuysmans, an die schwermütige
Erdversunkenheit einer Sumpflandschaft von Ja-
cob Ruysdael und den mystischen Realismus einer
Georges Seurat Mann am Baum. Zeichnung
Ausgestellt in der Galerie A. Flechtheim, Berlin
Ö79
dessen Volksentscheid und historisierende Spiele-
reien. Wolfradt
JAPANISCHE TUSCHBILDER
Die Gelegenheit, ostasiatische Tuschbilder in Ori-
ginalen zu sehen, ist selten. Die meisten europä-
ischen Sammler sind an den Werken der Malerei
teilnahmslos vorbeigegangen, wohl weil es schwer
ist, Gutes von Schlechtem zu scheiden, aber auch
aus der Fülle von Schulwerken und Kopien Ori-
ginale zu erkennen. Das gilt sowohl von der chine-
sischen wie japanischen Malerei. Es ist daher zu
begrüßen, daß die Kunsthandlung Tikotin, Berlin,
i5 japanische Bilder aus 6 Jahrhunderten in Ori-
ginalen, von denen jedes einen besonderen Reiz
hat, aus deutschem Privatbesitz ausgestellt hat.
Einige der Hauptschulen sind mit respektablen
Leistungen vertreten. Die Kultmalerei des i3. und
14. Jahrhunderts hat in der Amidatrinität aus der
Sammlung Eduard Gans, einem Bilde in Gold und
Farben auf Seide, ein zwar sehr zerstörtes, aber
besonders eindrucksvolles Werk aufzuweisen, wie
es sonst in Europa wohl kaum wiederzufinden ist.
Die Sung-Malerei ist mit einem Triptychon in
der Art des Sesshu, einem Reiher von Sesson und
einem unbezeichneten Kiefernwald im Nebel von
starkem Stimmungsgehalt und seltsam perspektivi-
scher Durchbildung ausgezeichnet vertreten. Cha-
rakteristische Werke der Tosa- und Ukiyoe-
schule schließen sich an, zwei Werke moderner
japanischer Malerei, davon besonders virtuos
gemalt ein Geflügelbild des Takeuchi Seiho,
bilden den Beschluß der lehrreichen Ausstel-
lung. S.
RENAISSANCE UND BAROCK AUS KÖLNER
PRIVATBESITZ
So wenig bedeutend der Geist der Nachgotik
im Kölner Stadtbild sich ausdrückt, wenn wir
ihn messen an den noch immer mächtigen
Zeugen der kölnischen Blüte in den drei Jahr-
hunderten bis iöoo, so wenig will der private
Kölner Kunstbesitz aus dem entsprechenden
Zeitraum besagen angesichts des mittelalter-
lichen Schatzes, den Kölner Familien und
Sammler heute noch und heute wieder ihr
Eigen nennen. Es ist wie ein Fluch für die
gegenwärtige Ausstellung von Werken der Re-
naissance und des Barock im Kölnischen Kunst-
verein, daß wir vor kaum zwei Jahren in den
gleichen Räumen jenen Schatz bewundern
durften und daß die Erinnerung daran gar
nicht verblassen will.
Aber trotz der unvermeidlichen Befangenheit,
mit der man an den jetzt in Frage kommenden,
von Brinckmann sorgfältig gesichteten Besitz
herantritt, stellt sich eine gelinde Teilnahme
gegenüber der Gesamtschau ein; sie steigert sich
vor einzelnen Werken zu stärkerem Erlebnis
und wird zum mindesten vor einigen wenigen Schöp-
fungen zu nachhaltiger Bewunderung entfacht. Zu
diesen wenigen gehört ein Männerbildnis des Abra-
ham de Bruyn, dessen leidenschaftliche Stille noch
nichts ahnen läßt von der Erregtheit kommender
Zeitalter. Aon ihr ganz erfüllt, und zugleich sie
glättend durch die hohe Noblesse der Farbe und
des gesellschaf tlichen Gestus, ist das venezianische
Strandidyll des Battista Piazzetta, dem sich zwei
Werke getrenntester, nur durch die Meisterschaft
verbundener Welt- und Formauffassungen an-
schließen: eine düster und stürmisch in die Fläche
sich türmende Landschaft von Magnasco und ein
schaubildlich real und existenzhaft breit entfal-
tetes Stadtantlitz von dem Canaletto -Vorläufer
Lucca Carlevaris: Venedig mit dem Volksleben um
den Dogenpalast. Bescheidenere Kostbarkeiten,
doch von oft innerlicherem Gehalt, enthält das
niederländische Gut des 17. Jahrhunderts. Man
denkt hier weniger an ein kleines Rembrandtsches
Rabbinerporträt, einen Kopf und eine allegorische
Studie, die beide dem Pvubens zugeteilt sind, als
vielmehr an ein Kinderbild des J. G. Cuyp, hinter
dessen kühlem, silbrigem Grau das seelenkundige
Lächeln bester holländischer Menschendarstellung
erscheint, an einen grün-rot-goldenen Landschafts-
traum von Cornelis IJuysmans, an die schwermütige
Erdversunkenheit einer Sumpflandschaft von Ja-
cob Ruysdael und den mystischen Realismus einer
Georges Seurat Mann am Baum. Zeichnung
Ausgestellt in der Galerie A. Flechtheim, Berlin
Ö79