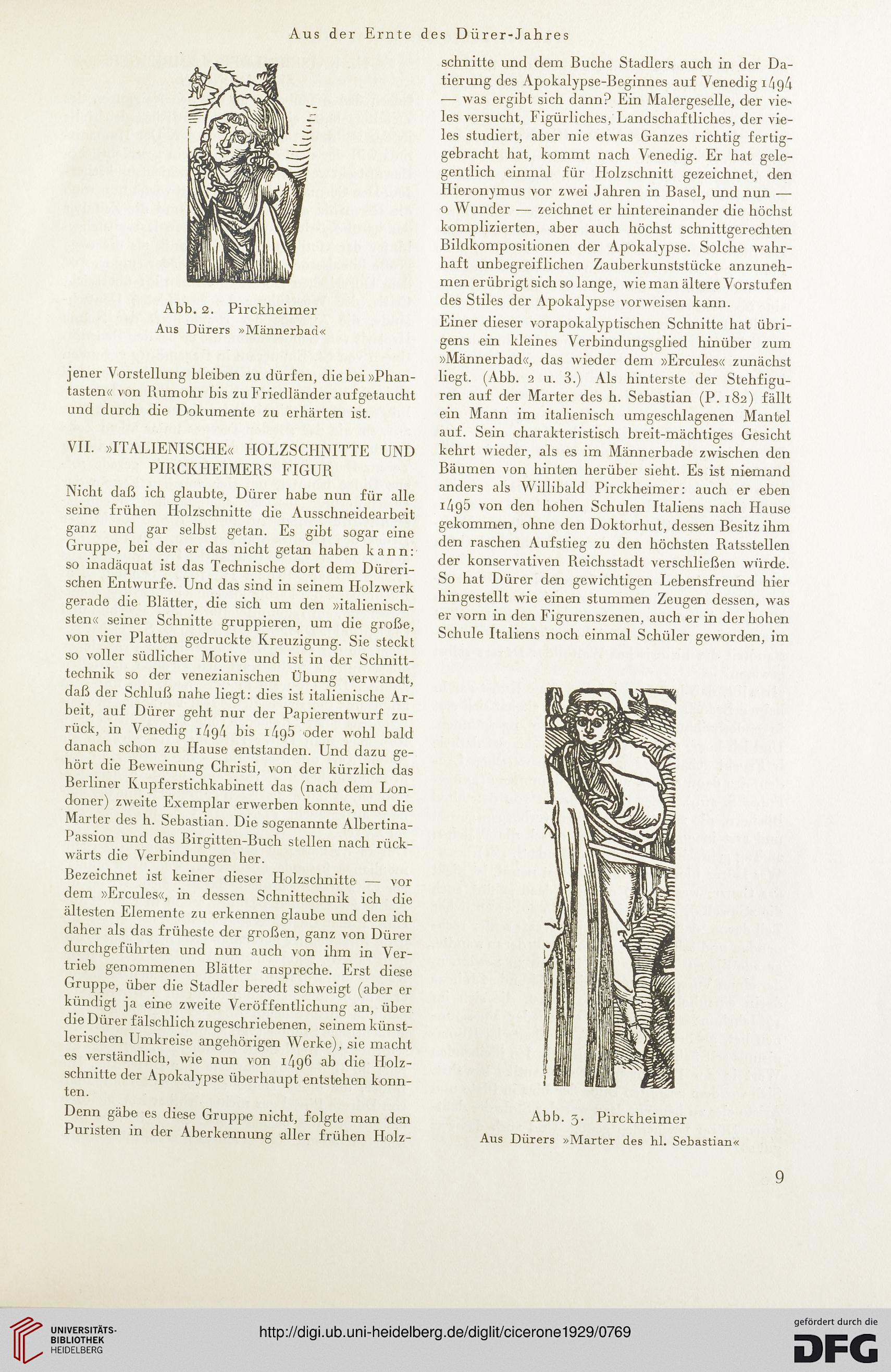Aus der Ernte des Dürer-Jahres
Abb. 2. Pirckheimer
Aus Dürers »Männerbad«
jener Vorstellung bleiben zu dürfen, die bei »Phan-
tasten« von Rumohr bis zu Friedländer auf getaucht
und durch die Dokumente zu erhärten ist.
VII. »ITALIENISCHE« HOLZSCHNITTE UND
PIRCKIIEIMERS FIGUR
Nicht daß ich glaubte, Dürer habe nun für alle
seine frühen Holzschnitte die Ausschneidearbeit
ganz und gar selbst getan. Es gibt sogar eine
Gruppe, bei der er das nicht getan haben kann:
so inadäquat ist das Technische dort dem Düreri-
schen Entwürfe. Und das sind in seinem Holzwerk
gerade die Blätter, die sich um den »italienisch-
sten« seiner Schnitte gruppieren, um die große,
von vier Platten gedruckte Kreuzigung. Sie steckt
so voller südlicher Motive und ist in der Schnitt-
technik so der venezianischen Übung verwandt,
daß der Schluß nahe liegt: dies ist italienische Ar-
beit, auf Dürer geht nur der Papierentwurf zu-
rück, in Venedig i4g4 bis i4g5 oder wohl bald
danach schon zu Hause entstanden. Und dazu ge-
hört die Beweinung Christi, von der kürzlich das
Berliner Kupferstichkabinett das (nach dem Lon-
doner) zweite Exemplar erwerben konnte, und die
Marter des h. Sebastian. Die sogenannte Albertina-
Passion und das Birgitten-Buch stellen nach rück-
wärts die Verbindungen her.
Bezeichnet ist keiner dieser Holzschnitte — vor
dem »Ercules«, in dessen Schnittechnik ich die
ältesten Elemente zu erkennen glaube und den ich
daher als das früheste der großen, ganz von Dürer
durchgeführten und nun auch von ihm in Ver-
trieb genommenen Blätter anspreche. Erst diese
Gruppe, über die Stadler beredt schweigt (aber er
kündigt ja eine zweite Veröffentlichung an, über
die Dürer fälschlich zugeschriebenen, seinem künst-
lerischen Umkreise angehörigen Werke), sie macht
es verständlich, wie nun von i4g6 ab die Holz-
schnitte der Apokalypse überhaupt entstehen konn-
ten.
Denn gäbe es diese Gruppe nicht, folgte man den
Puristen in der Aberkennung aller frühen Holz-
schnitte und dem Buche Stadlers auch in der Da-
tierung des Apokalypse-Beginnes auf Venedig 14g4
—- was ergibt sich dann? Ein Malergeselle, der vie-
les versucht, Figürliches/Landschaftliches, der vie-
les studiert, aber nie etwas Ganzes richtig fertig-
gebracht hat, kommt nach Venedig. Er hat gele-
gentlich einmal für Holzschnitt gezeichnet, den
Hieronymus vor zwei Jahren in Basel, und nun —
o Wunder — zeichnet er hintereinander die höchst
komplizierten, aber auch höchst schnittgerechten
Bildkompositionen der Apokalypse. Solche wahr-
haft unbegreiflichen Zauberkunststücke anzuneh-
men erübrigt sich so lange, wie man ältere Vorstufen
des Stiles der Apokalypse vorweisen kann.
Einer dieser vorapokalyptischen Schnitte hat übri-
gens ein kleines Verbindungsglied hinüber zum
»Männerbad«, das wieder dem »Ercules« zunächst
liegt. (Abb. 2 u. 3.) Als hinterste der Stehfigu-
ren auf der Marter des h. Sebastian (P. 182) fällt
ein Mann im italienisch umgeschlagenen Mantel
auf. Sein charakteristisch breit-mächtiges Gesicht
kehrt wieder, als es im Männerbade zwischen den
Bäumen von hinten herüber sieht. Es ist niemand
anders als Willibald Pirckheimer: auch er eben
i4g5 von den hohen Schulen Italiens nach Hause
gekommen, ohne den Doktorhut, dessen Besitz ihm
den raschen Aufstieg zu den höchsten Ratsstellen
der konservativen Reichsstadt verschließen würde.
So hat Dürer den gewichtigen Lebensfreund hier
hingestellt wie einen stummen Zeugen dessen, was
er vorn in den Figurenszenen, auch er in der hohen
Schule Italiens noch einmal Schüler geworden, im
Abb. 5. Pirckheimer
Aus Dürers »Marter des bl. Sebastian«
9
Abb. 2. Pirckheimer
Aus Dürers »Männerbad«
jener Vorstellung bleiben zu dürfen, die bei »Phan-
tasten« von Rumohr bis zu Friedländer auf getaucht
und durch die Dokumente zu erhärten ist.
VII. »ITALIENISCHE« HOLZSCHNITTE UND
PIRCKIIEIMERS FIGUR
Nicht daß ich glaubte, Dürer habe nun für alle
seine frühen Holzschnitte die Ausschneidearbeit
ganz und gar selbst getan. Es gibt sogar eine
Gruppe, bei der er das nicht getan haben kann:
so inadäquat ist das Technische dort dem Düreri-
schen Entwürfe. Und das sind in seinem Holzwerk
gerade die Blätter, die sich um den »italienisch-
sten« seiner Schnitte gruppieren, um die große,
von vier Platten gedruckte Kreuzigung. Sie steckt
so voller südlicher Motive und ist in der Schnitt-
technik so der venezianischen Übung verwandt,
daß der Schluß nahe liegt: dies ist italienische Ar-
beit, auf Dürer geht nur der Papierentwurf zu-
rück, in Venedig i4g4 bis i4g5 oder wohl bald
danach schon zu Hause entstanden. Und dazu ge-
hört die Beweinung Christi, von der kürzlich das
Berliner Kupferstichkabinett das (nach dem Lon-
doner) zweite Exemplar erwerben konnte, und die
Marter des h. Sebastian. Die sogenannte Albertina-
Passion und das Birgitten-Buch stellen nach rück-
wärts die Verbindungen her.
Bezeichnet ist keiner dieser Holzschnitte — vor
dem »Ercules«, in dessen Schnittechnik ich die
ältesten Elemente zu erkennen glaube und den ich
daher als das früheste der großen, ganz von Dürer
durchgeführten und nun auch von ihm in Ver-
trieb genommenen Blätter anspreche. Erst diese
Gruppe, über die Stadler beredt schweigt (aber er
kündigt ja eine zweite Veröffentlichung an, über
die Dürer fälschlich zugeschriebenen, seinem künst-
lerischen Umkreise angehörigen Werke), sie macht
es verständlich, wie nun von i4g6 ab die Holz-
schnitte der Apokalypse überhaupt entstehen konn-
ten.
Denn gäbe es diese Gruppe nicht, folgte man den
Puristen in der Aberkennung aller frühen Holz-
schnitte und dem Buche Stadlers auch in der Da-
tierung des Apokalypse-Beginnes auf Venedig 14g4
—- was ergibt sich dann? Ein Malergeselle, der vie-
les versucht, Figürliches/Landschaftliches, der vie-
les studiert, aber nie etwas Ganzes richtig fertig-
gebracht hat, kommt nach Venedig. Er hat gele-
gentlich einmal für Holzschnitt gezeichnet, den
Hieronymus vor zwei Jahren in Basel, und nun —
o Wunder — zeichnet er hintereinander die höchst
komplizierten, aber auch höchst schnittgerechten
Bildkompositionen der Apokalypse. Solche wahr-
haft unbegreiflichen Zauberkunststücke anzuneh-
men erübrigt sich so lange, wie man ältere Vorstufen
des Stiles der Apokalypse vorweisen kann.
Einer dieser vorapokalyptischen Schnitte hat übri-
gens ein kleines Verbindungsglied hinüber zum
»Männerbad«, das wieder dem »Ercules« zunächst
liegt. (Abb. 2 u. 3.) Als hinterste der Stehfigu-
ren auf der Marter des h. Sebastian (P. 182) fällt
ein Mann im italienisch umgeschlagenen Mantel
auf. Sein charakteristisch breit-mächtiges Gesicht
kehrt wieder, als es im Männerbade zwischen den
Bäumen von hinten herüber sieht. Es ist niemand
anders als Willibald Pirckheimer: auch er eben
i4g5 von den hohen Schulen Italiens nach Hause
gekommen, ohne den Doktorhut, dessen Besitz ihm
den raschen Aufstieg zu den höchsten Ratsstellen
der konservativen Reichsstadt verschließen würde.
So hat Dürer den gewichtigen Lebensfreund hier
hingestellt wie einen stummen Zeugen dessen, was
er vorn in den Figurenszenen, auch er in der hohen
Schule Italiens noch einmal Schüler geworden, im
Abb. 5. Pirckheimer
Aus Dürers »Marter des bl. Sebastian«
9