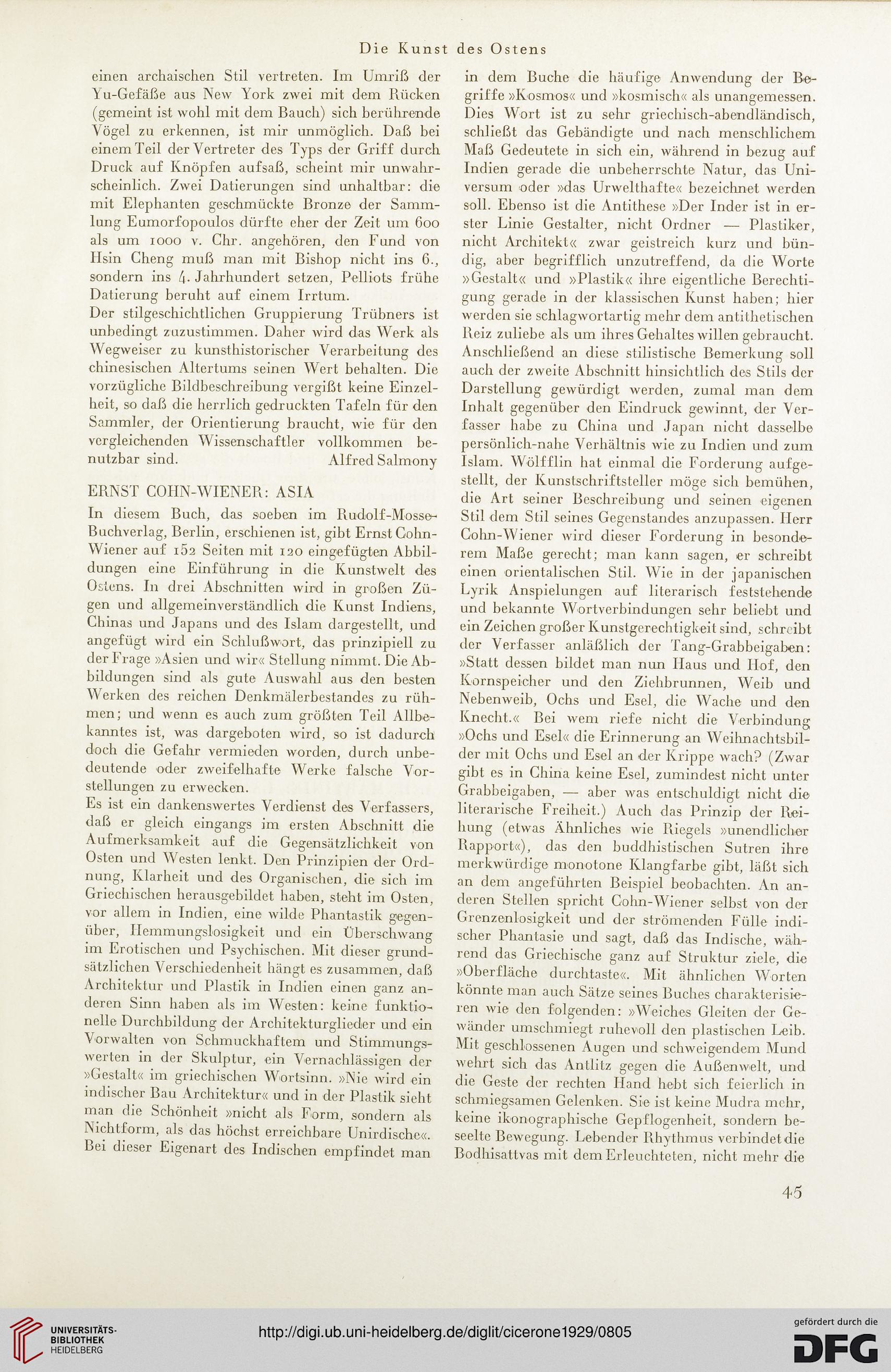Die Kunst des Ostens
einen archaischen Stil vertreten. Im Umriß der
Yu-Gefäße aus New York zwei mit dem Rücken
(gemeint ist wohl mit dem Bauch) sich berührende
Vögel zu erkennen, ist mir unmöglich. Daß bei
einem Teil der Vertreter des Typs der Griff durch
Druck auf Knöpfen aufsaß, scheint mir unwahr-
scheinlich. Zwei Datierungen sind unhaltbar: die
mit Elephanten geschmückte Bronze der Samm-
lung Eumorfopoulos dürfte eher der Zeit um 600
als um 1000 v. Chr. angehören, den Fund von
Ilsin Cheng muß man mit Bishop nicht ins 6.,
sondern ins 4- Jahrhundert setzen, Pelliots frühe
Datierung beruht auf einem Irrtum.
Der stilgeschichtlichen Gruppierung Trübners ist
unbedingt zuzustimmen. Daher Avird das Werk als
Wegweiser zu kunsthistorischer Verarbeitung des
chinesischen Altertums seinen Wert behalten. Die
vorzügliche Bildbeschreibung vergißt keine Einzel-
heit, so daß die herrlich gedruckten Tafeln für den
Sammler, der Orientierung braucht, Avie für den
vergleichenden Wissenschaftler vollkommen be-
nutzbar sind. Alfred Salmony
ERNST COHN-WIENER: ASIA
In diesem Buch, das soeben im Rudolf-Mossei-
Buchverlag, Berlin, erschienen ist, gibt Ernst Gohn-
Wiener auf iÖ2 Seiten mit 120 eingefügten Abbil-
dungen eine Einführung in die Kunstwelt des
Ostens. In drei Abschnitten wird in großen Zü-
gen und allgemeinverständlich die Kunst Indiens,
Chinas und Japans und des Islam dargestellt, und
angefügt wird ein Schlußwort, das prinzipiell zu
der Frage »Asien und wir« Stellung nimmt. Die Ab-
bildungen sind als gute Auswahl aus den besten
Werken des reichen Denkmälerbestandes zu rüh-
men; und wenn es auch zum größten Teil Allbe-
kanntes ist, Avas dargeboten Avird, so ist dadurch
doch die Gefahr vermieden worden, durch unbe-
deutende oder zAveifelbafte Werke falsche Vor-
stellungen zu erwecken.
Es ist ein dankensAvertes Verdienst des Verfassers,
daß er gleich eingangs im ersten Abschnitt die
Aufmerksamkeit auf die Gegensätzlichkeit von
Osten und Westen lenkt. Den Prinzipien der Ord-
nung, Klarheit und des Organischen, die sich im
Griechischen herausgebildet haben, steht im Osten,
vor allem in Indien, eine Avilde Phantastik gegen-
über, Hemmungslosigkeit und ein ÜberscliAvang
im Erotischen und Psychischen. Mit dieser grund-
sätzlichen Verschiedenheit hängt es zusammen, daß
Architektur und Plastik in Indien einen ganz an-
deren Sinn haben als im Westen: keine funktio-
nelle Durchbildung der Architekturglieder und ein
Vorwalten von Schmuckhaftem und Stimmungs-
werten in der Skulptur, ein Vernachlässigen der
»Gestalt« im griechischen Wortsinn. »Nie Avird ein
indischer Bau Architektur« und in der Plastik sieht
man die Schönheit »nicht als Form, sondern als
Nichtform, als das höchst erreichbare Unirdische«.
Bei dieser Eigenart des Indischen empfindet man
in dem Buche die häufige Amvenclung der Be-
griffe »Kosmos« und »kosmisch« als unangemessen.
Dies Wort ist zu sehr griechisch-abendländisch,
schließt das Gebändigte und nach menschlichem
Maß Gedeutete in sich ein, während in bezug auf
Indien gerade die unbeherrschte Natur, das Uni-
versum oder »das Urwelthafte« bezeichnet Averden
soll. Ebenso ist die Antithese »Der Inder ist in er-
ster Linie Gestalter, nicht Ordner — Plastiker,
nicht Architekt« zwar geistreich kurz und bün-
dig, aber begrifflich unzutreffend, da die Worte
»Gestalt« und »Plastik« ihre eigentliche Berechti-
gung gerade in der klassischen Kunst haben; liier
werden sie schlagwortartig mehr dem antithetischen
Reiz zuliebe als um ihres Gehaltes willen gebraucht.
Anschließend an diese stilistische Bemerkung soll
auch der zAveite Abschnitt hinsichtlich des Stils der
Darstellung gewürdigt werden, zumal man dem
Inhalt gegenüber den Eindruck gewinnt, der Ver-
fasser habe zu China und Japan nicht dasselbe
persönlich-nahe Verhältnis wie zu Indien und zum
Islam. Wölfflin hat einmal die Forderung aufge-
stellt, der Kunstschriftsteller möge sich bemühen,
die Art seiner Beschreibung und seinen eigenen
Stil dem Stil seines Gegenstandes anzupassen. Herr
Cohn-Wiener Avird dieser Forderung in besonde-
rem Maße gerecht; man kann sagen, er schreibt
einen orientalischen Stil. Wie in der japanischen
Lyrik Anspielungen auf literarisch feststehende
und bekannte Wortverbindungen sehr beliebt und
ein Zeichen großer Kunstgerechtigkeit sind, schreibt
der Verfasser anläßlich der Tang-Grabbeigaben:
»Statt dessen bildet man nun Haus und Hof, den
Kornspeicher und den Ziehbrunnen, Weib und
NebenAveib, Ochs und Esel, die Wache und den
Knecht.« Bei wem riefe nicht die Verbindung
»Ochs und Esel« die Erinnerung an Weihnachtsbil-
der mit Ochs und Esel an der Krippe wach? (Zwar
gibt es in China keine Esel, zumindest nicht unter
Grabbeigaben, — aber was entschuldigt nicht die
literarische Freiheit.) Auch das Prinzip der Rei-
hung (etwas Ähnliches Avie Riegels »unendlicher
Rapport«), das den buddhistischen Sutren ihre
merkwürdige monotone Klangfarbe gibt, läßt sich
an dem angeführten Beispiel beobachten. An an-
deren Stellen spricht Cohn-Wiener selbst von der
Grenzenlosigkeit und der strömenden Fülle indi-
scher Phantasie und sagt, daß das Indische, Aväh-
rend das Griechische ganz auf Struktur ziele, die
»Oberfläche durchtaste«. Mit ähnlichen Worten
könnte man auch Sätze seines Buches charakterisie-
ren Avie den folgenden: »Weiches Gleiten der Ge-
wänder umschmiegt ruhevoll den plastischen Leib.
Mit geschlossenen Augen und schweigendem Mund
Avehrt sieb das Antlitz gegen die Außenweit, und
die Geste der rechten Hand hebt sich feierlich in
schmiegsamen Gelenken. Sie ist keine Mudra mehr,
keine ikonographische Gepflogenheit, sondern be-
seelte Bewegung. Lebender Rhythmus verbindet die
Bodhisattvas mit dem Erleuchteten, nicht mehr die
45
einen archaischen Stil vertreten. Im Umriß der
Yu-Gefäße aus New York zwei mit dem Rücken
(gemeint ist wohl mit dem Bauch) sich berührende
Vögel zu erkennen, ist mir unmöglich. Daß bei
einem Teil der Vertreter des Typs der Griff durch
Druck auf Knöpfen aufsaß, scheint mir unwahr-
scheinlich. Zwei Datierungen sind unhaltbar: die
mit Elephanten geschmückte Bronze der Samm-
lung Eumorfopoulos dürfte eher der Zeit um 600
als um 1000 v. Chr. angehören, den Fund von
Ilsin Cheng muß man mit Bishop nicht ins 6.,
sondern ins 4- Jahrhundert setzen, Pelliots frühe
Datierung beruht auf einem Irrtum.
Der stilgeschichtlichen Gruppierung Trübners ist
unbedingt zuzustimmen. Daher Avird das Werk als
Wegweiser zu kunsthistorischer Verarbeitung des
chinesischen Altertums seinen Wert behalten. Die
vorzügliche Bildbeschreibung vergißt keine Einzel-
heit, so daß die herrlich gedruckten Tafeln für den
Sammler, der Orientierung braucht, Avie für den
vergleichenden Wissenschaftler vollkommen be-
nutzbar sind. Alfred Salmony
ERNST COHN-WIENER: ASIA
In diesem Buch, das soeben im Rudolf-Mossei-
Buchverlag, Berlin, erschienen ist, gibt Ernst Gohn-
Wiener auf iÖ2 Seiten mit 120 eingefügten Abbil-
dungen eine Einführung in die Kunstwelt des
Ostens. In drei Abschnitten wird in großen Zü-
gen und allgemeinverständlich die Kunst Indiens,
Chinas und Japans und des Islam dargestellt, und
angefügt wird ein Schlußwort, das prinzipiell zu
der Frage »Asien und wir« Stellung nimmt. Die Ab-
bildungen sind als gute Auswahl aus den besten
Werken des reichen Denkmälerbestandes zu rüh-
men; und wenn es auch zum größten Teil Allbe-
kanntes ist, Avas dargeboten Avird, so ist dadurch
doch die Gefahr vermieden worden, durch unbe-
deutende oder zAveifelbafte Werke falsche Vor-
stellungen zu erwecken.
Es ist ein dankensAvertes Verdienst des Verfassers,
daß er gleich eingangs im ersten Abschnitt die
Aufmerksamkeit auf die Gegensätzlichkeit von
Osten und Westen lenkt. Den Prinzipien der Ord-
nung, Klarheit und des Organischen, die sich im
Griechischen herausgebildet haben, steht im Osten,
vor allem in Indien, eine Avilde Phantastik gegen-
über, Hemmungslosigkeit und ein ÜberscliAvang
im Erotischen und Psychischen. Mit dieser grund-
sätzlichen Verschiedenheit hängt es zusammen, daß
Architektur und Plastik in Indien einen ganz an-
deren Sinn haben als im Westen: keine funktio-
nelle Durchbildung der Architekturglieder und ein
Vorwalten von Schmuckhaftem und Stimmungs-
werten in der Skulptur, ein Vernachlässigen der
»Gestalt« im griechischen Wortsinn. »Nie Avird ein
indischer Bau Architektur« und in der Plastik sieht
man die Schönheit »nicht als Form, sondern als
Nichtform, als das höchst erreichbare Unirdische«.
Bei dieser Eigenart des Indischen empfindet man
in dem Buche die häufige Amvenclung der Be-
griffe »Kosmos« und »kosmisch« als unangemessen.
Dies Wort ist zu sehr griechisch-abendländisch,
schließt das Gebändigte und nach menschlichem
Maß Gedeutete in sich ein, während in bezug auf
Indien gerade die unbeherrschte Natur, das Uni-
versum oder »das Urwelthafte« bezeichnet Averden
soll. Ebenso ist die Antithese »Der Inder ist in er-
ster Linie Gestalter, nicht Ordner — Plastiker,
nicht Architekt« zwar geistreich kurz und bün-
dig, aber begrifflich unzutreffend, da die Worte
»Gestalt« und »Plastik« ihre eigentliche Berechti-
gung gerade in der klassischen Kunst haben; liier
werden sie schlagwortartig mehr dem antithetischen
Reiz zuliebe als um ihres Gehaltes willen gebraucht.
Anschließend an diese stilistische Bemerkung soll
auch der zAveite Abschnitt hinsichtlich des Stils der
Darstellung gewürdigt werden, zumal man dem
Inhalt gegenüber den Eindruck gewinnt, der Ver-
fasser habe zu China und Japan nicht dasselbe
persönlich-nahe Verhältnis wie zu Indien und zum
Islam. Wölfflin hat einmal die Forderung aufge-
stellt, der Kunstschriftsteller möge sich bemühen,
die Art seiner Beschreibung und seinen eigenen
Stil dem Stil seines Gegenstandes anzupassen. Herr
Cohn-Wiener Avird dieser Forderung in besonde-
rem Maße gerecht; man kann sagen, er schreibt
einen orientalischen Stil. Wie in der japanischen
Lyrik Anspielungen auf literarisch feststehende
und bekannte Wortverbindungen sehr beliebt und
ein Zeichen großer Kunstgerechtigkeit sind, schreibt
der Verfasser anläßlich der Tang-Grabbeigaben:
»Statt dessen bildet man nun Haus und Hof, den
Kornspeicher und den Ziehbrunnen, Weib und
NebenAveib, Ochs und Esel, die Wache und den
Knecht.« Bei wem riefe nicht die Verbindung
»Ochs und Esel« die Erinnerung an Weihnachtsbil-
der mit Ochs und Esel an der Krippe wach? (Zwar
gibt es in China keine Esel, zumindest nicht unter
Grabbeigaben, — aber was entschuldigt nicht die
literarische Freiheit.) Auch das Prinzip der Rei-
hung (etwas Ähnliches Avie Riegels »unendlicher
Rapport«), das den buddhistischen Sutren ihre
merkwürdige monotone Klangfarbe gibt, läßt sich
an dem angeführten Beispiel beobachten. An an-
deren Stellen spricht Cohn-Wiener selbst von der
Grenzenlosigkeit und der strömenden Fülle indi-
scher Phantasie und sagt, daß das Indische, Aväh-
rend das Griechische ganz auf Struktur ziele, die
»Oberfläche durchtaste«. Mit ähnlichen Worten
könnte man auch Sätze seines Buches charakterisie-
ren Avie den folgenden: »Weiches Gleiten der Ge-
wänder umschmiegt ruhevoll den plastischen Leib.
Mit geschlossenen Augen und schweigendem Mund
Avehrt sieb das Antlitz gegen die Außenweit, und
die Geste der rechten Hand hebt sich feierlich in
schmiegsamen Gelenken. Sie ist keine Mudra mehr,
keine ikonographische Gepflogenheit, sondern be-
seelte Bewegung. Lebender Rhythmus verbindet die
Bodhisattvas mit dem Erleuchteten, nicht mehr die
45