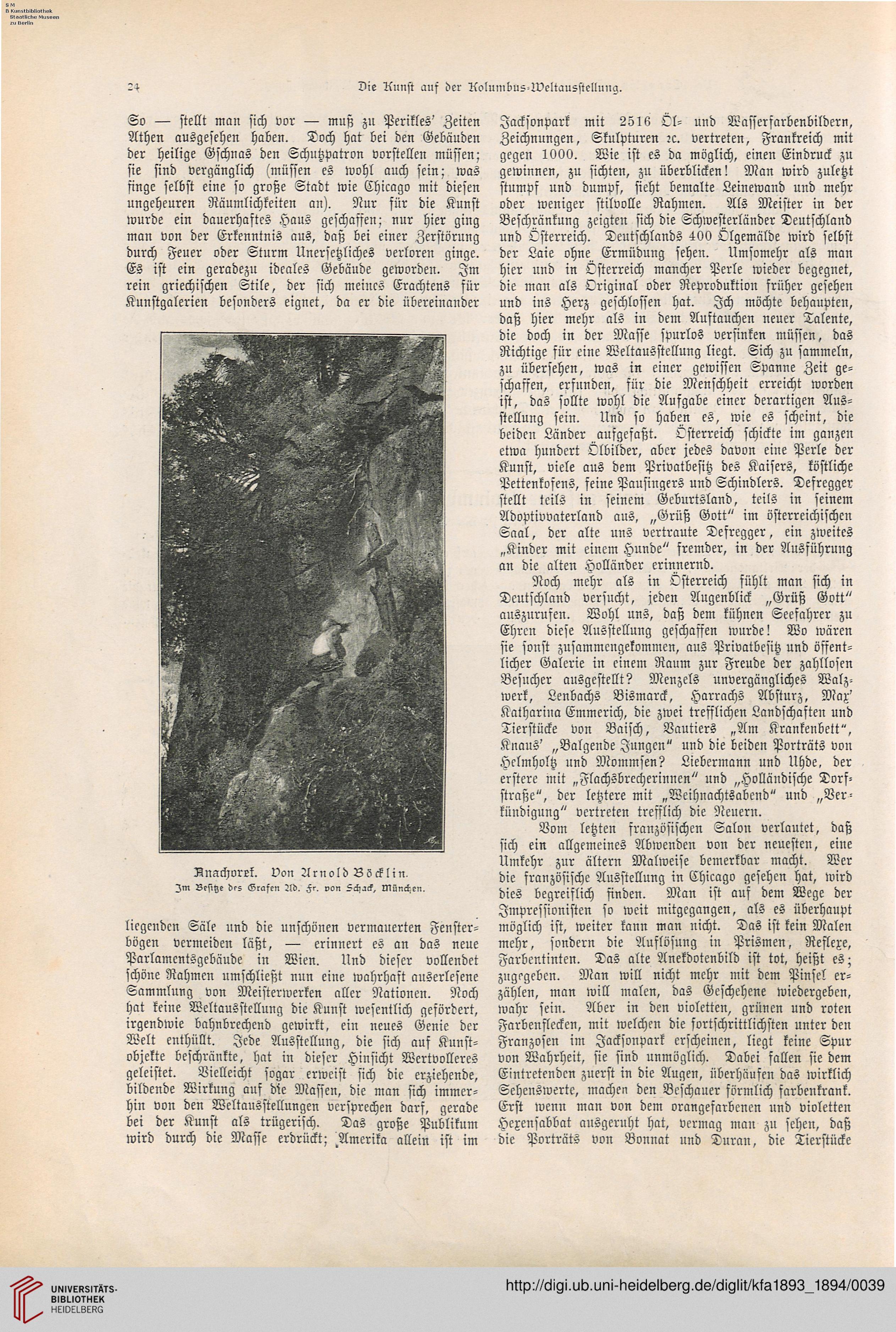24
Oie Kunst auf der Aalumbus-Iveltausstclluiig.
So — stellt man sich vor — muß zu Perikles' Zeiten
Athen ausgesehen haben. Doch hat bei den Gebäuden
der heilige Gschnas den Schutzpatron vorstellen müssen;
sie sind vergänglich (müssen es wohl auch sein; was
finge selbst eine so große Stadt wie Chicago mit diesen
ungeheuren Räumlichkeiten an). Nur für die Kunst
wurde ein dauerhaftes Haus geschaffen; nur hier ging
man von der Erkenntnis aus, daß bei einer Zerstörung
durch Feuer oder Sturm Unersetzliches verloren ginge.
Es ist ein geradezu ideales Gebäude geworden. Im
rein griechischen Stile, der sich meines Erachtens für
Kunstgalerien besonders eignet, da er die übereinander
Nnachorrl. von Arnold Böcklin.
Besitze des Grafen Ad. Fe. von Schack, München.
liegenden Säle und die unschönen vermauerten Fenster-
bögen vermeiden läßt, — erinnert es an das neue
Parlamcntsgebäude in Wien. Und dieser vollendet
schöne Rahmen umschließt nun eine wahrhaft auserlesene
Sammlung von Meisterwerken aller Nationen. Noch
hat keine Weltausstellung die Kunst wesentlich gefördert,
irgendwie bahnbrechend gewirkt, ein neues Genie der
Welt enthüllt. Jede Ausstellung, die sich auf Kunst-
objekte beschränkte, hat in dieser Hinsicht Wertvolleres
geleistet. Vielleicht sogar erweist sich die erziehende,
bildende Wirkung auf die Massen, die man sich immer-
hin von den Weltausstellungen versprechen darf, gerade
bei der Kunst als trügerisch. Das große Publikum
wird durch die Masse erdrückt; .Amerika allein ist im
Jacksonpark mit 2516 Öl- und Wasserfarbenbildern,
Zeichnungen, Skulpturen rc. vertreten, Frankreich mit
gegen 1000. Wie ist es da möglich, einen Eindruck zu
gewinnen, zu sichten, zu überblicken! Man wird zuletzt
stumpf und dumpf, sieht bemalte Leinewand und mehr
oder weniger stilvolle Rahmen. Als Meister in der
Beschränkung zeigten sich die Schwesterländer Deutschland
und Österreich. Deutschlands 400 Ölgemälde wird selbst
der Laie ohne Ermüdung sehen. Umsomehr als man
hier und in Österreich mancher Perle wieder begegnet,
die man als Original oder Reproduktion früher gesehen
und ins Herz geschlossen hat. Ich möchte behaupten,
daß hier mehr als in dem Auftauchen neuer Talente,
die doch in der Masse spurlos versinken müssen, das
Richtige für eine Weltausstellung liegt. Sich zu sammeln,
zu übersehen, was in einer gewissen Spanne Zeit ge-
schaffen, erfunden, für die Menschheit erreicht worden
ist, das sollte wohl die Aufgabe einer derartigen Aus-
stellung sein. Und so haben es, wie es scheint, die
beiden Länder aufgefaßt. Österreich schickte im ganzeu
etwa hundert Ölbilder, aber jedes davon eine Perle der
Kunst, viele aus dem Privatbesitz des Kaisers, köstliche
Pettenkofens, feine Pausingers und Schindlers. Defregger
stellt teils in seinem Geburtsland, teils in seinem
Adoptivvaterland aus, „Grüß Gott" im österreichischen
Saal, der alte uns vertraute Defregger, ein zweites
„Kinder mit einem Hunde" fremder, in der Ausführung
an die alten Holländer erinnernd.
Noch mehr als in Österreich fühlt man sich in
Deutschland versucht, jeden Augenblick „Grüß Gott"
auszurufen. Wohl uns, daß dem kühnen Seefahrer zu
Ehren diese Ausstellung geschaffen wurde! Wo wären
sie sonst zusammcngekommen, aus Privatbesitz und öffent-
licher Galerie in einem Raum zur Freude der zahllosen
Besucher ausgestellt? Menzels unvergängliches Walz-
werk, Lenbachs Bismarck, Harrachs Absturz, Max'
Katharina Emmerich, die zwei trefflichen Landschaften und
Tierstücke von Baisch, Vautiers „Am Krankenbett",
Knaus' „Balgende Jungen" und die beiden Porträts von
Helmholtz und Mommsen? Liebermann und Uhde, der
erstere mit „Flachsbrecherinnen" und „Holländische Torf-
straße", der letztere mit „Weihnachtsabend" und „Ver-
kündigung" vertreten trefflich die Neuern.
Vom letzten französischen Salon verlautet, daß
sich ein allgemeines Abwenden von der neuesten, eine
Umkehr zur ältern Malweise bemerkbar macht. Wer
die französische Ausstellung in Chicago gesehen hat, wird
dies begreiflich finden. Man ist auf dem Wege der
Impressionisten so weit mitgegangen, als es überhaupt
möglich ist, weiter kann man nicht. Das ist kein Malen
mehr, sondern die Auflösung in Prismen, Reflexe,
Farbentinten. Das alte Anekdotenbild ist tot, heißt es;
zugegeben. Man will nicht mehr mit dem Pinsel er-
zählen, man will malen, das Geschehene wiedcrgeben,
wahr sein. Aber in den violetten, grünen und roten
Farbenflecken, mit welchen die fortschrittlichsten unter den
Franzosen im Jacksonpark erscheinen, liegt keine Spur
von Wahrheit, sie sind unmöglich. Dabei fallen sie dem
Eintretendcn zuerst in die Augen, überhäufen das wirklich
Sehenswerte, machen den Beschauer förmlich farbeukrank.
Erst wenn man von dem orangefarbenen und violetten
Hexensabbat ausgeruht hat, vermag man zu sehen, daß
die Porträts von Bonnat und Duran, die Tierstücke
Oie Kunst auf der Aalumbus-Iveltausstclluiig.
So — stellt man sich vor — muß zu Perikles' Zeiten
Athen ausgesehen haben. Doch hat bei den Gebäuden
der heilige Gschnas den Schutzpatron vorstellen müssen;
sie sind vergänglich (müssen es wohl auch sein; was
finge selbst eine so große Stadt wie Chicago mit diesen
ungeheuren Räumlichkeiten an). Nur für die Kunst
wurde ein dauerhaftes Haus geschaffen; nur hier ging
man von der Erkenntnis aus, daß bei einer Zerstörung
durch Feuer oder Sturm Unersetzliches verloren ginge.
Es ist ein geradezu ideales Gebäude geworden. Im
rein griechischen Stile, der sich meines Erachtens für
Kunstgalerien besonders eignet, da er die übereinander
Nnachorrl. von Arnold Böcklin.
Besitze des Grafen Ad. Fe. von Schack, München.
liegenden Säle und die unschönen vermauerten Fenster-
bögen vermeiden läßt, — erinnert es an das neue
Parlamcntsgebäude in Wien. Und dieser vollendet
schöne Rahmen umschließt nun eine wahrhaft auserlesene
Sammlung von Meisterwerken aller Nationen. Noch
hat keine Weltausstellung die Kunst wesentlich gefördert,
irgendwie bahnbrechend gewirkt, ein neues Genie der
Welt enthüllt. Jede Ausstellung, die sich auf Kunst-
objekte beschränkte, hat in dieser Hinsicht Wertvolleres
geleistet. Vielleicht sogar erweist sich die erziehende,
bildende Wirkung auf die Massen, die man sich immer-
hin von den Weltausstellungen versprechen darf, gerade
bei der Kunst als trügerisch. Das große Publikum
wird durch die Masse erdrückt; .Amerika allein ist im
Jacksonpark mit 2516 Öl- und Wasserfarbenbildern,
Zeichnungen, Skulpturen rc. vertreten, Frankreich mit
gegen 1000. Wie ist es da möglich, einen Eindruck zu
gewinnen, zu sichten, zu überblicken! Man wird zuletzt
stumpf und dumpf, sieht bemalte Leinewand und mehr
oder weniger stilvolle Rahmen. Als Meister in der
Beschränkung zeigten sich die Schwesterländer Deutschland
und Österreich. Deutschlands 400 Ölgemälde wird selbst
der Laie ohne Ermüdung sehen. Umsomehr als man
hier und in Österreich mancher Perle wieder begegnet,
die man als Original oder Reproduktion früher gesehen
und ins Herz geschlossen hat. Ich möchte behaupten,
daß hier mehr als in dem Auftauchen neuer Talente,
die doch in der Masse spurlos versinken müssen, das
Richtige für eine Weltausstellung liegt. Sich zu sammeln,
zu übersehen, was in einer gewissen Spanne Zeit ge-
schaffen, erfunden, für die Menschheit erreicht worden
ist, das sollte wohl die Aufgabe einer derartigen Aus-
stellung sein. Und so haben es, wie es scheint, die
beiden Länder aufgefaßt. Österreich schickte im ganzeu
etwa hundert Ölbilder, aber jedes davon eine Perle der
Kunst, viele aus dem Privatbesitz des Kaisers, köstliche
Pettenkofens, feine Pausingers und Schindlers. Defregger
stellt teils in seinem Geburtsland, teils in seinem
Adoptivvaterland aus, „Grüß Gott" im österreichischen
Saal, der alte uns vertraute Defregger, ein zweites
„Kinder mit einem Hunde" fremder, in der Ausführung
an die alten Holländer erinnernd.
Noch mehr als in Österreich fühlt man sich in
Deutschland versucht, jeden Augenblick „Grüß Gott"
auszurufen. Wohl uns, daß dem kühnen Seefahrer zu
Ehren diese Ausstellung geschaffen wurde! Wo wären
sie sonst zusammcngekommen, aus Privatbesitz und öffent-
licher Galerie in einem Raum zur Freude der zahllosen
Besucher ausgestellt? Menzels unvergängliches Walz-
werk, Lenbachs Bismarck, Harrachs Absturz, Max'
Katharina Emmerich, die zwei trefflichen Landschaften und
Tierstücke von Baisch, Vautiers „Am Krankenbett",
Knaus' „Balgende Jungen" und die beiden Porträts von
Helmholtz und Mommsen? Liebermann und Uhde, der
erstere mit „Flachsbrecherinnen" und „Holländische Torf-
straße", der letztere mit „Weihnachtsabend" und „Ver-
kündigung" vertreten trefflich die Neuern.
Vom letzten französischen Salon verlautet, daß
sich ein allgemeines Abwenden von der neuesten, eine
Umkehr zur ältern Malweise bemerkbar macht. Wer
die französische Ausstellung in Chicago gesehen hat, wird
dies begreiflich finden. Man ist auf dem Wege der
Impressionisten so weit mitgegangen, als es überhaupt
möglich ist, weiter kann man nicht. Das ist kein Malen
mehr, sondern die Auflösung in Prismen, Reflexe,
Farbentinten. Das alte Anekdotenbild ist tot, heißt es;
zugegeben. Man will nicht mehr mit dem Pinsel er-
zählen, man will malen, das Geschehene wiedcrgeben,
wahr sein. Aber in den violetten, grünen und roten
Farbenflecken, mit welchen die fortschrittlichsten unter den
Franzosen im Jacksonpark erscheinen, liegt keine Spur
von Wahrheit, sie sind unmöglich. Dabei fallen sie dem
Eintretendcn zuerst in die Augen, überhäufen das wirklich
Sehenswerte, machen den Beschauer förmlich farbeukrank.
Erst wenn man von dem orangefarbenen und violetten
Hexensabbat ausgeruht hat, vermag man zu sehen, daß
die Porträts von Bonnat und Duran, die Tierstücke