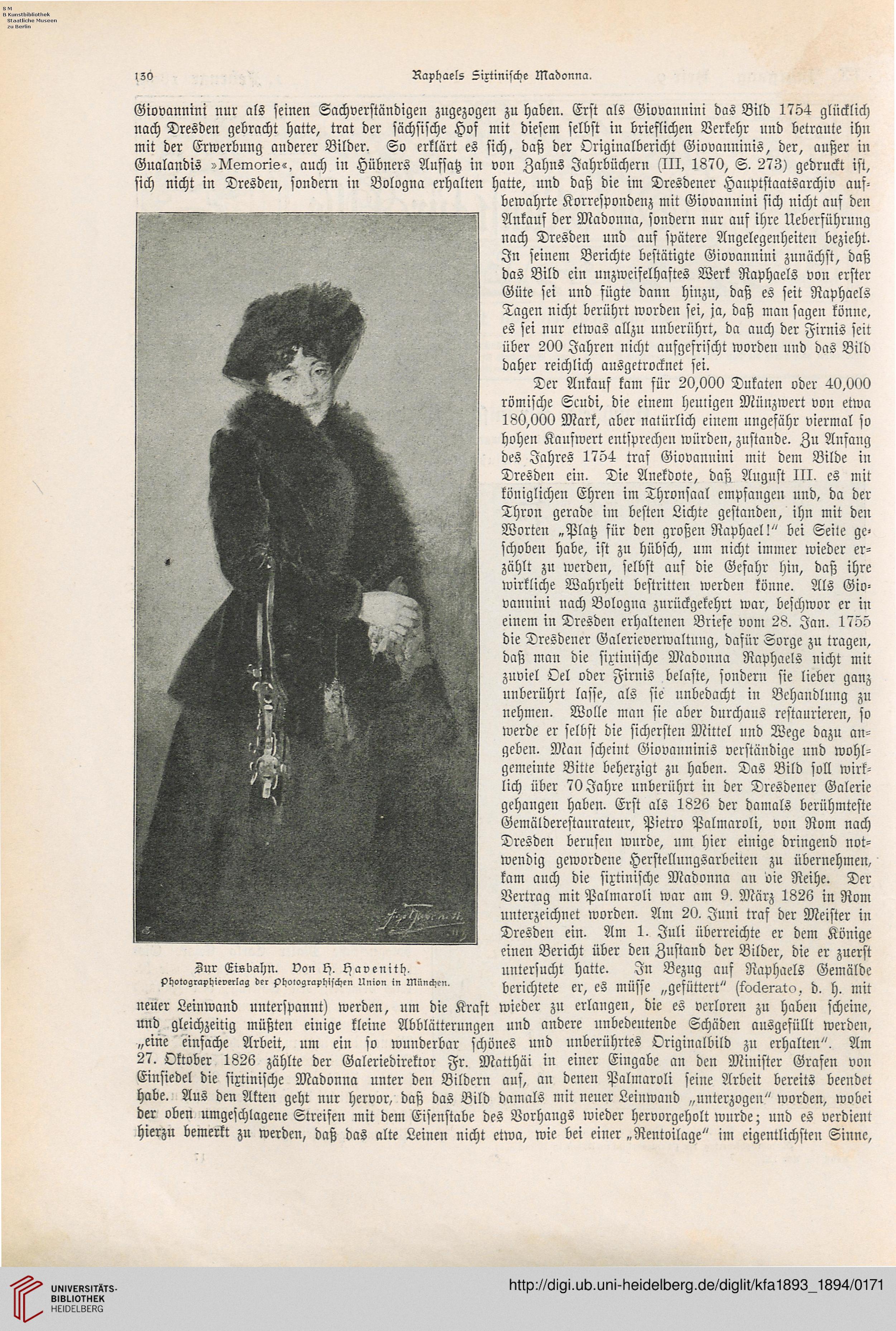Raphaels Sixtinische Madonna.
1Z0
Giovannini nur als seinen Sachverständigen zugezogen zu haben. Erst als Giovannini das Bild 1754 glücklich
nach Dresden gebracht hatte, trat der sächsische Hof mit diesem selbst in brieflichen Verkehr und betraute ihn
mit der Erwerbung anderer Bilder. So erklärt es sich, daß der Originalbericht Giovanninis, der, außer in
Gualandis »ikIsiriOris«, auch in Hübners Aufsatz in von Zahns Jahrbüchern (III, 1870, S. 273) gedruckt ist,
sich nicht in Dresden, sondern in Bologna erhalten hatte, und daß die im Dresdener Hanptstaatsarchiv auf-
bewahrte Korrespondenz mit Giovannini sich nicht auf den
Ankauf der Madonna, sondern nur auf ihre Ueberführung
nach Dresden und ans spätere Angelegenheiten bezieht.
In seinem Berichte bestätigte Giovannini zunächst, daß
das Bild ein unzweifelhaftes Werk Raphaels von erster
Güte sei und fügte dann hinzu, daß es seit Raphaels
Tagen nicht berührt worden sei, ja, daß man sagen könne,
es sei nur etwas allzu unberührt, da auch der Firnis seit
über 200 Jahren nicht aufgefrischt worden und das Bild
daher reichlich ausgetrocknet sei.
Der Ankauf kam für 20,000 Dukaten oder 40,000
römische Scudi, die einem heuiigen Münzwert von etwa
180,000 Mark, aber natürlich einem ungefähr viermal so
hohen Kaufwert entsprechen würden, zustande. Zu Anfang
des Jahres 1754 traf Giovannini mit dem Bilde in
Dresden ein. Die Anekdote, daß August III. es mit
königlichen Ehren im Thronsaal empfangen und, da der
Thron gerade im besten Lichte gestanden, ihn mit den
Worten „Platz für den großen Raphael!" bei Seite ge-
schoben habe, ist zu hübsch, um nicht immer wieder er-
zählt zu werden, selbst auf die Gefahr hin, daß ihre
wirkliche Wahrheit bestritten werden könne. Als Gio-
vannini nach Bologna zurückgekehrt war, beschwor er in
einem in Dresden erhaltenen Briefe vom 28. Jan. 1755
die Dresdener Galerieverwaltung, dafür Sorge zu tragen,
daß man die sixtinische Madonna Raphaels nicht mit
zuviel Oel oder Firnis belaste, sondern sie lieber ganz
unberührt lasse, als sie unbedacht in Behandlung zu
nehmen. Wolle man sie aber durchaus restaurieren, so
werde er selbst die sichersten Mittel und Wege dazu an-
geben. Man scheint Giovanninis verständige und wohl-
gemeinte Bitte beherzigt zu haben. Das Bild soll wirk-
lich über 70 Jahre unberührt in der Dresdener Galerie
gehangen haben. Erst als 1826 der damals berühmteste
Gemälderestaurateur, Pietro Palmaroli, von Rom nach
Dresden berufen wurde, um hier einige dringend not-
wendig gewordene Herstellungsarbciten zu übernehmen,
kam auch die sixtinische Madonna an oie Reihe. Der
Vertrag mit Palmaroli war am 9. März 1826 in Rom
unterzeichnet worden. Am 20. Juni traf der Meister in
Dresden ein. Am 1- Juli überreichte er dem Könige
einen Bericht über den Zustand der Bilder, die er zuerst
Zur Eisbahn, von H. Savenitb. ' untersucht hatte. In Bezug auf Raphaels Gemälde
Pb°wgrapdi°°°r,°g der pt,°.°gr°xhisch°n Union in München. berichtete er, es müsse „gefüttert" (lockei-Lto, d. h. mit
neuer Leinwand unterspannt) werden, um die Kraft wieder zu erlangen, die es verloren zu haben scheine,
und gleichzeitig müßten einige kleine Abblätterungen und andere unbedeutende Schäden ausgefüllt werden,
„eine einfache Arbeit, um ein so wunderbar schönes und unberührtes Originalbild zu erhalten". Am
27. Oktober 1826 zählte der Galeriedirektor Fr. Matthäi in einer Eingabe an den Minister Grafen von
Einsiedel die sixtinische Madonna unter den Bildern auf, an denen Palmaroli seine Arbeit bereits beendet
habe. Aus den Akten geht nur hervor, daß das Bild damals mit neuer Leinwand „unterzogen" worden, wobei
der oben umgeschlagene Streifen mit dem Eisenstabe des Vorhangs wieder hervorgeholt wurde; und es verdient
hierzu bemerkt zu werden, daß das alte Leinen nicht etwa, wie bei einer „Rentoilage" im eigentlichsten Sinne,
1Z0
Giovannini nur als seinen Sachverständigen zugezogen zu haben. Erst als Giovannini das Bild 1754 glücklich
nach Dresden gebracht hatte, trat der sächsische Hof mit diesem selbst in brieflichen Verkehr und betraute ihn
mit der Erwerbung anderer Bilder. So erklärt es sich, daß der Originalbericht Giovanninis, der, außer in
Gualandis »ikIsiriOris«, auch in Hübners Aufsatz in von Zahns Jahrbüchern (III, 1870, S. 273) gedruckt ist,
sich nicht in Dresden, sondern in Bologna erhalten hatte, und daß die im Dresdener Hanptstaatsarchiv auf-
bewahrte Korrespondenz mit Giovannini sich nicht auf den
Ankauf der Madonna, sondern nur auf ihre Ueberführung
nach Dresden und ans spätere Angelegenheiten bezieht.
In seinem Berichte bestätigte Giovannini zunächst, daß
das Bild ein unzweifelhaftes Werk Raphaels von erster
Güte sei und fügte dann hinzu, daß es seit Raphaels
Tagen nicht berührt worden sei, ja, daß man sagen könne,
es sei nur etwas allzu unberührt, da auch der Firnis seit
über 200 Jahren nicht aufgefrischt worden und das Bild
daher reichlich ausgetrocknet sei.
Der Ankauf kam für 20,000 Dukaten oder 40,000
römische Scudi, die einem heuiigen Münzwert von etwa
180,000 Mark, aber natürlich einem ungefähr viermal so
hohen Kaufwert entsprechen würden, zustande. Zu Anfang
des Jahres 1754 traf Giovannini mit dem Bilde in
Dresden ein. Die Anekdote, daß August III. es mit
königlichen Ehren im Thronsaal empfangen und, da der
Thron gerade im besten Lichte gestanden, ihn mit den
Worten „Platz für den großen Raphael!" bei Seite ge-
schoben habe, ist zu hübsch, um nicht immer wieder er-
zählt zu werden, selbst auf die Gefahr hin, daß ihre
wirkliche Wahrheit bestritten werden könne. Als Gio-
vannini nach Bologna zurückgekehrt war, beschwor er in
einem in Dresden erhaltenen Briefe vom 28. Jan. 1755
die Dresdener Galerieverwaltung, dafür Sorge zu tragen,
daß man die sixtinische Madonna Raphaels nicht mit
zuviel Oel oder Firnis belaste, sondern sie lieber ganz
unberührt lasse, als sie unbedacht in Behandlung zu
nehmen. Wolle man sie aber durchaus restaurieren, so
werde er selbst die sichersten Mittel und Wege dazu an-
geben. Man scheint Giovanninis verständige und wohl-
gemeinte Bitte beherzigt zu haben. Das Bild soll wirk-
lich über 70 Jahre unberührt in der Dresdener Galerie
gehangen haben. Erst als 1826 der damals berühmteste
Gemälderestaurateur, Pietro Palmaroli, von Rom nach
Dresden berufen wurde, um hier einige dringend not-
wendig gewordene Herstellungsarbciten zu übernehmen,
kam auch die sixtinische Madonna an oie Reihe. Der
Vertrag mit Palmaroli war am 9. März 1826 in Rom
unterzeichnet worden. Am 20. Juni traf der Meister in
Dresden ein. Am 1- Juli überreichte er dem Könige
einen Bericht über den Zustand der Bilder, die er zuerst
Zur Eisbahn, von H. Savenitb. ' untersucht hatte. In Bezug auf Raphaels Gemälde
Pb°wgrapdi°°°r,°g der pt,°.°gr°xhisch°n Union in München. berichtete er, es müsse „gefüttert" (lockei-Lto, d. h. mit
neuer Leinwand unterspannt) werden, um die Kraft wieder zu erlangen, die es verloren zu haben scheine,
und gleichzeitig müßten einige kleine Abblätterungen und andere unbedeutende Schäden ausgefüllt werden,
„eine einfache Arbeit, um ein so wunderbar schönes und unberührtes Originalbild zu erhalten". Am
27. Oktober 1826 zählte der Galeriedirektor Fr. Matthäi in einer Eingabe an den Minister Grafen von
Einsiedel die sixtinische Madonna unter den Bildern auf, an denen Palmaroli seine Arbeit bereits beendet
habe. Aus den Akten geht nur hervor, daß das Bild damals mit neuer Leinwand „unterzogen" worden, wobei
der oben umgeschlagene Streifen mit dem Eisenstabe des Vorhangs wieder hervorgeholt wurde; und es verdient
hierzu bemerkt zu werden, daß das alte Leinen nicht etwa, wie bei einer „Rentoilage" im eigentlichsten Sinne,