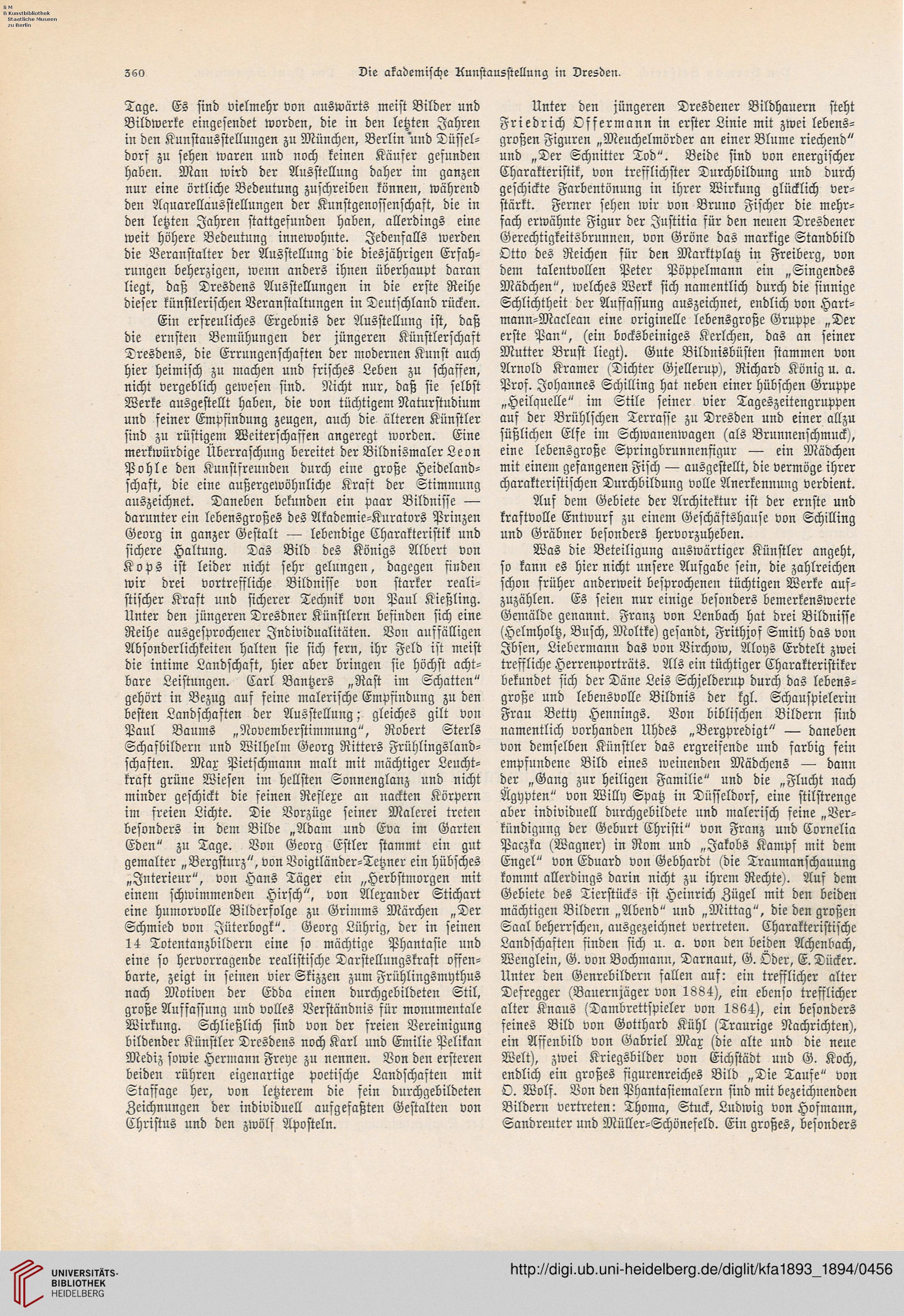Z60
Die akademische Kunstausstellung in Dresden.
Tage. Es sind vielmehr von auswärts meist Bilder und
Bildwerke eingesendet worden, die in den letzten Jahren
in den Kunstausstellungen zu München, Berlin und Tüssel-
dors zu sehen waren und noch keinen Käufer gefunden
haben. Man wird der Ausstellung daher im ganzen
nur eine örtliche Bedeutung zuschreiben können, während
den Aquarellausstellungen der Kunstgenossenschaft, die in
den letzten Jahren stattgefunden haben, allerdings eine
weit höhere Bedeutung innewohnte. Jedenfalls werden
die Veranstalter der Ausstellung die diesjährigen Erfah-
rungen beherzigen, wenn anders ihnen überhaupt daran
liegt, daß Dresdens Ausstellungen in die erste Reihe
dieser künstlerischen Veranstaltungen in Deutschland rücken.
Ein erfreuliches Ergebnis der Ausstellung ist, daß
die ernsten Bemühungen der jüngeren Künstlerschast
Dresdens, die Errungenschaften der modernen Kunst auch
hier heimisch zu machen und frisches Leben zu schaffen,
nicht vergeblich gewesen sind. Nicht nur, daß sie selbst
Werke ausgestellt haben, die von tüchtigem Naturstudium
und feiner Empfindung zeugen, auch die älteren Künstler
sind zu rüstigem Weiterschaffen angeregt worden. Eine
merkwürdige Überraschung bereitet der Bildnismaler Leon
Pohle den Kunstfreunden durch eine große Heideland-
schaft, die eine außergewöhnliche Kraft der Stimmung
auszeichnet. Daneben bekunden ein Paar Bildnisse —
darunter ein lebensgroßes des Akademie-Kurators Prinzen
Georg in ganzer Gestalt — lebendige Charakteristik und
sichere Haltung. Das Bild des Königs Albert von
Kops ist leider nicht sehr gelungen, dagegen finden
wir drei vortreffliche Bildnisse von starker reali-
stischer Kraft und sicherer Technik von Paul Kießling.
Ünter den jüngeren Dresdner Künstlern befinden sich eine
Reihe ausgesprochener Individualitäten. Von auffälligen
Absonderlichkeiten halten sie sich fern, ihr Feld ist meist
die intime Landschaft, hier aber bringen sie höchst acht-
bare Leistungen. Carl Bantzers „Rast im Schatten"
gehört in Bezug auf feine malerische Empfindung zu den
besten Landschaften der Ausstellung; gleiches gilt von
Paul Baums „Novemberstimmung", Robert Sterls
Schasbildern und Wilhelm Georg Ritters Frühlingsland-
schaften. Max Pietschmann malt mit mächtiger Leucht-
kraft grüne Wiesen im hellsten Sonnenglanz und nicht
minder geschickt die feinen Reflexe an nackten Körpern
im freien Lichte. Die Vorzüge seiner Malerei treten
besonders in dem Bilde „Adam und Eva im Garten
Eden" zu Tage. Von Georg Estler stammt ein gut
gemalter „Bergsturz", von Voigtländer-Tetzner ein hübsches
„Interieur", von Hans Täger ein „Hcrbstmorgen mit
einem schwimmenden Hirsch", von Alexander Stichart
eine humorvolle Bilderfolge zu Grimms Märchen „Der
Schmied von Jüterbogk". Georg Lührig, der in seinen
14 Totentanzbildern eine so mächtige Phantasie und
eine so hervorragende realistische Darstellungskraft offen-
barte, zeigt in seinen vier Skizzen zum Frühlingsmythus
nach Motiven der Edda einen durchgebildeten Stil,
große Auffassung und volles Verständnis für monumentale
Wirkung. Schließlich sind von der freien Vereinigung
bildender Künstler Dresdens noch Karl und Emilie Pelikan
Mediz sowie Hermann Freye zu nennen. Von den elfteren
beiden rühren eigenartige poetische Landschaften mit
Staffage her, von letzterem die fein durchgebildeten
Zeichnungen der individuell aufgefaßten Gestalten von
Christus und den zwölf Aposteln.
Unter den jüngeren Dresdener Bildhauern steht
Friedrich Offermann in erster Linie mit zwei lebens-
großen Figuren „Meuchelmörder an einer Blume riechend"
und „Der Schnitter Tod". Beide sind von energischer
Charakteristik, von trefflichster Durchbildung und durch
geschickte Farbentönung in ihrer Wirkung glücklich ver-
stärkt. Ferner sehen wir von Bruno Fischer die mehr-
fach erwähnte Figur der Justitia für den neuen Dresdener
Gerechtigkcitsbrunnen, von Gröne das markige Standbild
Otto des Reichen für den Marktplatz in Freiberg, von
dem talentvollen Peter Pöppelmann ein „Singendes
Mädchen", welches Werk sich namentlich durch die sinnige
Schlichtheit der Auffassung auszeichnet, endlich von Hart-
mann-Maclean eine originelle lebensgroße Gruppe „Der
erste Pan", (ein bocksbeiniges Kerlchen, das an seiner
Mutter Brust liegt). Gute Bildnisbüsten stammen von
Arnold Kramer (Dichter Gjellerup), Richard König u. a.
Prof. Johannes Schilling hat neben einer hübschen Gruppe
„Heilquelle" im Stile seiner vier Tageszeitengruppen
auf der Brühlschen Terrasse zu Dresden und einer allzu
süßlichen Elfe im Schwanenwagen (als Brunnenschmuck),
eine lebensgroße Springbrunnenfigur — ein Mädchen
mit einem gefangenen Fisch — ausgestellt, die vermöge ihrer
charakteristischen Durchbildung volle Anerkennung verdient.
Auf dem Gebiete der Architektur ist der ernste und
kraftvolle Entwurf zu einem Geschäftshause von Schilling
und Gräbner besonders hervorzuheben.
Was die Beteiligung auswärtiger Künstler angeht,
so kann es hier nicht unsere Aufgabe sein, die zahlreichen
schon früher anderweit besprochenen tüchtigen Werke auf-
zuzählen. Es seien nur einige besonders bemerkenswerte
Gemälde genannt. Franz von Lenbach hat drei Bildnisse
(Helmholtz, Busch, Moltke) gesandt, Frithjof Smith das von
Ibsen, Liebermann das von Virchow, Aloys Erdtelt zwei
treffliche Herrenporträts. Als ein tüchtiger Charakteristiker
bekundet sich der Däne Leis Schjelderup durch das lebens-
große und lebensvolle Bildnis der kgl. Schauspielerin
Frau Betty Hennings. Von biblischen Bildern sind
namentlich vorhanden Uhdes „Bergpredigt" — daneben
von demselben Künstler das ergreifende und farbig fein
empfundene Bild eines weinenden Mädchens — dann
der „Gang zur heiligen Familie" und die „Flucht nach
Ägypten" von Willy Spatz in Düsseldorf, eine stilstrenge
aber individuell durchgebildete und malerisch feine „Ver-
kündigung der Geburt Christi" von Franz und Cornelia
Paczka (Wagner) in Rom und „Jakobs Kampf mit dem
Engel" von Eduard von Gebhardt (die Traumanschauung
kommt allerdings darin nicht zu ihrem Rechte). Auf dem
Gebiete des Tierstücks ist Heinrich Zügel mit den beiden
mächtigen Bildern „Abend" und „Mittag", die den großen
Saal beherrschen, ausgezeichnet vertreten. Charakteristische
Landschaften finden sich u. a. von den beiden Achenbach,
Wenglein, G. von Bochmann, Darnaut, G. Öder, E. Dücker.
Unter den Genrebildern fallen auf: ein trefflicher alter
Defregger (Bauernjäger von 1884), ein ebenso trefflicher
alter Knaus (Dambrettspieler von 1864), ein besonders
feines Bild von Gotthard Kühl (Traurige Nachrichten),
ein Affenbild von Gabriel Max (die alte und die neue
Welt), zwei Kriegsbilder von Eichstädt und G. Koch,
endlich ein großes figurenreiches Bild „Die Taufe" von
O. Wolf. Von den Phantasiemalern sind mit bezeichnenden
Bildern vertreten: Thoma, Stuck, Ludwig von Hofmann,
Sandreuter und Müller-Schönefeld. Ein großes, besonders
Die akademische Kunstausstellung in Dresden.
Tage. Es sind vielmehr von auswärts meist Bilder und
Bildwerke eingesendet worden, die in den letzten Jahren
in den Kunstausstellungen zu München, Berlin und Tüssel-
dors zu sehen waren und noch keinen Käufer gefunden
haben. Man wird der Ausstellung daher im ganzen
nur eine örtliche Bedeutung zuschreiben können, während
den Aquarellausstellungen der Kunstgenossenschaft, die in
den letzten Jahren stattgefunden haben, allerdings eine
weit höhere Bedeutung innewohnte. Jedenfalls werden
die Veranstalter der Ausstellung die diesjährigen Erfah-
rungen beherzigen, wenn anders ihnen überhaupt daran
liegt, daß Dresdens Ausstellungen in die erste Reihe
dieser künstlerischen Veranstaltungen in Deutschland rücken.
Ein erfreuliches Ergebnis der Ausstellung ist, daß
die ernsten Bemühungen der jüngeren Künstlerschast
Dresdens, die Errungenschaften der modernen Kunst auch
hier heimisch zu machen und frisches Leben zu schaffen,
nicht vergeblich gewesen sind. Nicht nur, daß sie selbst
Werke ausgestellt haben, die von tüchtigem Naturstudium
und feiner Empfindung zeugen, auch die älteren Künstler
sind zu rüstigem Weiterschaffen angeregt worden. Eine
merkwürdige Überraschung bereitet der Bildnismaler Leon
Pohle den Kunstfreunden durch eine große Heideland-
schaft, die eine außergewöhnliche Kraft der Stimmung
auszeichnet. Daneben bekunden ein Paar Bildnisse —
darunter ein lebensgroßes des Akademie-Kurators Prinzen
Georg in ganzer Gestalt — lebendige Charakteristik und
sichere Haltung. Das Bild des Königs Albert von
Kops ist leider nicht sehr gelungen, dagegen finden
wir drei vortreffliche Bildnisse von starker reali-
stischer Kraft und sicherer Technik von Paul Kießling.
Ünter den jüngeren Dresdner Künstlern befinden sich eine
Reihe ausgesprochener Individualitäten. Von auffälligen
Absonderlichkeiten halten sie sich fern, ihr Feld ist meist
die intime Landschaft, hier aber bringen sie höchst acht-
bare Leistungen. Carl Bantzers „Rast im Schatten"
gehört in Bezug auf feine malerische Empfindung zu den
besten Landschaften der Ausstellung; gleiches gilt von
Paul Baums „Novemberstimmung", Robert Sterls
Schasbildern und Wilhelm Georg Ritters Frühlingsland-
schaften. Max Pietschmann malt mit mächtiger Leucht-
kraft grüne Wiesen im hellsten Sonnenglanz und nicht
minder geschickt die feinen Reflexe an nackten Körpern
im freien Lichte. Die Vorzüge seiner Malerei treten
besonders in dem Bilde „Adam und Eva im Garten
Eden" zu Tage. Von Georg Estler stammt ein gut
gemalter „Bergsturz", von Voigtländer-Tetzner ein hübsches
„Interieur", von Hans Täger ein „Hcrbstmorgen mit
einem schwimmenden Hirsch", von Alexander Stichart
eine humorvolle Bilderfolge zu Grimms Märchen „Der
Schmied von Jüterbogk". Georg Lührig, der in seinen
14 Totentanzbildern eine so mächtige Phantasie und
eine so hervorragende realistische Darstellungskraft offen-
barte, zeigt in seinen vier Skizzen zum Frühlingsmythus
nach Motiven der Edda einen durchgebildeten Stil,
große Auffassung und volles Verständnis für monumentale
Wirkung. Schließlich sind von der freien Vereinigung
bildender Künstler Dresdens noch Karl und Emilie Pelikan
Mediz sowie Hermann Freye zu nennen. Von den elfteren
beiden rühren eigenartige poetische Landschaften mit
Staffage her, von letzterem die fein durchgebildeten
Zeichnungen der individuell aufgefaßten Gestalten von
Christus und den zwölf Aposteln.
Unter den jüngeren Dresdener Bildhauern steht
Friedrich Offermann in erster Linie mit zwei lebens-
großen Figuren „Meuchelmörder an einer Blume riechend"
und „Der Schnitter Tod". Beide sind von energischer
Charakteristik, von trefflichster Durchbildung und durch
geschickte Farbentönung in ihrer Wirkung glücklich ver-
stärkt. Ferner sehen wir von Bruno Fischer die mehr-
fach erwähnte Figur der Justitia für den neuen Dresdener
Gerechtigkcitsbrunnen, von Gröne das markige Standbild
Otto des Reichen für den Marktplatz in Freiberg, von
dem talentvollen Peter Pöppelmann ein „Singendes
Mädchen", welches Werk sich namentlich durch die sinnige
Schlichtheit der Auffassung auszeichnet, endlich von Hart-
mann-Maclean eine originelle lebensgroße Gruppe „Der
erste Pan", (ein bocksbeiniges Kerlchen, das an seiner
Mutter Brust liegt). Gute Bildnisbüsten stammen von
Arnold Kramer (Dichter Gjellerup), Richard König u. a.
Prof. Johannes Schilling hat neben einer hübschen Gruppe
„Heilquelle" im Stile seiner vier Tageszeitengruppen
auf der Brühlschen Terrasse zu Dresden und einer allzu
süßlichen Elfe im Schwanenwagen (als Brunnenschmuck),
eine lebensgroße Springbrunnenfigur — ein Mädchen
mit einem gefangenen Fisch — ausgestellt, die vermöge ihrer
charakteristischen Durchbildung volle Anerkennung verdient.
Auf dem Gebiete der Architektur ist der ernste und
kraftvolle Entwurf zu einem Geschäftshause von Schilling
und Gräbner besonders hervorzuheben.
Was die Beteiligung auswärtiger Künstler angeht,
so kann es hier nicht unsere Aufgabe sein, die zahlreichen
schon früher anderweit besprochenen tüchtigen Werke auf-
zuzählen. Es seien nur einige besonders bemerkenswerte
Gemälde genannt. Franz von Lenbach hat drei Bildnisse
(Helmholtz, Busch, Moltke) gesandt, Frithjof Smith das von
Ibsen, Liebermann das von Virchow, Aloys Erdtelt zwei
treffliche Herrenporträts. Als ein tüchtiger Charakteristiker
bekundet sich der Däne Leis Schjelderup durch das lebens-
große und lebensvolle Bildnis der kgl. Schauspielerin
Frau Betty Hennings. Von biblischen Bildern sind
namentlich vorhanden Uhdes „Bergpredigt" — daneben
von demselben Künstler das ergreifende und farbig fein
empfundene Bild eines weinenden Mädchens — dann
der „Gang zur heiligen Familie" und die „Flucht nach
Ägypten" von Willy Spatz in Düsseldorf, eine stilstrenge
aber individuell durchgebildete und malerisch feine „Ver-
kündigung der Geburt Christi" von Franz und Cornelia
Paczka (Wagner) in Rom und „Jakobs Kampf mit dem
Engel" von Eduard von Gebhardt (die Traumanschauung
kommt allerdings darin nicht zu ihrem Rechte). Auf dem
Gebiete des Tierstücks ist Heinrich Zügel mit den beiden
mächtigen Bildern „Abend" und „Mittag", die den großen
Saal beherrschen, ausgezeichnet vertreten. Charakteristische
Landschaften finden sich u. a. von den beiden Achenbach,
Wenglein, G. von Bochmann, Darnaut, G. Öder, E. Dücker.
Unter den Genrebildern fallen auf: ein trefflicher alter
Defregger (Bauernjäger von 1884), ein ebenso trefflicher
alter Knaus (Dambrettspieler von 1864), ein besonders
feines Bild von Gotthard Kühl (Traurige Nachrichten),
ein Affenbild von Gabriel Max (die alte und die neue
Welt), zwei Kriegsbilder von Eichstädt und G. Koch,
endlich ein großes figurenreiches Bild „Die Taufe" von
O. Wolf. Von den Phantasiemalern sind mit bezeichnenden
Bildern vertreten: Thoma, Stuck, Ludwig von Hofmann,
Sandreuter und Müller-Schönefeld. Ein großes, besonders