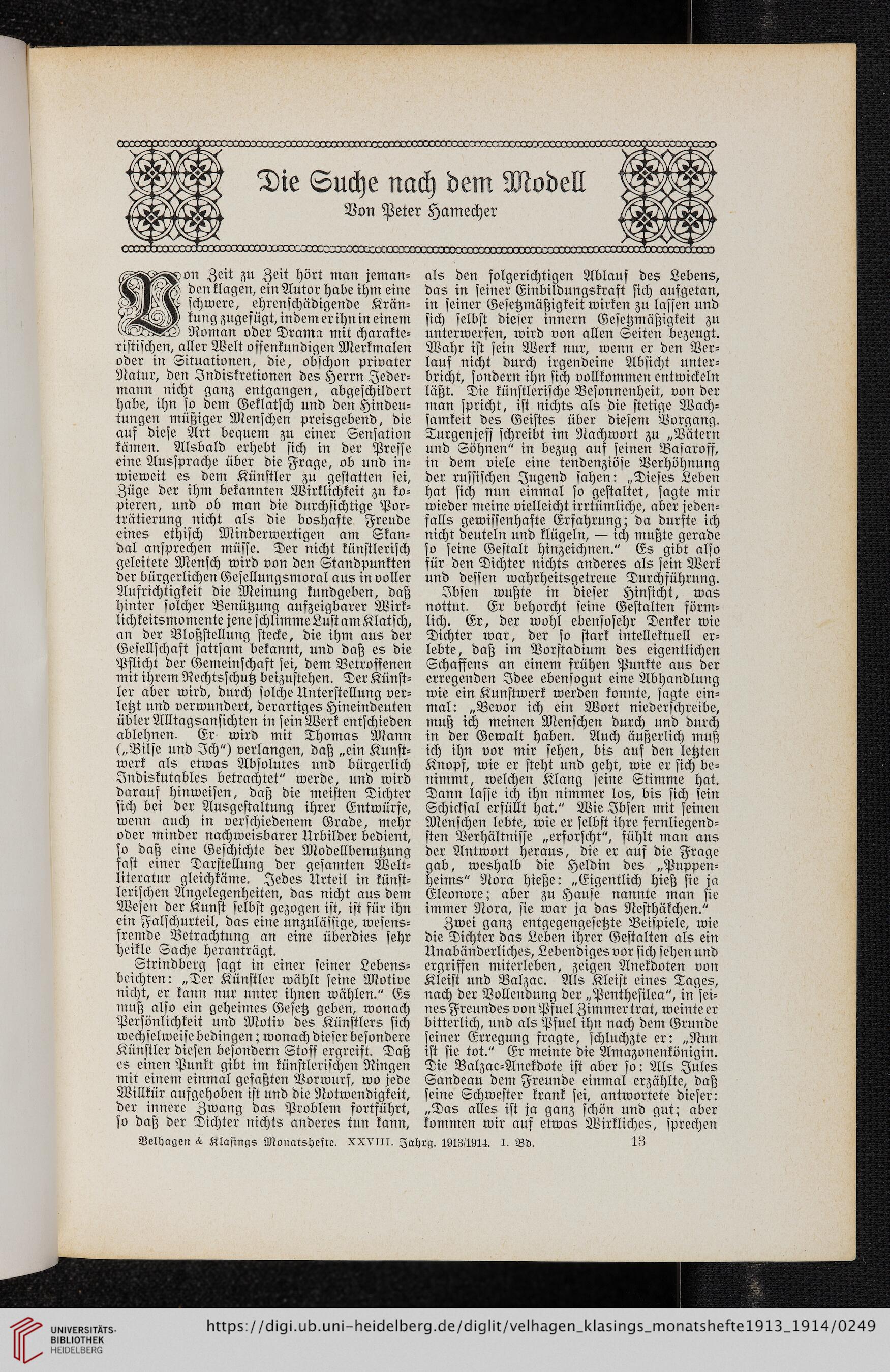Von Peter Hamecher
MKMO
Die Suche nach dem Modell
Zeit zu Zeit hört man jeman-
den klagen, ein Autor habe ihm eine
schwere, ehrenschädigende Kran-
kung zugefügt, indem er ihn in einem
Roman oder Drama mit charakte-
ristischen, aller Welt offenkundigen Merkmalen
oder in Situationen, die, obschon privater
Natur, den Indiskretionen des Herrn Jeder-
mann nicht ganz entgangen, abgeschildert
habe, ihn so dem Geklatsch und den Hindeu-
tungen müßiger Menschen preisgebend, die
auf diese Art bequem zu einer Sensation
kämen. Alsbald erhebt sich in der Presse
eine Aussprache über die Frage, ob und in-
wieweit es dem Künstler zu gestatten sei,
Züge der ihm bekannten Wirklichkeit zu ko-
pieren, und ob man die durchsichtige Por-
trätierung nicht als die boshafte Freude
eines ethisch Minderwertigen am Skan-
dal ansprechen müsse. Der nicht künstlerisch
geleitete Mensch wird von den Standpunkten
der bürgerlichen Gesellungsmoral aus in voller
Aufrichtigkeit die Meinung kundgeben, daß
hinter solcher Benützung aufzeigbarer Wirk-
lichkeitsmomente jene schlimme Lust am Klatsch,
an der Bloßstellung stecke, die ihm aus der
Gesellschaft sattsam bekannt, und daß es die
Pflicht der Gemeinschaft sei, dem Betroffenen
mit ihrem Rechtsschutz beizustehen. Der Künst-
ler aber wird, durch solche Unterstellung ver-
letzt und verwundert, derartiges Hineindeuten
übler Alltagsansichten in sein Werk entschieden
ablehnen. Er wird mit Thomas Mann
(„Bilse und Ich") verlangen, daß „ein Kunst-
werk als etwas Absolutes und bürgerlich
Indiskutables betrachtet" werde, und wird
darauf Hinweisen, daß die meisten Dichter
sich bei der Ausgestaltung ihrer Entwürfe,
wenn auch in verschiedenem Grade, mehr
oder minder nachweisbarer Urbilder bedient,
so daß eine Geschichte der Modellbenutzung
fast einer Darstellung der gesamten Welt-
literatur gleichkäme. Jedes Urteil in künst-
lerischen Angelegenheiten, das nicht aus dem
Wesen der Kunst selbst gezogen ist, ist für ihn
ein Falschurteil, das eine unzulässige, wesens-
fremde Betrachtung an eine überdies sehr
heikle Sache heranträgt.
Strindberg sagt in einer seiner Lebens-
beichten: „Der Künstler wählt seine Motive
nicht, er kann nur unter ihnen wählen." Es
muß also ein geheimes Gesetz geben, wonach
Persönlichkeit und Motiv des Künstlers sich
wechselweise bedingen; wonach dieser besondere
Künstler diesen besonder» Stoff ergreift. Daß
es einen Punkt gibt im künstlerischen Ringen
mit einem einmal gefaßten Vorwurf, wo jede
Willkür aufgehoben ist und die Notwendigkeit,
der innere Zwang das Problem fortführt,
so daß der Dichter nichts anderes tun kann.
als den folgerichtigen Ablauf des Lebens,
das in seiner Einbildungskraft sich aufgetan,
in seiner Gesetzmäßigkeit wirken zu lassen und
sich selbst dieser inner» Gesetzmäßigkeit zu
unterwerfen, wird von allen Seiten bezeugt.
Wahr ist sein Werk nur, wenn er den Ver-
lauf nicht durch irgendeine Absicht unter-
bricht, sondern ihn sich vollkommen entwickeln
läßt. Die künstlerische Besonnenheit, von der
man spricht, ist nichts als die stetige Wach-
samkeit des Geistes über diesem Vorgang.
Turgenjeff schreibt im Nachwort zu „Vätern
und Söhnen" in bezug auf seinen Basaroff,
in dem viele eine tendenziöse Verhöhnung
der russischen Jugend sahen: „Dieses Leben
hat sich nun einmal so gestaltet, sagte mir
wieder meine vielleicht irrtümliche, aber jeden-
falls gewissenhafte Erfahrung; da durfte ich
nicht deuteln und klügeln, — ich mußte gerade
so seine Gestalt hinzeichnen." Es gibt also
für den Dichter nichts anderes als sein Werk
und dessen wahrheitsgetreue Durchführung.
Ibsen wußte in dieser Hinsicht, was
nottut. Er behorcht seine Gestalten förm-
lich. Er, der wohl ebensosehr Denker wie
Dichter war, der so stark intellektuell er-
lebte, daß im Vorstadium des eigentlichen
Schaffens an einem frühen Punkte aus der
erregenden Idee ebensogut eine Abhandlung
wie ein Kunstwerk werden konnte, sagte ein-
mal: „Bevor ich ein Wort niederschreibe,
muß ich meinen Menschen durch und durch
in der Gewalt haben. Auch äußerlich muß
ich ihn vor mir sehen, bis auf den letzten
Knopf, wie er steht und geht, wie er sich be-
nimmt, welchen Klang seine Stimme hat.
Dann lasse ich ihn nimmer los, bis sich sein
Schicksal erfüllt hat." Wie Ibsen mit seinen
Menschen lebte, wie er selbst ihre fernliegend-
sten Verhältnisse „erforscht", fühlt man aus
der Antwort heraus, die er auf die Frage
gab, weshalb die Heldin des „Puppen-
heims" Nora hieße: „Eigentlich hieß sie ja
Eleonore; aber zu Hause nannte man sie
immer Nora, sie war ja das Nesthäkchen."
Zwei ganz entgegengesetzte Beispiele, wie
die Dichter das Leben ihrer Gestalten als ein
Unabänderliches, Lebendiges vor sich sehen und
ergriffen miterleben, zeigen Anekdoten von
Kleist und Balzac. Als Kleist eines Tages,
nach der Vollendung der „Penthesilea", in sei-
nes Freundes von Pfuel Zimmer trat, weinte er
bitterlich, und als Pfuel ihn nach dem Grunde
seiner Erregung fragte, schluchzte er: „Nun
ist sie tot." Er meinte die Amazonenkönigin.
Die Balzac-Anekdote ist aber so: Als Jules
Sandeau dem Freunde einmal erzählte, daß
seine Schwester krank sei, antwortete dieser:
„Das alles ist ja ganz schön und gut; aber
kommen wir auf etwas Wirkliches, sprechen
13
Velhagen L Klasings Monatshefte. XXVIII. Jahrg. 1913/1914. I. Bb.
MKMO
Die Suche nach dem Modell
Zeit zu Zeit hört man jeman-
den klagen, ein Autor habe ihm eine
schwere, ehrenschädigende Kran-
kung zugefügt, indem er ihn in einem
Roman oder Drama mit charakte-
ristischen, aller Welt offenkundigen Merkmalen
oder in Situationen, die, obschon privater
Natur, den Indiskretionen des Herrn Jeder-
mann nicht ganz entgangen, abgeschildert
habe, ihn so dem Geklatsch und den Hindeu-
tungen müßiger Menschen preisgebend, die
auf diese Art bequem zu einer Sensation
kämen. Alsbald erhebt sich in der Presse
eine Aussprache über die Frage, ob und in-
wieweit es dem Künstler zu gestatten sei,
Züge der ihm bekannten Wirklichkeit zu ko-
pieren, und ob man die durchsichtige Por-
trätierung nicht als die boshafte Freude
eines ethisch Minderwertigen am Skan-
dal ansprechen müsse. Der nicht künstlerisch
geleitete Mensch wird von den Standpunkten
der bürgerlichen Gesellungsmoral aus in voller
Aufrichtigkeit die Meinung kundgeben, daß
hinter solcher Benützung aufzeigbarer Wirk-
lichkeitsmomente jene schlimme Lust am Klatsch,
an der Bloßstellung stecke, die ihm aus der
Gesellschaft sattsam bekannt, und daß es die
Pflicht der Gemeinschaft sei, dem Betroffenen
mit ihrem Rechtsschutz beizustehen. Der Künst-
ler aber wird, durch solche Unterstellung ver-
letzt und verwundert, derartiges Hineindeuten
übler Alltagsansichten in sein Werk entschieden
ablehnen. Er wird mit Thomas Mann
(„Bilse und Ich") verlangen, daß „ein Kunst-
werk als etwas Absolutes und bürgerlich
Indiskutables betrachtet" werde, und wird
darauf Hinweisen, daß die meisten Dichter
sich bei der Ausgestaltung ihrer Entwürfe,
wenn auch in verschiedenem Grade, mehr
oder minder nachweisbarer Urbilder bedient,
so daß eine Geschichte der Modellbenutzung
fast einer Darstellung der gesamten Welt-
literatur gleichkäme. Jedes Urteil in künst-
lerischen Angelegenheiten, das nicht aus dem
Wesen der Kunst selbst gezogen ist, ist für ihn
ein Falschurteil, das eine unzulässige, wesens-
fremde Betrachtung an eine überdies sehr
heikle Sache heranträgt.
Strindberg sagt in einer seiner Lebens-
beichten: „Der Künstler wählt seine Motive
nicht, er kann nur unter ihnen wählen." Es
muß also ein geheimes Gesetz geben, wonach
Persönlichkeit und Motiv des Künstlers sich
wechselweise bedingen; wonach dieser besondere
Künstler diesen besonder» Stoff ergreift. Daß
es einen Punkt gibt im künstlerischen Ringen
mit einem einmal gefaßten Vorwurf, wo jede
Willkür aufgehoben ist und die Notwendigkeit,
der innere Zwang das Problem fortführt,
so daß der Dichter nichts anderes tun kann.
als den folgerichtigen Ablauf des Lebens,
das in seiner Einbildungskraft sich aufgetan,
in seiner Gesetzmäßigkeit wirken zu lassen und
sich selbst dieser inner» Gesetzmäßigkeit zu
unterwerfen, wird von allen Seiten bezeugt.
Wahr ist sein Werk nur, wenn er den Ver-
lauf nicht durch irgendeine Absicht unter-
bricht, sondern ihn sich vollkommen entwickeln
läßt. Die künstlerische Besonnenheit, von der
man spricht, ist nichts als die stetige Wach-
samkeit des Geistes über diesem Vorgang.
Turgenjeff schreibt im Nachwort zu „Vätern
und Söhnen" in bezug auf seinen Basaroff,
in dem viele eine tendenziöse Verhöhnung
der russischen Jugend sahen: „Dieses Leben
hat sich nun einmal so gestaltet, sagte mir
wieder meine vielleicht irrtümliche, aber jeden-
falls gewissenhafte Erfahrung; da durfte ich
nicht deuteln und klügeln, — ich mußte gerade
so seine Gestalt hinzeichnen." Es gibt also
für den Dichter nichts anderes als sein Werk
und dessen wahrheitsgetreue Durchführung.
Ibsen wußte in dieser Hinsicht, was
nottut. Er behorcht seine Gestalten förm-
lich. Er, der wohl ebensosehr Denker wie
Dichter war, der so stark intellektuell er-
lebte, daß im Vorstadium des eigentlichen
Schaffens an einem frühen Punkte aus der
erregenden Idee ebensogut eine Abhandlung
wie ein Kunstwerk werden konnte, sagte ein-
mal: „Bevor ich ein Wort niederschreibe,
muß ich meinen Menschen durch und durch
in der Gewalt haben. Auch äußerlich muß
ich ihn vor mir sehen, bis auf den letzten
Knopf, wie er steht und geht, wie er sich be-
nimmt, welchen Klang seine Stimme hat.
Dann lasse ich ihn nimmer los, bis sich sein
Schicksal erfüllt hat." Wie Ibsen mit seinen
Menschen lebte, wie er selbst ihre fernliegend-
sten Verhältnisse „erforscht", fühlt man aus
der Antwort heraus, die er auf die Frage
gab, weshalb die Heldin des „Puppen-
heims" Nora hieße: „Eigentlich hieß sie ja
Eleonore; aber zu Hause nannte man sie
immer Nora, sie war ja das Nesthäkchen."
Zwei ganz entgegengesetzte Beispiele, wie
die Dichter das Leben ihrer Gestalten als ein
Unabänderliches, Lebendiges vor sich sehen und
ergriffen miterleben, zeigen Anekdoten von
Kleist und Balzac. Als Kleist eines Tages,
nach der Vollendung der „Penthesilea", in sei-
nes Freundes von Pfuel Zimmer trat, weinte er
bitterlich, und als Pfuel ihn nach dem Grunde
seiner Erregung fragte, schluchzte er: „Nun
ist sie tot." Er meinte die Amazonenkönigin.
Die Balzac-Anekdote ist aber so: Als Jules
Sandeau dem Freunde einmal erzählte, daß
seine Schwester krank sei, antwortete dieser:
„Das alles ist ja ganz schön und gut; aber
kommen wir auf etwas Wirkliches, sprechen
13
Velhagen L Klasings Monatshefte. XXVIII. Jahrg. 1913/1914. I. Bb.