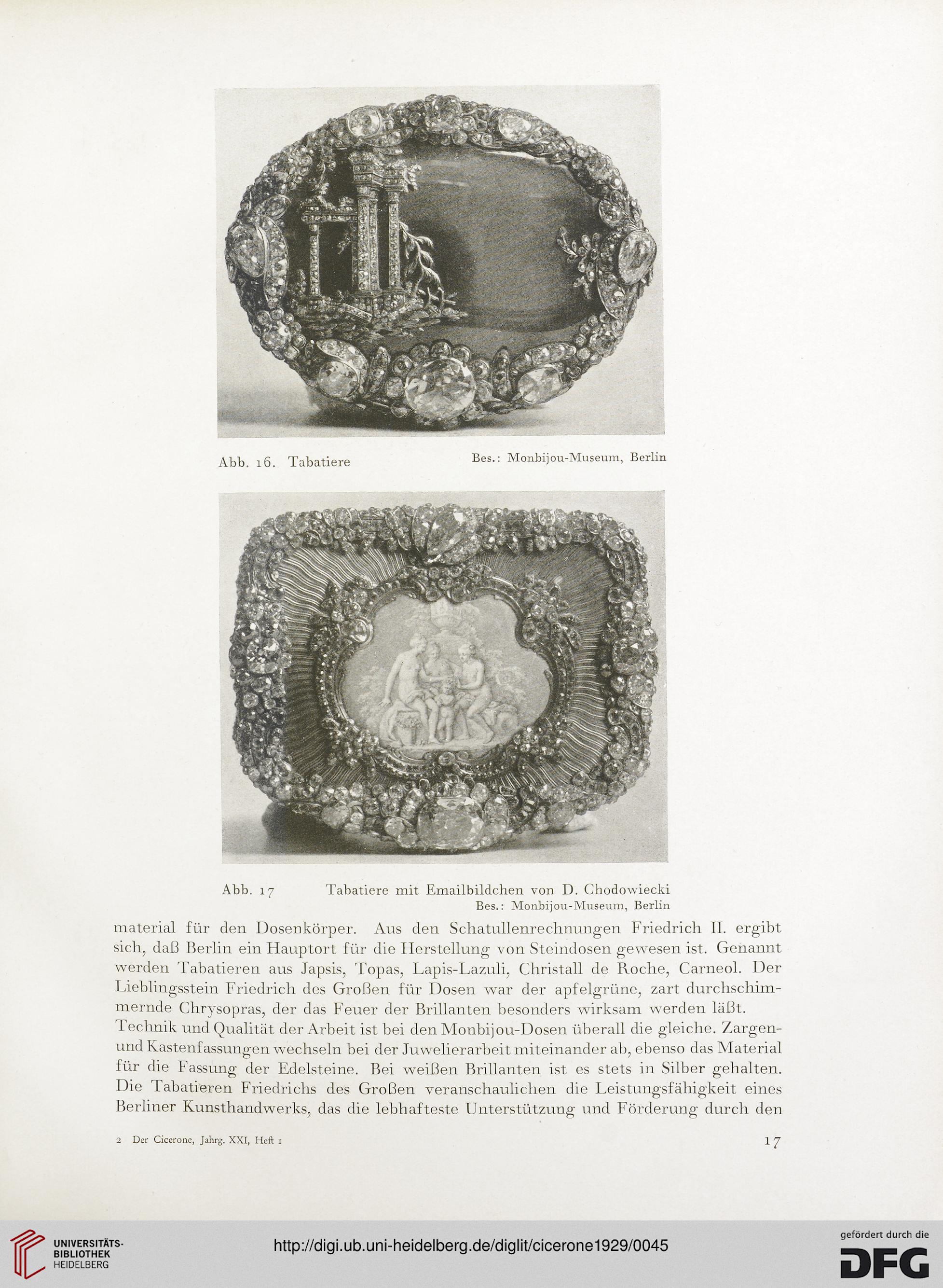Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 21.1929
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.41323#0045
DOI Heft:
Heft 1
DOI Artikel:Klar, Martin: Die Tabatieren Friedrichs des Grossen
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.41323#0045
Abb. 16. Tabatiere
Bes.: Monbijou-Museum, Berlin
Abb. 17 Tabatiere mit Emailbildchen von D. Chodowiecki
Bes.: Monbijou-Museum, Berlin
material für den Dosenkörper. Aus den Schatullenrechnungen Friedrich II. ergibt
sich, daß Berlin ein Hauptort für die Herstellung von Steindosen gewesen ist. Genannt
werden Tabatieren aus Japsis, Topas, Lapis-Lazuli, Christall de Roche, Carneol. Der
Lieblingsstein Friedrich des Großen für Dosen war der apfelgrüne, zart durchschim-
mernde Chrysopras, der das Feuer der Brillanten besonders wirksam werden läßt.
Technik und Qualität der Arbeit ist bei den Monbijou-Dosen überall die gleiche. Zargen-
und Kastenfassungen wechseln bei der Juwelierarbeit miteinander ab, ebenso das Material
für die Fassung der Edelsteine. Bei weißen Brillanten ist es stets in Silber gehalten.
Die Tabatieren Friedrichs des Großen veranschaulichen die Leistungsfähigkeit eines
Berliner Kunsthandwerks, das die lebhafteste Unterstützung und Förderung durch den
2 Der Cicerone, Jahrg. XXI, Heft 1
17
Bes.: Monbijou-Museum, Berlin
Abb. 17 Tabatiere mit Emailbildchen von D. Chodowiecki
Bes.: Monbijou-Museum, Berlin
material für den Dosenkörper. Aus den Schatullenrechnungen Friedrich II. ergibt
sich, daß Berlin ein Hauptort für die Herstellung von Steindosen gewesen ist. Genannt
werden Tabatieren aus Japsis, Topas, Lapis-Lazuli, Christall de Roche, Carneol. Der
Lieblingsstein Friedrich des Großen für Dosen war der apfelgrüne, zart durchschim-
mernde Chrysopras, der das Feuer der Brillanten besonders wirksam werden läßt.
Technik und Qualität der Arbeit ist bei den Monbijou-Dosen überall die gleiche. Zargen-
und Kastenfassungen wechseln bei der Juwelierarbeit miteinander ab, ebenso das Material
für die Fassung der Edelsteine. Bei weißen Brillanten ist es stets in Silber gehalten.
Die Tabatieren Friedrichs des Großen veranschaulichen die Leistungsfähigkeit eines
Berliner Kunsthandwerks, das die lebhafteste Unterstützung und Förderung durch den
2 Der Cicerone, Jahrg. XXI, Heft 1
17