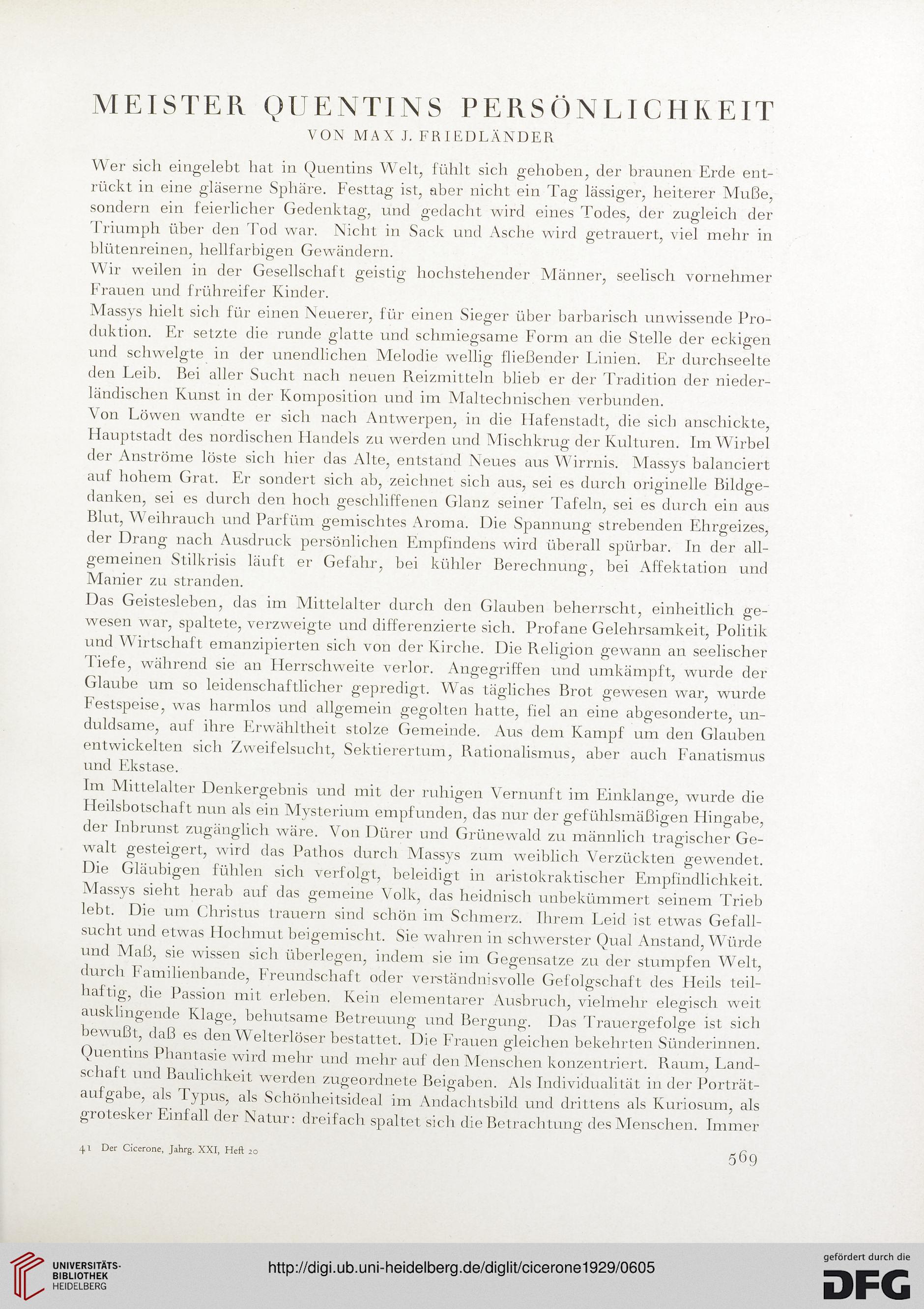MEISTER QUENTINS PERSÖNLICHKEIT
VON MAX J. FRIEDLÄNDER
Wer sich eingelebt hat in Quentins Welt, fühlt sich gehoben, der braunen Erde ent-
rückt in eine gläserne Sphäre. Festtag ist, aber nicht ein Tag lässiger, heiterer Muße,
sondern ein feierlicher Gedenktag, und gedacht wird eines Todes, der zugleich der
Triumph über den Tod war. Nicht in Sack und Asche wird getrauert, viel mehr in
blütenreinen, hellfarbigen Gewändern.
Wir weilen in der Gesellschaft geistig hochstehender Männer, seelisch vornehmer
Frauen und frühreifer Kinder.
Massys hielt sich für einen Neuerer, für einen Sieger über barbarisch unwissende Pro-
duktion. Er setzte die runde glatte und schmiegsame Form an die Stelle der eckigen
und schwelgte in der unendlichen Melodie wellig fließender Finien. Er durchseelte
den Feib. Bei aller Sucht nach neuen Reizmitteln blieb er der Tradition der nieder-
ländischen Kunst in der Komposition und im Maltechnischen verbunden.
Von Föwen wandte er sich nach Antwerpen, in die Hafenstadt, die sich anschickte,
Hauptstadt des nordischen Handels zu werden und Alischkrug der Kulturen. Im Wirbel
der Anströme löste sich hier das Alte, entstand Neues aus Wirrnis. Massys balanciert
auf hohem Grat. Er sondert sich ab, zeichnet sich aus, sei es durch originelle Bildge-
danken, sei es durch den hoch geschliffenen Glanz seiner Tafeln, sei es durch ein aus
Blut, Weihrauch und Parfüm gemischtes Aroma. Die Spannung strebenden Ehrgeizes,
der Drang nach Ausdruck persönlichen Empfindens wird überall spürbar. In der all-
gemeinen Stilkrisis läuft er Gefahr, bei kühler Berechnung, bei Affektation und
Manier zu stranden.
Das Geistesleben, das im Mittelalter durch den Glauben beherrscht, einheitlich ge-
wesen war, spaltete, verzweigte und differenzierte sich. Profane Gelehrsamkeit, Politik
und Wirtschaft emanzipierten sich von der Kirche. Die Religion gewann an seelischer
Tiefe, während sie an Herrschweite verlor. Angegriffen und umkämpft, wurde der
Glaube um so leidenschaftlicher gepredigt. Was tägliches Brot gewiesen war, wurde
Festspeise, was harmlos und allgemein gegolten hatte, fiel an eine abgesonderte, un-
duldsame, auf ihre Erwähltheit stolze Gemeinde. Aus dem Kampf um den Glauben
entwickelten sich Zweifelsucht, Sektierertum, Rationalismus, aber auch Fanatismus
und Ekstase.
Im Mittelalter Denkergebnis und mit der ruhigen Vernunft im Einklänge, wurde die
Heilsbotschaft nun als ein Mysterium empfunden, das nur der gefühlsmäßigen Hingabe,
der Inbrunst zugänglich wäre. Von Dürer und Grünewald zu männlich tragischer Ge-
walt gesteigert, wird das Pathos durch Massys zum weiblich Verzückten gewendet.
Die Gläubigen fühlen sich verfolgt, beleidigt in aristokraktischer Empfindlichkeit.
Massys sieht herab auf das gemeine Volk, das heidnisch unbekümmert seinem Trieb
lebt. Die um Christus trauern sind schön im Schmerz. Ihrem Leid ist etwas Gefall-
sucht und etwas Hochmut beigemischt. Sie wahren in schwerster Qual Anstand, Würde
und Maß, sie wissen sich überlegen, indem sie im Gegensätze zu der stumpfen Welt,
durch f amilienbande, Freundschaft oder verständnisvolle Gefolgschaft des Heils teil-
haftig, die Passion mit erleben. Kein elementarer Ausbruch, vielmehr elegisch weit
ausklingende Klage, behutsame Betreuung und Bergung. Das Trauergefolge ist sich
bewußt, daß es den Welterlöser bestattet. Die Frauen gleichen bekehrten Sünderinnen.
Quentins Phantasie wird mehr und mehr auf den Menschen konzentriert. Raum, Land-
schal t und Baulichkeit werden zugeordnete Beigaben. Als Individualität in der Porträt-
aufgabe, als Typus, als Schönheitsideal im Andachtsbild und drittens als Kuriosum, als
grotesker Einfall der Natur: dreifach spaltet sich die Betrachtung des Menschen. Immer
569
41 Der Cicerone, Jahrg. XXI, Heft 20
VON MAX J. FRIEDLÄNDER
Wer sich eingelebt hat in Quentins Welt, fühlt sich gehoben, der braunen Erde ent-
rückt in eine gläserne Sphäre. Festtag ist, aber nicht ein Tag lässiger, heiterer Muße,
sondern ein feierlicher Gedenktag, und gedacht wird eines Todes, der zugleich der
Triumph über den Tod war. Nicht in Sack und Asche wird getrauert, viel mehr in
blütenreinen, hellfarbigen Gewändern.
Wir weilen in der Gesellschaft geistig hochstehender Männer, seelisch vornehmer
Frauen und frühreifer Kinder.
Massys hielt sich für einen Neuerer, für einen Sieger über barbarisch unwissende Pro-
duktion. Er setzte die runde glatte und schmiegsame Form an die Stelle der eckigen
und schwelgte in der unendlichen Melodie wellig fließender Finien. Er durchseelte
den Feib. Bei aller Sucht nach neuen Reizmitteln blieb er der Tradition der nieder-
ländischen Kunst in der Komposition und im Maltechnischen verbunden.
Von Föwen wandte er sich nach Antwerpen, in die Hafenstadt, die sich anschickte,
Hauptstadt des nordischen Handels zu werden und Alischkrug der Kulturen. Im Wirbel
der Anströme löste sich hier das Alte, entstand Neues aus Wirrnis. Massys balanciert
auf hohem Grat. Er sondert sich ab, zeichnet sich aus, sei es durch originelle Bildge-
danken, sei es durch den hoch geschliffenen Glanz seiner Tafeln, sei es durch ein aus
Blut, Weihrauch und Parfüm gemischtes Aroma. Die Spannung strebenden Ehrgeizes,
der Drang nach Ausdruck persönlichen Empfindens wird überall spürbar. In der all-
gemeinen Stilkrisis läuft er Gefahr, bei kühler Berechnung, bei Affektation und
Manier zu stranden.
Das Geistesleben, das im Mittelalter durch den Glauben beherrscht, einheitlich ge-
wesen war, spaltete, verzweigte und differenzierte sich. Profane Gelehrsamkeit, Politik
und Wirtschaft emanzipierten sich von der Kirche. Die Religion gewann an seelischer
Tiefe, während sie an Herrschweite verlor. Angegriffen und umkämpft, wurde der
Glaube um so leidenschaftlicher gepredigt. Was tägliches Brot gewiesen war, wurde
Festspeise, was harmlos und allgemein gegolten hatte, fiel an eine abgesonderte, un-
duldsame, auf ihre Erwähltheit stolze Gemeinde. Aus dem Kampf um den Glauben
entwickelten sich Zweifelsucht, Sektierertum, Rationalismus, aber auch Fanatismus
und Ekstase.
Im Mittelalter Denkergebnis und mit der ruhigen Vernunft im Einklänge, wurde die
Heilsbotschaft nun als ein Mysterium empfunden, das nur der gefühlsmäßigen Hingabe,
der Inbrunst zugänglich wäre. Von Dürer und Grünewald zu männlich tragischer Ge-
walt gesteigert, wird das Pathos durch Massys zum weiblich Verzückten gewendet.
Die Gläubigen fühlen sich verfolgt, beleidigt in aristokraktischer Empfindlichkeit.
Massys sieht herab auf das gemeine Volk, das heidnisch unbekümmert seinem Trieb
lebt. Die um Christus trauern sind schön im Schmerz. Ihrem Leid ist etwas Gefall-
sucht und etwas Hochmut beigemischt. Sie wahren in schwerster Qual Anstand, Würde
und Maß, sie wissen sich überlegen, indem sie im Gegensätze zu der stumpfen Welt,
durch f amilienbande, Freundschaft oder verständnisvolle Gefolgschaft des Heils teil-
haftig, die Passion mit erleben. Kein elementarer Ausbruch, vielmehr elegisch weit
ausklingende Klage, behutsame Betreuung und Bergung. Das Trauergefolge ist sich
bewußt, daß es den Welterlöser bestattet. Die Frauen gleichen bekehrten Sünderinnen.
Quentins Phantasie wird mehr und mehr auf den Menschen konzentriert. Raum, Land-
schal t und Baulichkeit werden zugeordnete Beigaben. Als Individualität in der Porträt-
aufgabe, als Typus, als Schönheitsideal im Andachtsbild und drittens als Kuriosum, als
grotesker Einfall der Natur: dreifach spaltet sich die Betrachtung des Menschen. Immer
569
41 Der Cicerone, Jahrg. XXI, Heft 20