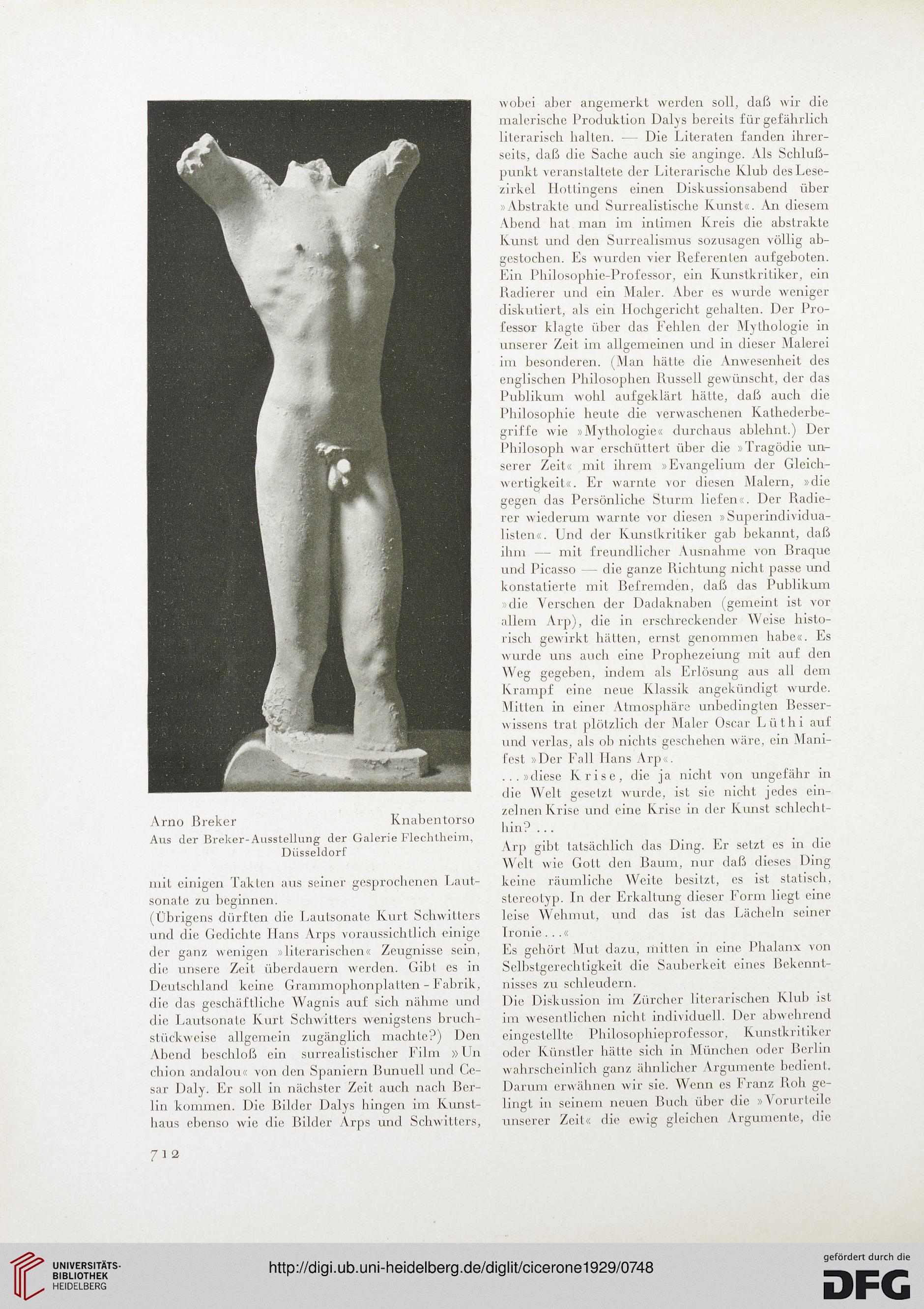Arno Breker Knabentorso
Aus der Breker-Ausstellung der Galerie Flechtheim,
Düsseldorf
mit einigen Takten aus seiner gesprochenen Laut-
sonate zu beginnen.
(Übrigens dürften die Lautsonate Kurt Schwitters
und die Gedichte Hans Arps voraussichtlich einige
der ganz wenigen »literarischen« Zeugnisse sein,
die unsere Zeit überdauern werden. Gibt es in
Deutschland keine Grammophonplatten - Fabrik,
die das geschäftliche Wagnis auf sich nähme und
die Lautsonate Kurt Schwitters wenigstens bruch-
stückweise allgemein zugänglich machte?) Den
Abend beschloß ein surrealistischer Film »Un
chion andalou« von den Spaniern Bunuell und Ce-
sar Daly. Er soll in nächster Zeit auch nach Ber-
lin kommen. Die Bilder Dalys hingen im Kunst-
haus ebenso wie die Bilder Arps und Schwitters,
wobei aber angemerkt werden soll, daß wir die
malerische Produktion Dalys bereits für gefährlich
literarisch halten. — Die Literaten fanden ihrer-
seits, daß die Sache auch sie anginge. Als Schluß-
punkt veranstaltete der Literarische Klub des Lese-
zirkel Hottingens einen Diskussionsabend über
»Abstrakte und Surrealistische Kunst«. An diesem
Abend hat man im intimen Kreis die abstrakte
Kunst und den Surrealismus sozusagen völlig ab-
gestochen. Es wurden vier Referenten aufgeboten.
Ein Philosophie-Professor, ein Kunstkritiker, ein
Radierer und ein Maler. Aber es wurde weniger
diskutiert, als ein Hochgericht gehalten. Der Pro-
fessor klagte über das Fehlen der Mythologie in
unserer Zeit im allgemeinen und in dieser Malerei
im besonderen. (Man hätte die Anwesenheit des
englischen Philosophen Russell gewünscht, der das
Publikum wohl aufgeklärt hätte, daß auch die
Philosophie heute die verwaschenen Kathederbe-
griffe wie »Mythologie« durchaus ablehnt.) Der
Philosoph war erschüttert über die »Tragödie un-
serer Zeit« mit ihrem »Evangelium der Gleich-
wertigkeit«. Er warnte vor diesen Malern, »die
gegen das Persönliche Sturm liefen«. Der Radie-
rer wiederum warnte vor diesen »Superindividua-
listen«. Und der Kunstkritiker gab bekannt, daß
ihm — mit freundlicher Ausnahme von Braque
und Picasso — die ganze Richtung nicht passe und
konstatierte mit Befremden, daß das Publikum
»die Versehen der Dadaknaben (gemeint ist vor
allem Arp), die in erschreckender Weise histo-
risch gewirkt hätten, ernst genommen habe«. Es
wurde uns auch eine Prophezeiung mit auf den
Weg gegeben, indem als Erlösung aus all dem
Krampf eine neue Klassik angekündigt wurde.
Mitten in einer Atmosphäre unbedingten Bessei’-
wissens trat plötzlich der Maler Oscar Lüthi auf
und verlas, als oh nichts geschehen wäre, ein Mani-
fest »Der Fall Hans Arp«.
...»diese Krise, die ja nicht von ungefähr in
die Welt gesetzt wurde, ist sie nicht jedes ein-
zelnen Krise und eine Krise in der Kirnst schlecht-
hin? ...
Arp gibt tatsächlich das Ding. Er setzt es in die
Welt wie Gott den Baum, nur daß dieses Ding
keine räumliche Weite besitzt, es ist statisch,
stereotyp. In der Erkaltung dieser Form liegt eine
leise Wehmut, und das ist das Lächeln seiner
Ironie . . .«
Es gehört Mut dazu, mitten in eine Phalanx von
Selbstgerechtigkeit die Sauberkeit eines Bekennt-
nisses zu schleudern.
Die Diskussion im Zürcher literarischen Klub ist
im wesentlichen nicht individuell. Der abwehrend
eingestellte Philosophieprofessor, Kunstkritiker
oder Künstler hätte sich in München oder Berlin
wahrscheinlich ganz ähnlicher Argumente bedient.
Darum erwähnen wir sie. Wenn es Franz Roh ge-
lingt in seinem neuen Buch über die »Vorurteile
unserer Zeit« die ewig gleichen Argumente, die