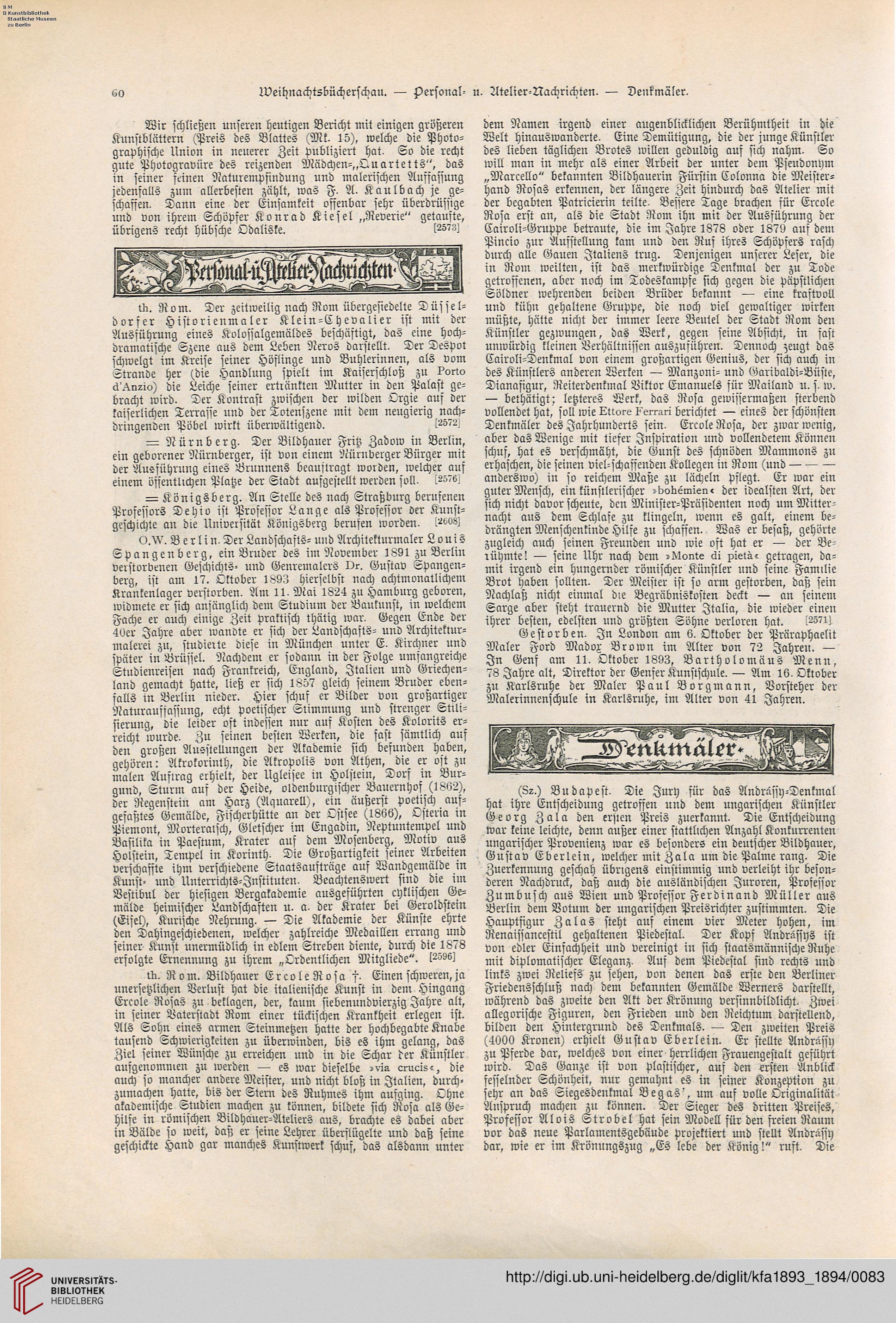60
Uleihnachtsbücherscbau. — Personal- u. Atelier-Nachrichten. — Denkmäler.
Wir schließen unseren heutigen Bericht mit einigen größeren
Kunstblättern (Preis des Blattes (Mk. 15), welche die Photo-
graphische Union in neuerer Zeit publiziert hat. So die recht
gute Photogravüre des reizenden Mädchen-,.Quartetts", das
in seiner seinen Naturempfindung und malerischen Auffassung
jedenfalls zum allerbesten zählt, was F. A. Kaulbach je ge-
schaffen. Dann eine der Einsamkeit offenbar sehr überdrüssige
und von ihrem Schöpfer Konrad Kiesel „Reverie" getaufte,
übrigens recht hübsche Odaliske. I2S78I
tb. Rom. Der zeitweilig nach Rom übergesiedelte Düssel-
dorfer Historienmaler Klein-Chevalier ist mit der
Ausführung eines Kvlossalgemäldes beschäftigt, das eine hoch-
dramatische Szene aus dem Leben Neros darstellt. Der Despot
schwelgt im Kreise seiner Höflinge und Buhlerinnen, als vom
Strande her (die Handlung spielt im Kaiserschloß zu Uorto
ü'Hurio) die Leiche seiner ertränkten Mutter in den Palast ge-
bracht wird. Der Kontrast zwischen der wilden Orgie auf der
kaiserlichen Terrasse und der Totenszene mit dem neugierig nach-
dringenden Pöbel wirkt überwältigend.
— Nürnberg. Der Bildhauer Fritz Zadow in Berlin,
ein geborener Nürnberger, ist von einem Nürnberger Bürger mit
der Ausführung eines Brunnens beaujlragt worden, welcher aus
einem öffentlichen Platze der Stadt ausgestellt werden soll, psrsf
— Königsberg. An Stelle des nach Straßburg berufenen
Professors Dehio ist Professor Lange als Professor der Kunst-
geschichte an die Universität Königsberg berufen worden. pbvH
0.1V. B erlin.Der Landschasts- und Architekturmaler Louis
Spangenberg, ein Bruder des im November 1891 zu Berlin
verstorbenen Gejchichls- und Genremalers 1>r. Gustav Spangen-
berg, ist am 17. Oktober 1893 Hierselbst nach achtmonatlichem
Krankenlager verstorben. Am 11. Mai 1824 zu Hamburg geboren,
widmete er sich ansänglich dem Studium der Baukunst, in welchem
Fache er auch einige Zeit praktisch thätig war. Gegen Ende der
40er Jahre aber wandte er sich der Landschafts- und Architektur-
malerei zu, studierte diese in München unter E. Kirchner und
später in Brüssel. Nachdem er sodann in der Folge umfangreiche
Studienreisen nach Frankreich, England, Italien und Griechen-
land gemacht hatte, ließ er sich 1857 gleich seinem Bruder eben-
falls in Berlin nieder. Hier schuf er Bilder von großartiger
Naturaufsassung, echt poetischer Stimmung und strenger Stili-
sierung, die leider oft indessen nur auf Kosten des Kolorits er-
reicht wurde. Zu seinen besten Werken, die fast sämtlich auf
den großen Ausstellungen der Akademie sich befunden haben,
gehören: Akrokorinth, die Akropolis von Athen, die er oft zu
malen Auftrag erhielt, der Ugleisee in Holstein, Dorf in Bur-
gund, Sturm auf der Heide, oldenburgischer Bauernhof (1862),
der Regenstein an, Harz (Aquarell), ein äußerst poetisch aus-
gefaßtes Gemälde, Fischerhütte an der Ostsee (1866), Osteria in
Piemont, Morteralsch, Gletscher im Engadin, Neptuntempel und
Basilika in Paestum, Krater auf dem Mosenberg, Motiv aus
Holstein, Tempel in Korinth. Die Großartigkeit seiner Arbeiten
verschaffte ihm verschiedene Staatsaufträge auf Wandgemälde in
Kunst- und Unterrichts-Instituten. Beachtenswert sind die im
Vestibül der hiesigen Bergakademie ausgeführten cyklischen Ge-
mälde heimischer Landschaften u. a. der Krater bei Geroldstein
(Eifel), Kurische Nehrung. — Die Akademie der Künste ehrte
den Dahingeschiedenen, welcher zahlreiche Medaillen errang und
seiner Kunst unermüdlich in edlem Streben diente, durch die 1878
ersolgte Ernennung zu ihrem „Ordentlichen Mitgliede". psse)
tb. Rom. Bildhauer Ercole Rosa ft. Einen schweren, ja
unersetzlichen Verlust hat die italienische Kunst in dem Hingang
Ercole Rosas zu beklagen, der, kaum siebenundvierzig Jahre alt,
in seiner Vaterstadt Rom einer tückischen Krankheit erlegen ist.
Als Sohn eines armen Steinmetzen hatte der hochbegabte Knabe
tausend Schwierigkeiten zu überwinden, bis es ihm gelang, das
Ziel seiner Wünsche zu erreichen und in die Schar der Künstler
ausgenommen zu werden — es war dieselbe »via crucisc, die
auch so mancher andere Meister, und nicht bloß in Italien, durch-
zumachen hatte, bis der Stern des Ruhmes ihm aufging. Ohne
akademische Studien machen zu können, bildete sich Rosa als Ge-
hilfe in römischen Bildhauer-Ateliers aus, brachte es dabei aber
in Bälde so weit, daß er seine Lehrer überflügelte und daß seine
geschickte Hand gar manches Kunstwerk schuf, das alsdann unter
dem Namen irgend einer augenblicklichen Berühmtheit in die
Welt hinauswandcrle. Eine Demütigung, die der junge Künstler
des lieben täglichen Brotes willen geduldig auf sich nahm. So
will man in mehr als einer Arbeit der unter dem Pseudonym
„Marcello" bekannten Bildhauerin Fürstin Colonna die Meister-
hand Rosas erkennen, der längere Zeit hindurch das Atelier mit
der begabten Patricierin teilte Bessere Tage brachen für Ercole
Rosa erst an, als die Stadt Rom ihn mit der Ausführung der
Cairoli-Gruppe betraute, die im Jahre 1878 oder 1879 auf dem
Pincio zur Aufstellung kam und den Ruf ihres Schöpfers rasch
durch alle Gauen Italiens trug. Denjenigen unserer Leser, die
in Rom weilten, ist das merkwürdige Denkmal der zu Tode
getroffenen, aber noch im Todeskampse sich gegen die päpstlichen
Söldner wehrenden beiden Brüder bekannt — eine kraftvoll
und kühn gehaltene Gruppe, die noch viel gewaltiger wirken
müßte, hätte nicht der immer leere Beutel der Stadt Rom den
Künstler gezwungen, das Werk, gegen feine Absicht, in fast
unwürdig kleinen Verhältnissen auszuführen. Dennoch zeugt das
Cairoli-Denkmal von einem großartigen Genius, der sich auch in
des Künstlers anderen Werken — Manzoni- und Garibaldi-Büste,
Dianafigur, Reiterdenkmal Viktor Emanuels für Mailand u. s. w.
— bethätigt; letzteres Werk, das Rosa gewissermaßen sterbend
vollendet hat, soll wie Dtoi-e beri-aii berichtet —eines der schönsten
Denkmäler des Jahrhunderts sein. Ercole Rosa, der zwar wenig,
aber das Wenige mit tiefer Inspiration und vollendetem Können
schuf, hat es verschmäht, die Gunst des schnöden Mammons zu
erhaschen, die seinen viel-schaffenden Kollegen in Rom (und-
anderswo) in so reichem Maße zu lächeln Pflegt. Er mar ein
guter Mensch, ein künstlerischer »bollemieo« der idealsten Art, der
sich nicht davor scheute, den Minister-Präsidenten noch um Mitter-
nacht aus dem Schlafe zu klingeln, wenn es galt, einem be-
drängten Menfchenkinde Hilfe zu schaffen. Was er besaß, gehörte
zugleich auch seinen Freunden und wie oft hat er — der Be-
rühmte! — seine Uhr nach dem -dlcmte cki pieiä- getragen, da-
mit irgend ein hungernder römischer Künstler und seine Familie
Brot haben sollten. Der Meister ist so arm gestorben, daß sein
Nachlaß nicht einmal die Begräbniskosten deckt — an seinem
Sarge aber steht trauernd die Mutter Jtalia, die wieder einen
ihrer besten, edelsten und größten Söhne verloren hat. l2ö7iz
Gestorben. In London am 6. Oktober der Präraphaelit
Maler Ford Madox Brown im Alter von 72 Jahren. —
In Genf am 11. Oktober 1893, Bartholomäus Menn,
78 Jahre alt, Direktor der Genfer Kunstschule. — Am 16. Oktober
zu Karlsruhe der Maler Paul Borgmann, Vorsteher der
Malcrinnenschule in Karlsruhe, im Alter von 41 Jahren.
(Sr.) Budapest. Die Jury für das Andrässy-Denkmal
hat ihre Entscheidung getroffen und dem ungarischen Künstler
Georg Zala den ersten Preis zuerkannt. Die Entscheidung
war keine leichte, denn außer einer stattlichen Anzahl Konkurrenten
ungarischer Provenienz war es besonders ein deutscher Bildhauer,
Gustav Eberlein, welcher mit Zala um die Palme rang. Die
Zuerkennung geschah übrigens einstimmig und verleiht ihr beson-
deren Nachdruck, daß auch die ausländischen Juroren, Professor
Zumbusch aus Wien und Professor Ferdinand Müller aus
Berlin dem Votum der ungarischen Preisrichter zustimmten. Die
Hauptfigur Za las steht auf einem vier Meter hohen, im
Renaissancestil gehaltenen Piedestal. Der Kopf AndrLssys ist
von edler Einfachheit und vereinigt in sich staatsmännische Ruhe
mit diplomatischer Eleganz. Auf dem Piedestal sind rechts und
links zwei Reliefs zu sehen, von denen das erste den Berliner
Friedensschluß nach dem bekannten Gemälde Werners darstellt,
während das zweite den Akt der Krönung versinnbildlicht. Zwei
allegorische Figuren, den Frieden und den Reichtum darstellend,
bilden den Hintergrund des Denkmals. — Den zweiten Preis
(4600 Kronen) erhielt Gustav Eberlein. Er stellte Andrässy
zu Pferde dar, welches von einer herrlichen Frauengestalt geführt
wird. Das Ganze ist von Plastischer, auf den ersten Anblick
fesselnder Schönheit, nur gemahnt es in seiner Konzeption zu
sehr an das Siegesdcnkmal Begas', um auf volle Originalität
Anspruch machen zu können. Der Sieger des dritten Preises,
Professor Alois Strobel hat sein Modell für den freien Raum
vor das neue Parlamentsgebäude projektiert und stellt Andrässy
dar, wie er im Krönnngszug „Es lebe der König!" ruft. Die
Uleihnachtsbücherscbau. — Personal- u. Atelier-Nachrichten. — Denkmäler.
Wir schließen unseren heutigen Bericht mit einigen größeren
Kunstblättern (Preis des Blattes (Mk. 15), welche die Photo-
graphische Union in neuerer Zeit publiziert hat. So die recht
gute Photogravüre des reizenden Mädchen-,.Quartetts", das
in seiner seinen Naturempfindung und malerischen Auffassung
jedenfalls zum allerbesten zählt, was F. A. Kaulbach je ge-
schaffen. Dann eine der Einsamkeit offenbar sehr überdrüssige
und von ihrem Schöpfer Konrad Kiesel „Reverie" getaufte,
übrigens recht hübsche Odaliske. I2S78I
tb. Rom. Der zeitweilig nach Rom übergesiedelte Düssel-
dorfer Historienmaler Klein-Chevalier ist mit der
Ausführung eines Kvlossalgemäldes beschäftigt, das eine hoch-
dramatische Szene aus dem Leben Neros darstellt. Der Despot
schwelgt im Kreise seiner Höflinge und Buhlerinnen, als vom
Strande her (die Handlung spielt im Kaiserschloß zu Uorto
ü'Hurio) die Leiche seiner ertränkten Mutter in den Palast ge-
bracht wird. Der Kontrast zwischen der wilden Orgie auf der
kaiserlichen Terrasse und der Totenszene mit dem neugierig nach-
dringenden Pöbel wirkt überwältigend.
— Nürnberg. Der Bildhauer Fritz Zadow in Berlin,
ein geborener Nürnberger, ist von einem Nürnberger Bürger mit
der Ausführung eines Brunnens beaujlragt worden, welcher aus
einem öffentlichen Platze der Stadt ausgestellt werden soll, psrsf
— Königsberg. An Stelle des nach Straßburg berufenen
Professors Dehio ist Professor Lange als Professor der Kunst-
geschichte an die Universität Königsberg berufen worden. pbvH
0.1V. B erlin.Der Landschasts- und Architekturmaler Louis
Spangenberg, ein Bruder des im November 1891 zu Berlin
verstorbenen Gejchichls- und Genremalers 1>r. Gustav Spangen-
berg, ist am 17. Oktober 1893 Hierselbst nach achtmonatlichem
Krankenlager verstorben. Am 11. Mai 1824 zu Hamburg geboren,
widmete er sich ansänglich dem Studium der Baukunst, in welchem
Fache er auch einige Zeit praktisch thätig war. Gegen Ende der
40er Jahre aber wandte er sich der Landschafts- und Architektur-
malerei zu, studierte diese in München unter E. Kirchner und
später in Brüssel. Nachdem er sodann in der Folge umfangreiche
Studienreisen nach Frankreich, England, Italien und Griechen-
land gemacht hatte, ließ er sich 1857 gleich seinem Bruder eben-
falls in Berlin nieder. Hier schuf er Bilder von großartiger
Naturaufsassung, echt poetischer Stimmung und strenger Stili-
sierung, die leider oft indessen nur auf Kosten des Kolorits er-
reicht wurde. Zu seinen besten Werken, die fast sämtlich auf
den großen Ausstellungen der Akademie sich befunden haben,
gehören: Akrokorinth, die Akropolis von Athen, die er oft zu
malen Auftrag erhielt, der Ugleisee in Holstein, Dorf in Bur-
gund, Sturm auf der Heide, oldenburgischer Bauernhof (1862),
der Regenstein an, Harz (Aquarell), ein äußerst poetisch aus-
gefaßtes Gemälde, Fischerhütte an der Ostsee (1866), Osteria in
Piemont, Morteralsch, Gletscher im Engadin, Neptuntempel und
Basilika in Paestum, Krater auf dem Mosenberg, Motiv aus
Holstein, Tempel in Korinth. Die Großartigkeit seiner Arbeiten
verschaffte ihm verschiedene Staatsaufträge auf Wandgemälde in
Kunst- und Unterrichts-Instituten. Beachtenswert sind die im
Vestibül der hiesigen Bergakademie ausgeführten cyklischen Ge-
mälde heimischer Landschaften u. a. der Krater bei Geroldstein
(Eifel), Kurische Nehrung. — Die Akademie der Künste ehrte
den Dahingeschiedenen, welcher zahlreiche Medaillen errang und
seiner Kunst unermüdlich in edlem Streben diente, durch die 1878
ersolgte Ernennung zu ihrem „Ordentlichen Mitgliede". psse)
tb. Rom. Bildhauer Ercole Rosa ft. Einen schweren, ja
unersetzlichen Verlust hat die italienische Kunst in dem Hingang
Ercole Rosas zu beklagen, der, kaum siebenundvierzig Jahre alt,
in seiner Vaterstadt Rom einer tückischen Krankheit erlegen ist.
Als Sohn eines armen Steinmetzen hatte der hochbegabte Knabe
tausend Schwierigkeiten zu überwinden, bis es ihm gelang, das
Ziel seiner Wünsche zu erreichen und in die Schar der Künstler
ausgenommen zu werden — es war dieselbe »via crucisc, die
auch so mancher andere Meister, und nicht bloß in Italien, durch-
zumachen hatte, bis der Stern des Ruhmes ihm aufging. Ohne
akademische Studien machen zu können, bildete sich Rosa als Ge-
hilfe in römischen Bildhauer-Ateliers aus, brachte es dabei aber
in Bälde so weit, daß er seine Lehrer überflügelte und daß seine
geschickte Hand gar manches Kunstwerk schuf, das alsdann unter
dem Namen irgend einer augenblicklichen Berühmtheit in die
Welt hinauswandcrle. Eine Demütigung, die der junge Künstler
des lieben täglichen Brotes willen geduldig auf sich nahm. So
will man in mehr als einer Arbeit der unter dem Pseudonym
„Marcello" bekannten Bildhauerin Fürstin Colonna die Meister-
hand Rosas erkennen, der längere Zeit hindurch das Atelier mit
der begabten Patricierin teilte Bessere Tage brachen für Ercole
Rosa erst an, als die Stadt Rom ihn mit der Ausführung der
Cairoli-Gruppe betraute, die im Jahre 1878 oder 1879 auf dem
Pincio zur Aufstellung kam und den Ruf ihres Schöpfers rasch
durch alle Gauen Italiens trug. Denjenigen unserer Leser, die
in Rom weilten, ist das merkwürdige Denkmal der zu Tode
getroffenen, aber noch im Todeskampse sich gegen die päpstlichen
Söldner wehrenden beiden Brüder bekannt — eine kraftvoll
und kühn gehaltene Gruppe, die noch viel gewaltiger wirken
müßte, hätte nicht der immer leere Beutel der Stadt Rom den
Künstler gezwungen, das Werk, gegen feine Absicht, in fast
unwürdig kleinen Verhältnissen auszuführen. Dennoch zeugt das
Cairoli-Denkmal von einem großartigen Genius, der sich auch in
des Künstlers anderen Werken — Manzoni- und Garibaldi-Büste,
Dianafigur, Reiterdenkmal Viktor Emanuels für Mailand u. s. w.
— bethätigt; letzteres Werk, das Rosa gewissermaßen sterbend
vollendet hat, soll wie Dtoi-e beri-aii berichtet —eines der schönsten
Denkmäler des Jahrhunderts sein. Ercole Rosa, der zwar wenig,
aber das Wenige mit tiefer Inspiration und vollendetem Können
schuf, hat es verschmäht, die Gunst des schnöden Mammons zu
erhaschen, die seinen viel-schaffenden Kollegen in Rom (und-
anderswo) in so reichem Maße zu lächeln Pflegt. Er mar ein
guter Mensch, ein künstlerischer »bollemieo« der idealsten Art, der
sich nicht davor scheute, den Minister-Präsidenten noch um Mitter-
nacht aus dem Schlafe zu klingeln, wenn es galt, einem be-
drängten Menfchenkinde Hilfe zu schaffen. Was er besaß, gehörte
zugleich auch seinen Freunden und wie oft hat er — der Be-
rühmte! — seine Uhr nach dem -dlcmte cki pieiä- getragen, da-
mit irgend ein hungernder römischer Künstler und seine Familie
Brot haben sollten. Der Meister ist so arm gestorben, daß sein
Nachlaß nicht einmal die Begräbniskosten deckt — an seinem
Sarge aber steht trauernd die Mutter Jtalia, die wieder einen
ihrer besten, edelsten und größten Söhne verloren hat. l2ö7iz
Gestorben. In London am 6. Oktober der Präraphaelit
Maler Ford Madox Brown im Alter von 72 Jahren. —
In Genf am 11. Oktober 1893, Bartholomäus Menn,
78 Jahre alt, Direktor der Genfer Kunstschule. — Am 16. Oktober
zu Karlsruhe der Maler Paul Borgmann, Vorsteher der
Malcrinnenschule in Karlsruhe, im Alter von 41 Jahren.
(Sr.) Budapest. Die Jury für das Andrässy-Denkmal
hat ihre Entscheidung getroffen und dem ungarischen Künstler
Georg Zala den ersten Preis zuerkannt. Die Entscheidung
war keine leichte, denn außer einer stattlichen Anzahl Konkurrenten
ungarischer Provenienz war es besonders ein deutscher Bildhauer,
Gustav Eberlein, welcher mit Zala um die Palme rang. Die
Zuerkennung geschah übrigens einstimmig und verleiht ihr beson-
deren Nachdruck, daß auch die ausländischen Juroren, Professor
Zumbusch aus Wien und Professor Ferdinand Müller aus
Berlin dem Votum der ungarischen Preisrichter zustimmten. Die
Hauptfigur Za las steht auf einem vier Meter hohen, im
Renaissancestil gehaltenen Piedestal. Der Kopf AndrLssys ist
von edler Einfachheit und vereinigt in sich staatsmännische Ruhe
mit diplomatischer Eleganz. Auf dem Piedestal sind rechts und
links zwei Reliefs zu sehen, von denen das erste den Berliner
Friedensschluß nach dem bekannten Gemälde Werners darstellt,
während das zweite den Akt der Krönung versinnbildlicht. Zwei
allegorische Figuren, den Frieden und den Reichtum darstellend,
bilden den Hintergrund des Denkmals. — Den zweiten Preis
(4600 Kronen) erhielt Gustav Eberlein. Er stellte Andrässy
zu Pferde dar, welches von einer herrlichen Frauengestalt geführt
wird. Das Ganze ist von Plastischer, auf den ersten Anblick
fesselnder Schönheit, nur gemahnt es in seiner Konzeption zu
sehr an das Siegesdcnkmal Begas', um auf volle Originalität
Anspruch machen zu können. Der Sieger des dritten Preises,
Professor Alois Strobel hat sein Modell für den freien Raum
vor das neue Parlamentsgebäude projektiert und stellt Andrässy
dar, wie er im Krönnngszug „Es lebe der König!" ruft. Die