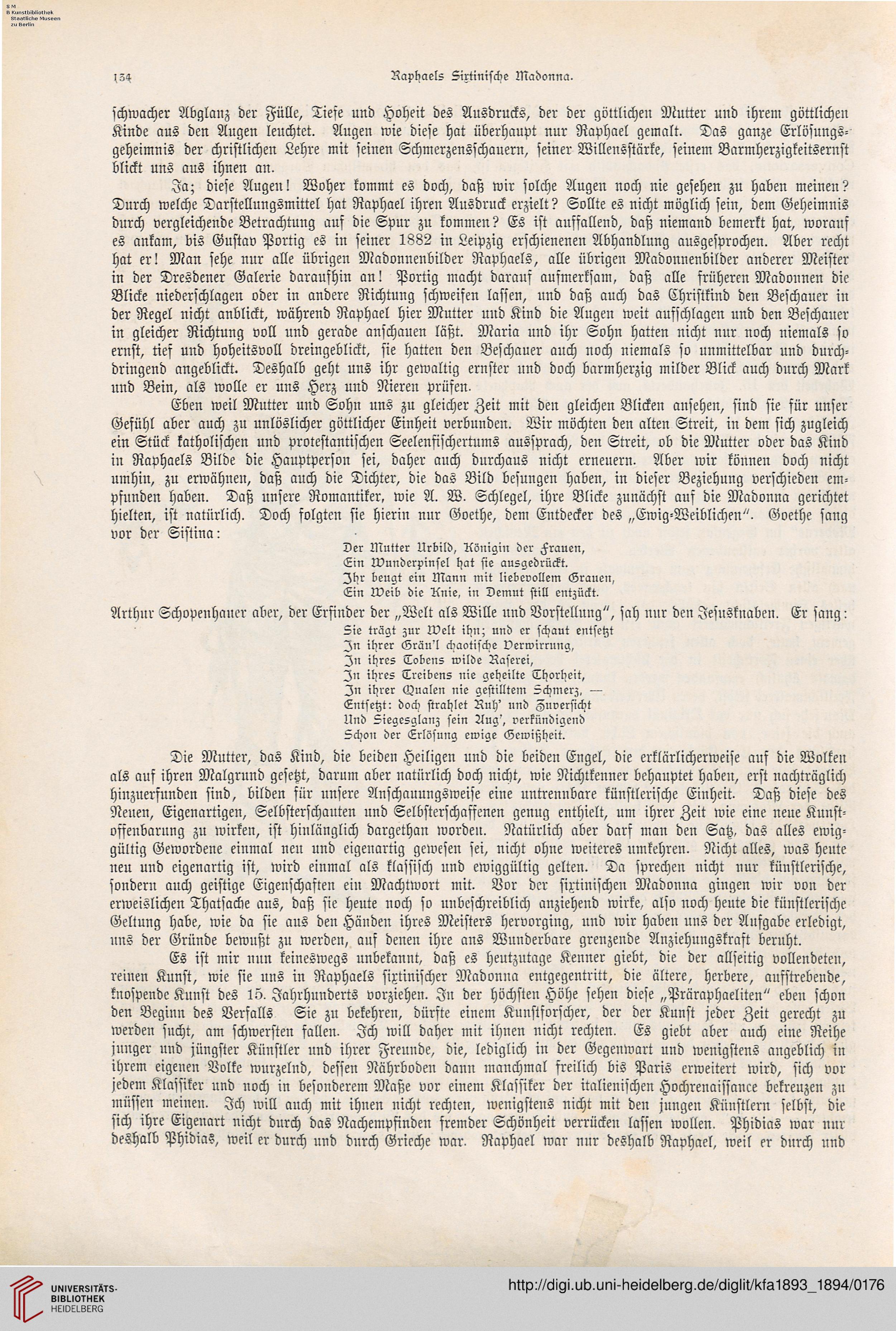Raphaels Sixtinische Madonna.
15,
schwacher Abglanz der Fülle, Tiefe und Hoheit des Ausdrucks, der der göttlichen Mutter uud ihrem göttlichen
Kinde aus den Augen leuchtet. Augen wie diese hat überhaupt nur Raphael gemalt. Das ganze Erlösungs-
geheimnis der christlichen Lehre mit seinen Schmerzensschauern, seiner Willensstärke, seinem Barmherzigkeitsernst
blickt uns aus ihnen an.
Ja; diese Augen! Woher kommt es doch, daß wir solche Augen noch nie gesehen zu haben meinen?
Durch welche Darstellungsmittel hat Raphael ihren Ausdruck erzielt? Sollte es nicht möglich sein, dem Geheimnis
durch vergleichende Betrachtung auf die Spur zu kommen? Es ist auffallend, daß niemand bemerkt hat, worauf
es ankam, bis Gustav Portig es in seiner 1882 in Leipzig erschienenen Abhandlung ausgesprochen. Aber recht
hat er! Man sehe nur alle übrigen Madonnenbilder Raphaels, alle übrigen Madonnenbilder anderer Meister
in der Dresdener Galerie daraufhin an! Portig macht darauf aufmerksam, daß alle früheren Madonnen die
Blicke Niederschlagen oder in andere Richtung schweifen lassen, und daß auch das Christkind den Beschauer in
der Regel nicht anblickt, während Raphael hier Mutter uud Kind die Augen weit aufschlagen und den Beschauer
in gleicher Richtung voll und gerade anschanen läßt. Maria und ihr Sohn hatten nicht nur noch niemals so
ernst, tief und hoheitsvoll dreingeblickt, sie hatten den Beschauer auch noch niemals so unmittelbar und durch-
dringend angeblickt. Deshalb geht uns ihr gewaltig ernster und doch barmherzig milder Blick auch durch Mark
und Bein, als wolle er uns Herz und Nieren prüfen.
Eben weil Mutter und Sohn uns zu gleicher Zeit mit den gleichen Blicken ansehen, sind sie für unser
Gefühl aber auch zu unlöslicher göttlicher Einheit verbunden. Wir möchten den alten Streit, in dem sich zugleich
ein Stück katholischen und protestantischen Seelenfischertums aussprach, den Streit, ob die Mutter oder das Kind
in Raphaels Bilde die Hauptperson sei, daher auch durchaus nicht erneuern. Aber wir können doch nicht
umhin, zu erwähnen, daß auch die Dichter, die das Bild besungen haben, in dieser Beziehung verschieden em-
pfunden haben. Daß unsere Romantiker, wie A. W. Schlegel, ihre Blicke zunächst auf die Madonna gerichtet
hielten, ist natürlich. Doch folgten sie hierin nur Goethe, dem Entdecker des „Ewig-Weiblichen". Goethe sang
vor der Sistina:
Der Mutter Urbild, Königin der Frauen,
Lin tvunderxinsel hat sie ausgedrückt.
Ihr beugt ein Mann mit liebevollem Grauen,
Lin Weib die Knie, in Demut still entzückt.
Arthur Schopenhauer aber, der Erfinder der „Welt als Wille und Vorstellung", sah nur den Jesusknaben. Er sang:
Sie trägt zur Welt ihn; und er schaut entsetzt
In ihrer Gräu'l chaotische Verwirrung,
In ihres Tobens wilde Raserei,
In ihres Treibens nie geheilte Thorheit,
In ihrer (Dualen nie gestilltem Schmerz, —
Lntsetzt: doch strahlet Ruh' und Zuversicht
Und Siegesglanz sein Aug', verkündigend
Schon der Erlösung ewige Gewißheit.
Die Mutter, das Kind, die beiden Heiligen und die beiden Engel, die erklärlicherweise auf die Wolken
als auf ihren Malgrund gesetzt, darum aber natürlich doch nicht, wie Nichtkenner behauptet haben, erst nachträglich
hinzuerfunden sind, bilden für unsere Anschauungsweise eine untrennbare künstlerische Einheit. Daß diese des
Neuen, Eigenartigen, Selbsterschauten und Selbsterschaffenen genug enthielt, um ihrer Zeit wie eine neue Kunst-
offenbarung zu wirken, ist hinlänglich dargethan worden. Natürlich aber darf man den Satz, das alles ewig-
gültig Gewordene einmal neu und eigenartig gewesen sei, nicht ohne weiteres umkehren. Nicht alles, was heute
neu und eigenartig ist, wird einmal als klassisch und ewiggültig gelten. Da sprechen nicht nur künstlerische,
sondern auch geistige Eigenschaften ein Machtwort mit. Vor der sixtinischen Madonna gingen wir von der
erweislichen Thatsackie aus, daß sie heute noch so unbeschreiblich anziehend wirke, also noch heute die künstlerische
Geltung habe, wie da sie aus den Händen ihres Meisters hervorging, und wir haben uns der Aufgabe erledigt,
uns der Gründe bewußt zu werden, auf denen ihre ans Wunderbare grenzende Anziehungskraft beruht.
Es ist mir nun keineswegs unbekannt, daß es heutzutage Kenner giebt, die der allseitig vollendeten,
reinen Kunst, wie sie uns in Raphaels sixtinischer Madonna entgegentritt, die ältere, herbere, aufstrebende,
knospende Kunst des 15. Jahrhunderts vorziehen. In der höchsten Höhe sehen diese „Präraphaeliten" eben schon
den Beginn des Verfalls Sie zu bekehren, dürfte einem Kunstforscher, der der Kunst jeder Zeit gerecht zu
werden sucht, am schwersten fallen. Ich will daher mit ihnen nicht rechten. Es giebt aber auch eine Reihe
junger und jüngster Künstler und ihrer Freunde, die, lediglich in der Gegenwart und wenigstens angeblich in
ihrem eigenen Volke wurzelnd, dessen Nährboden dann manchmal freilich bis Paris erweitert wird, sich vor
jedem Klassiker und noch in besonderem Maße vor einem Klassiker der italienischen Hochrenaissance bekreuzen zu
müssen meinen. Ich will auch mit ihnen nicht rechten, wenigstens nicht mit den jungen Künstlern selbst, die
sich ihre Eigenart nicht durch das Nachempfinden fremder Schönheit verrücken lassen wollen. Phidias war nur
deshalb Phidias, weil er durch und durch Grieche war. Raphael war nur deshalb Raphael, weil er durch und
15,
schwacher Abglanz der Fülle, Tiefe und Hoheit des Ausdrucks, der der göttlichen Mutter uud ihrem göttlichen
Kinde aus den Augen leuchtet. Augen wie diese hat überhaupt nur Raphael gemalt. Das ganze Erlösungs-
geheimnis der christlichen Lehre mit seinen Schmerzensschauern, seiner Willensstärke, seinem Barmherzigkeitsernst
blickt uns aus ihnen an.
Ja; diese Augen! Woher kommt es doch, daß wir solche Augen noch nie gesehen zu haben meinen?
Durch welche Darstellungsmittel hat Raphael ihren Ausdruck erzielt? Sollte es nicht möglich sein, dem Geheimnis
durch vergleichende Betrachtung auf die Spur zu kommen? Es ist auffallend, daß niemand bemerkt hat, worauf
es ankam, bis Gustav Portig es in seiner 1882 in Leipzig erschienenen Abhandlung ausgesprochen. Aber recht
hat er! Man sehe nur alle übrigen Madonnenbilder Raphaels, alle übrigen Madonnenbilder anderer Meister
in der Dresdener Galerie daraufhin an! Portig macht darauf aufmerksam, daß alle früheren Madonnen die
Blicke Niederschlagen oder in andere Richtung schweifen lassen, und daß auch das Christkind den Beschauer in
der Regel nicht anblickt, während Raphael hier Mutter uud Kind die Augen weit aufschlagen und den Beschauer
in gleicher Richtung voll und gerade anschanen läßt. Maria und ihr Sohn hatten nicht nur noch niemals so
ernst, tief und hoheitsvoll dreingeblickt, sie hatten den Beschauer auch noch niemals so unmittelbar und durch-
dringend angeblickt. Deshalb geht uns ihr gewaltig ernster und doch barmherzig milder Blick auch durch Mark
und Bein, als wolle er uns Herz und Nieren prüfen.
Eben weil Mutter und Sohn uns zu gleicher Zeit mit den gleichen Blicken ansehen, sind sie für unser
Gefühl aber auch zu unlöslicher göttlicher Einheit verbunden. Wir möchten den alten Streit, in dem sich zugleich
ein Stück katholischen und protestantischen Seelenfischertums aussprach, den Streit, ob die Mutter oder das Kind
in Raphaels Bilde die Hauptperson sei, daher auch durchaus nicht erneuern. Aber wir können doch nicht
umhin, zu erwähnen, daß auch die Dichter, die das Bild besungen haben, in dieser Beziehung verschieden em-
pfunden haben. Daß unsere Romantiker, wie A. W. Schlegel, ihre Blicke zunächst auf die Madonna gerichtet
hielten, ist natürlich. Doch folgten sie hierin nur Goethe, dem Entdecker des „Ewig-Weiblichen". Goethe sang
vor der Sistina:
Der Mutter Urbild, Königin der Frauen,
Lin tvunderxinsel hat sie ausgedrückt.
Ihr beugt ein Mann mit liebevollem Grauen,
Lin Weib die Knie, in Demut still entzückt.
Arthur Schopenhauer aber, der Erfinder der „Welt als Wille und Vorstellung", sah nur den Jesusknaben. Er sang:
Sie trägt zur Welt ihn; und er schaut entsetzt
In ihrer Gräu'l chaotische Verwirrung,
In ihres Tobens wilde Raserei,
In ihres Treibens nie geheilte Thorheit,
In ihrer (Dualen nie gestilltem Schmerz, —
Lntsetzt: doch strahlet Ruh' und Zuversicht
Und Siegesglanz sein Aug', verkündigend
Schon der Erlösung ewige Gewißheit.
Die Mutter, das Kind, die beiden Heiligen und die beiden Engel, die erklärlicherweise auf die Wolken
als auf ihren Malgrund gesetzt, darum aber natürlich doch nicht, wie Nichtkenner behauptet haben, erst nachträglich
hinzuerfunden sind, bilden für unsere Anschauungsweise eine untrennbare künstlerische Einheit. Daß diese des
Neuen, Eigenartigen, Selbsterschauten und Selbsterschaffenen genug enthielt, um ihrer Zeit wie eine neue Kunst-
offenbarung zu wirken, ist hinlänglich dargethan worden. Natürlich aber darf man den Satz, das alles ewig-
gültig Gewordene einmal neu und eigenartig gewesen sei, nicht ohne weiteres umkehren. Nicht alles, was heute
neu und eigenartig ist, wird einmal als klassisch und ewiggültig gelten. Da sprechen nicht nur künstlerische,
sondern auch geistige Eigenschaften ein Machtwort mit. Vor der sixtinischen Madonna gingen wir von der
erweislichen Thatsackie aus, daß sie heute noch so unbeschreiblich anziehend wirke, also noch heute die künstlerische
Geltung habe, wie da sie aus den Händen ihres Meisters hervorging, und wir haben uns der Aufgabe erledigt,
uns der Gründe bewußt zu werden, auf denen ihre ans Wunderbare grenzende Anziehungskraft beruht.
Es ist mir nun keineswegs unbekannt, daß es heutzutage Kenner giebt, die der allseitig vollendeten,
reinen Kunst, wie sie uns in Raphaels sixtinischer Madonna entgegentritt, die ältere, herbere, aufstrebende,
knospende Kunst des 15. Jahrhunderts vorziehen. In der höchsten Höhe sehen diese „Präraphaeliten" eben schon
den Beginn des Verfalls Sie zu bekehren, dürfte einem Kunstforscher, der der Kunst jeder Zeit gerecht zu
werden sucht, am schwersten fallen. Ich will daher mit ihnen nicht rechten. Es giebt aber auch eine Reihe
junger und jüngster Künstler und ihrer Freunde, die, lediglich in der Gegenwart und wenigstens angeblich in
ihrem eigenen Volke wurzelnd, dessen Nährboden dann manchmal freilich bis Paris erweitert wird, sich vor
jedem Klassiker und noch in besonderem Maße vor einem Klassiker der italienischen Hochrenaissance bekreuzen zu
müssen meinen. Ich will auch mit ihnen nicht rechten, wenigstens nicht mit den jungen Künstlern selbst, die
sich ihre Eigenart nicht durch das Nachempfinden fremder Schönheit verrücken lassen wollen. Phidias war nur
deshalb Phidias, weil er durch und durch Grieche war. Raphael war nur deshalb Raphael, weil er durch und