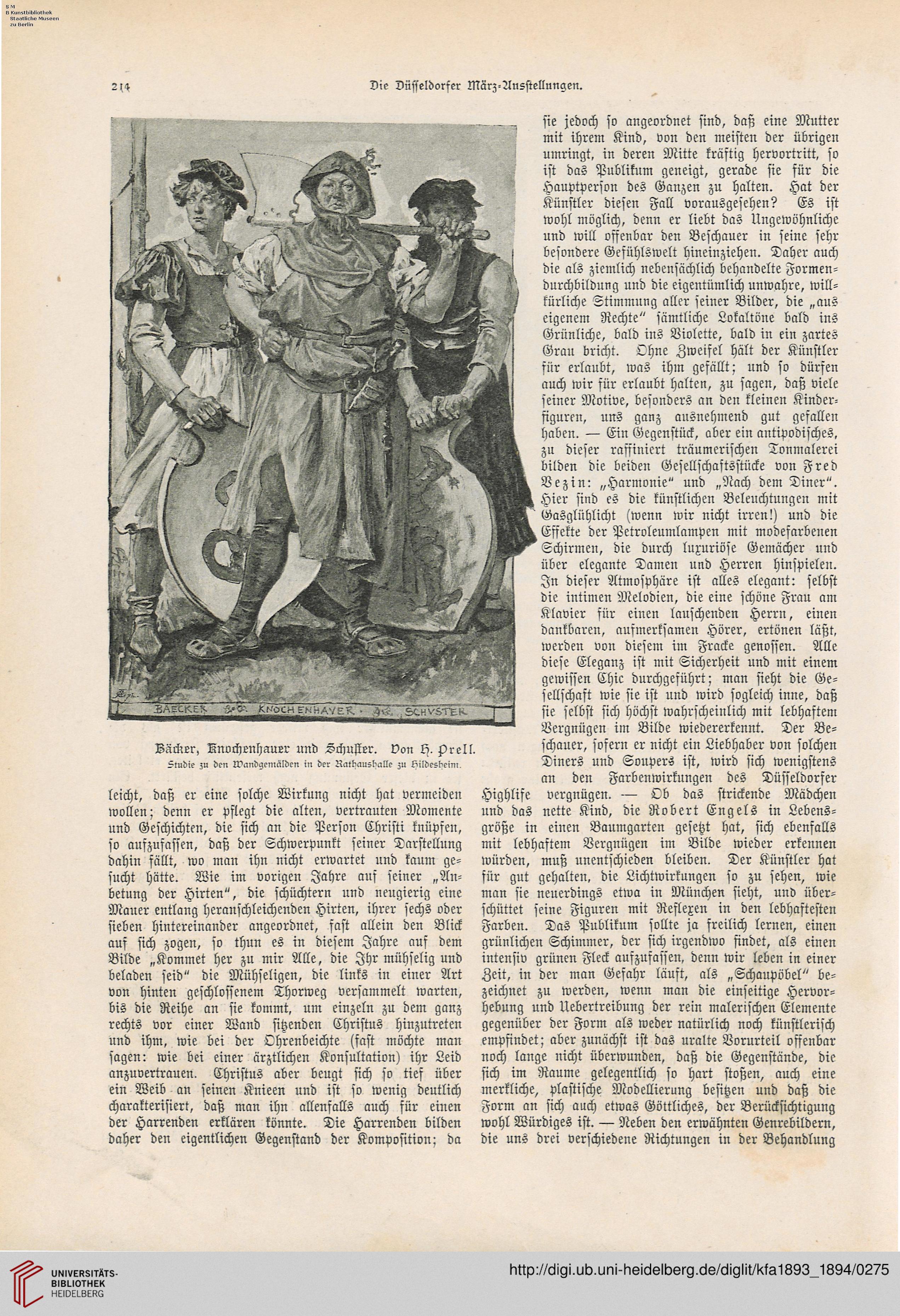214
Die Düsseldorfer März-Ausstellungen.
Bäcker, Lnochenhaurr und Schuger. von ks. Prell.
leicht, daß er eine solche Wirkung nicht hat vermeiden
wollen; denn er Pflegt die alten, vertrauten Momente
und Geschichten, die sich an die Person Christi knüpfen,
so aufzufassen, daß der Schwerpunkt seiner Darstellung
dahin fällt, wo man ihn nicht erwartet und kaum ge-
sucht hätte. Wie im vorigen Jahre ans seiner „An-
betung der Hirten", die schüchtern und neugierig eine
Mauer entlang heranschleichenden Hirten, ihrer sechs oder
sieben hintereinander angeordnet, fast allein den Blick
auf sich zogen, so thun es in diesem Jahre auf dem
Bilde „Kommet her zu mir Alle, die Ihr mühselig und
beladen seid" die Mühseligen, die links in einer Art
von hinten geschlossenem Thorweg versammelt warten,
bis die Reihe an sie kommt, um einzeln zu dem ganz
rechts vor einer Wand sitzenden Christus hinzutreten
und ihm, wie bei der Ohrenbeichte (fast möchte man
sagen: wie bei einer ärztlichen Konsultation) ihr Leid
anzuvertrauen. Christus aber beugt sich so tief über
ein Weib an seinen Knieen und ist so wenig deutlich
charakterisiert, daß man ihn allenfalls auch für einen
der Harrenden erklären könnte. Die Harrenden bilden
daher den eigentlichen Gegenstand der Komposition; da
sie jedoch so angeordnet sind, daß eine Mutter
mit ihrem Kind, von den meisten der übrigen
umringt, in deren Mitte kräftig hervortritt, so
ist das Publikum geneigt, gerade sie für die
Hauptperson des Ganzen zu halten. Hat der
Künstler diesen Fall vorausgesehen? Es ist
wohl möglich, denn er liebt das Ungewöhnliche
und will offenbar den Beschauer in seine sehr
besondere Gefühlswelt hineinziehen. Daher auch
die als ziemlich nebensächlich behandelte Formen-
durchbildung und die eigentümlich unwahre, will-
kürliche Stimmung aller seiner Bilder, die „aus
eigenem Rechte" sämtliche Lokaltöne bald ins
Grünliche, bald ins Violette, bald in ein zartes
Grau bricht. Ohne Zweifel hält der Künstler
für erlaubt, was ihm gefällt; und so dürfen
auch wir für erlaubt halten, zu sagen, daß viele
seiner Motive, besonders an den kleinen Kinder-
figuren, uns ganz ausnehmend gut gefallen
haben. — Ein Gegenstück, aber ein antipodisches,
zu dieser raffiniert träumerischen Tonmalerei
bilden die beiden Gesellschastsstücke von Fred
Vezin: „Harmonie" und „Nach dem Diner".
Hier sind es die künstlichen Beleuchtungen mit
Gasglühlicht (wenn wir nicht irren!) und die
Effekte der Petroleumlampen mit modefarbenen
Schirmen, die durch luxuriöse Gemächer und
über elegante Damen und Herren Hinspielen.
In dieser Atmosphäre ist alles elegant: selbst
die intimen Melodien, die eine schöne Frau am
Klavier für einen lauschenden Herrn, einen
dankbaren, aufmerksamen Hörer, ertönen läßt,
werden von diesem im Fracke genossen. Alle
diese Eleganz ist mit Sicherheit und mit einem
gewissen Chic durchgeführt; man sieht die Ge-
sellschaft wie sie ist und wird sogleich inne, daß
sie selbst sich höchst wahrscheinlich mit lebhaftem
Vergnügen im Bilde wiedererkennt. Der Be-
schauer, sofern er nicht ein Liebhaber von solchen
Diners und Soupers ist, wird sich wenigstens
an den Farbenwirkungen des Düsseldorfer
Highlife vergnügen. — Ob das strickende Mädchen
und das nette Kind, die Robert Engels in Lebens-
größe in einen Baumgarten gesetzt hat, sich ebenfalls
mit lebhaftem Vergnügen im Bilde wieder erkennen
würden, muß unentschieden bleiben. Der Künstler hat
für gut gehalten, die Lichtwirkungen so zu sehen, wie
man sie neuerdings etwa in München sieht, und über-
schüttet seine Figuren mit Reflexen in den lebhaftesten
Farben. Das Publikum sollte ja freilich lernen, einen
grünlichen Schimmer, der sich irgendwo findet, als einen
intensiv grünen Fleck aufzufassen, denn wir leben in einer
Zeit, in der man Gefahr läuft, als „Schaupöbel" be-
zeichnet zu werden, wenn man die einseitige Hervor-
hebung und Uebertreibung der rein malerischen Elemente
gegenüber der Form als weder natürlich noch künstlerisch
empfindet; aber zunächst ist das uralte Vorurteil offenbar
noch lange nicht überwunden, daß die Gegenstände, die
sich im Raume gelegentlich so hart stoßen, auch eine
merkliche, plastische Modellierung besitzen und daß die
Form an sich auch etwas Göttliches, der Berücksichtigung
wohl Würdiges ist. — Neben den erwähnten Genrebildern,
die uns drei verschiedene Richtungen in der Behandlung
Die Düsseldorfer März-Ausstellungen.
Bäcker, Lnochenhaurr und Schuger. von ks. Prell.
leicht, daß er eine solche Wirkung nicht hat vermeiden
wollen; denn er Pflegt die alten, vertrauten Momente
und Geschichten, die sich an die Person Christi knüpfen,
so aufzufassen, daß der Schwerpunkt seiner Darstellung
dahin fällt, wo man ihn nicht erwartet und kaum ge-
sucht hätte. Wie im vorigen Jahre ans seiner „An-
betung der Hirten", die schüchtern und neugierig eine
Mauer entlang heranschleichenden Hirten, ihrer sechs oder
sieben hintereinander angeordnet, fast allein den Blick
auf sich zogen, so thun es in diesem Jahre auf dem
Bilde „Kommet her zu mir Alle, die Ihr mühselig und
beladen seid" die Mühseligen, die links in einer Art
von hinten geschlossenem Thorweg versammelt warten,
bis die Reihe an sie kommt, um einzeln zu dem ganz
rechts vor einer Wand sitzenden Christus hinzutreten
und ihm, wie bei der Ohrenbeichte (fast möchte man
sagen: wie bei einer ärztlichen Konsultation) ihr Leid
anzuvertrauen. Christus aber beugt sich so tief über
ein Weib an seinen Knieen und ist so wenig deutlich
charakterisiert, daß man ihn allenfalls auch für einen
der Harrenden erklären könnte. Die Harrenden bilden
daher den eigentlichen Gegenstand der Komposition; da
sie jedoch so angeordnet sind, daß eine Mutter
mit ihrem Kind, von den meisten der übrigen
umringt, in deren Mitte kräftig hervortritt, so
ist das Publikum geneigt, gerade sie für die
Hauptperson des Ganzen zu halten. Hat der
Künstler diesen Fall vorausgesehen? Es ist
wohl möglich, denn er liebt das Ungewöhnliche
und will offenbar den Beschauer in seine sehr
besondere Gefühlswelt hineinziehen. Daher auch
die als ziemlich nebensächlich behandelte Formen-
durchbildung und die eigentümlich unwahre, will-
kürliche Stimmung aller seiner Bilder, die „aus
eigenem Rechte" sämtliche Lokaltöne bald ins
Grünliche, bald ins Violette, bald in ein zartes
Grau bricht. Ohne Zweifel hält der Künstler
für erlaubt, was ihm gefällt; und so dürfen
auch wir für erlaubt halten, zu sagen, daß viele
seiner Motive, besonders an den kleinen Kinder-
figuren, uns ganz ausnehmend gut gefallen
haben. — Ein Gegenstück, aber ein antipodisches,
zu dieser raffiniert träumerischen Tonmalerei
bilden die beiden Gesellschastsstücke von Fred
Vezin: „Harmonie" und „Nach dem Diner".
Hier sind es die künstlichen Beleuchtungen mit
Gasglühlicht (wenn wir nicht irren!) und die
Effekte der Petroleumlampen mit modefarbenen
Schirmen, die durch luxuriöse Gemächer und
über elegante Damen und Herren Hinspielen.
In dieser Atmosphäre ist alles elegant: selbst
die intimen Melodien, die eine schöne Frau am
Klavier für einen lauschenden Herrn, einen
dankbaren, aufmerksamen Hörer, ertönen läßt,
werden von diesem im Fracke genossen. Alle
diese Eleganz ist mit Sicherheit und mit einem
gewissen Chic durchgeführt; man sieht die Ge-
sellschaft wie sie ist und wird sogleich inne, daß
sie selbst sich höchst wahrscheinlich mit lebhaftem
Vergnügen im Bilde wiedererkennt. Der Be-
schauer, sofern er nicht ein Liebhaber von solchen
Diners und Soupers ist, wird sich wenigstens
an den Farbenwirkungen des Düsseldorfer
Highlife vergnügen. — Ob das strickende Mädchen
und das nette Kind, die Robert Engels in Lebens-
größe in einen Baumgarten gesetzt hat, sich ebenfalls
mit lebhaftem Vergnügen im Bilde wieder erkennen
würden, muß unentschieden bleiben. Der Künstler hat
für gut gehalten, die Lichtwirkungen so zu sehen, wie
man sie neuerdings etwa in München sieht, und über-
schüttet seine Figuren mit Reflexen in den lebhaftesten
Farben. Das Publikum sollte ja freilich lernen, einen
grünlichen Schimmer, der sich irgendwo findet, als einen
intensiv grünen Fleck aufzufassen, denn wir leben in einer
Zeit, in der man Gefahr läuft, als „Schaupöbel" be-
zeichnet zu werden, wenn man die einseitige Hervor-
hebung und Uebertreibung der rein malerischen Elemente
gegenüber der Form als weder natürlich noch künstlerisch
empfindet; aber zunächst ist das uralte Vorurteil offenbar
noch lange nicht überwunden, daß die Gegenstände, die
sich im Raume gelegentlich so hart stoßen, auch eine
merkliche, plastische Modellierung besitzen und daß die
Form an sich auch etwas Göttliches, der Berücksichtigung
wohl Würdiges ist. — Neben den erwähnten Genrebildern,
die uns drei verschiedene Richtungen in der Behandlung