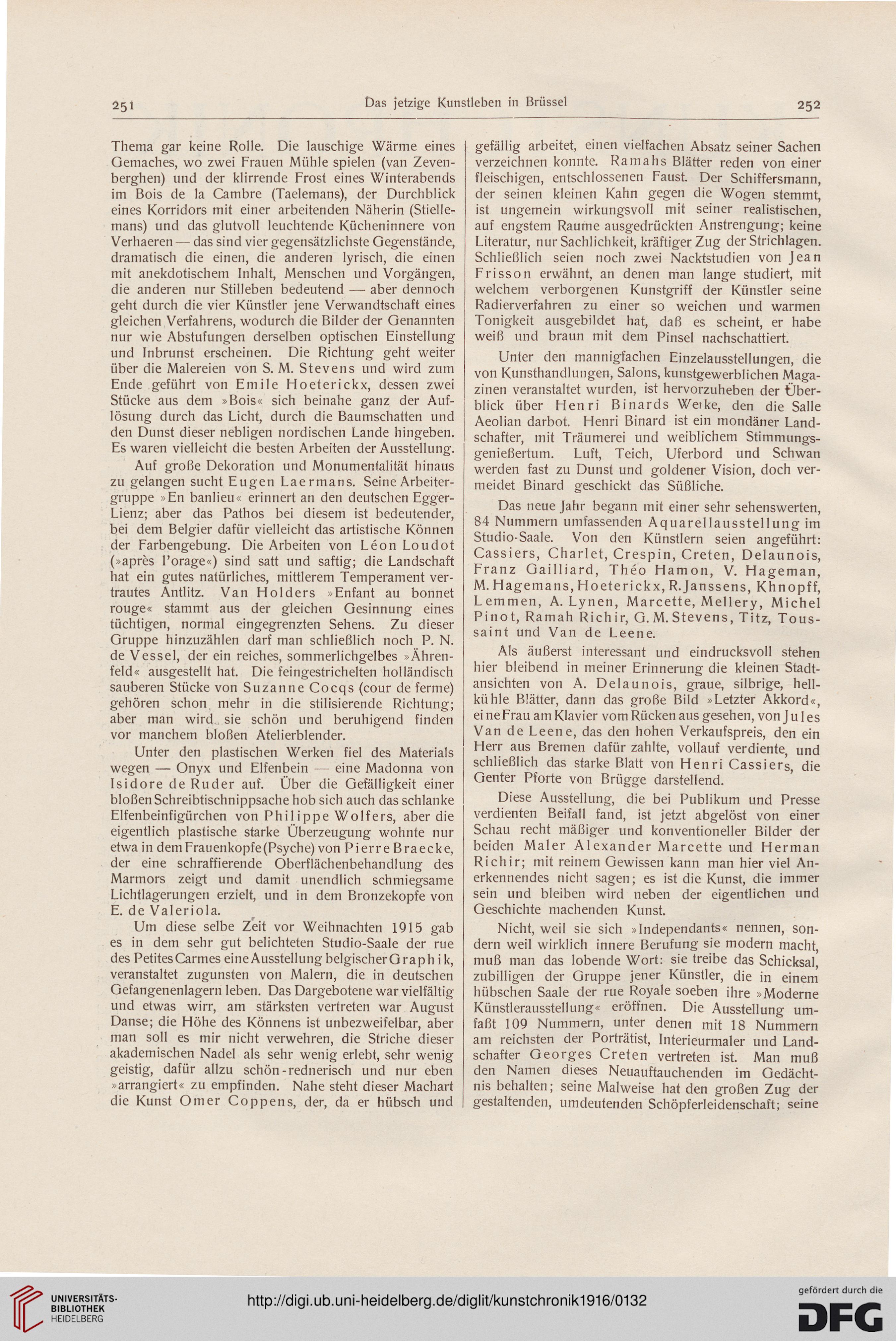251
Das jetzige Kunstleben in Brüssel
252
Thema gar keine Rolle. Die lauschige Wärme eines
Gemaches, wo zwei Frauen Mühle spielen (van Zeven-
berghen) und der klirrende Frost eines Winterabends
im Bois de la Cambre (Taelemans), der Durchblick
eines Korridors mit einer arbeitenden Näherin (Stielle-
mans) und das glutvoll leuchtende Kücheninnere von
Verhaeren — das sind vier gegensätzlichste Gegenstände,
dramatisch die einen, die anderen lyrisch, die einen
mit anekdotischem Inhalt, Menschen und Vorgängen,
die anderen nur Stilleben bedeutend — aber dennoch
geht durch die vier Künstler jene Verwandtschaft eines
gleichen Verfahrens, wodurch die Bilder der Genannten
nur wie Abstufungen derselben optischen Einstellung
und Inbrunst erscheinen. Die Richtung geht weiter
über die Malereien von S. M. Stevens und wird zum
Ende geführt von Emile Hoeterickx, dessen zwei
Stücke aus dem »Bois« sich beinahe ganz der Auf-
lösung durch das Licht, durch die Baumschatten und
den Dunst dieser nebligen nordischen Lande hingeben.
Es waren vielleicht die besten Arbeiten der Ausstellung.
Auf große Dekoration und Monumentalität hinaus
zu gelangen sucht Eugen Laermans. Seine Arbeiter-
gruppe »En banlieu« erinnert an den deutschen Egger-
Lienz; aber das Pathos bei diesem ist bedeutender,
bei dem Belgier dafür vielleicht das artistische Können
der Farbengebung. Die Arbeiten von Leon Loudot
(»apres l'orage«) sind satt und saftig; die Landschaft
hat ein gutes natürliches, mittlerem Temperament ver-
trautes Antlitz. Van Holders »Enfant au bonnet
rouge« stammt aus der gleichen Gesinnung eines
tüchtigen, normal eingegrenzten Sehens. Zu dieser
Gruppe hinzuzählen darf man schließlich noch P. N.
de Vessel, der ein reiches, sommerlichgelbes Ȁhren-
feld« ausgestellt hat. Die feingestrichelten holländisch
sauberen Stücke von Suzanne Cocqs (cour de ferme)
gehören schon mehr in die stilisierende Richtung;
aber man wird sie schön und beruhigend finden
vor manchem bloßen Atelierblender.
Unter den plastischen Werken fiel des Materials
wegen — Onyx und Elfenbein — eine Madonna von
Isidore de Ruder auf. Über die Gefälligkeit einer
bloßen Schreibtischnippsache hob sich auch das schlanke
Elfenbeinfigürchen von Philippe Wolfers, aber die
eigentlich plastische starke Überzeugung wohnte nur
etwa in dem Frauenkopfe (Psyche) von Pierre Bra ecke,
der eine schraffierende Oberflächenbehandlung des
Marmors zeigt und damit unendlich schmiegsame
Lichtlagerungen erzielt, und in dem Bronzekopfe von
E. de Valeriola.
Um diese selbe Zeit vor Weihnachten 1915 gab
es in dem sehr gut belichteten Studio-Saale der rue
des Petites Cannes eine Ausstellung belgischer Graph i k,
veranstaltet zugunsten von Malern, die in deutschen
Gefangenenlagern leben. Das Dargebotene war vielfältig
und etwas wirr, am stärksten vertreten war August
Danse; die Höhe des Könnens ist unbezweifelbar, aber
man soll es mir nicht verwehren, die Striche dieser
akademischen Nadel als sehr wenig erlebt, sehr wenig
geistig, dafür allzu schön-rednerisch und nur eben
»arrangiert« zu empfinden. Nahe steht dieser Machart
die Kunst Omer Coppens, der, da er hübsch und
gefällig arbeitet, einen vielfachen Absatz seiner Sachen
verzeichnen konnte. Ramahs Blätter reden von einer
fleischigen, entschlossenen Faust. Der Schiffersmann,
der seinen kleinen Kahn gegen die Wogen stemmt,
ist ungemein wirkungsvoll mit seiner realistischen,
auf engstem Räume ausgedrückten Anstrengung; keine
Literatur, nur Sachlichkeit, kräftiger Zug der Strichlagen.
Schließlich seien noch zwei Nacktstudien von Jean
Frisson erwähnt, an denen man lange studiert, mit
welchem verborgenen Kunstgriff der Künstler seine
Radierverfahren zu einer so weichen und warmen
Tonigkeit ausgebildet hat, daß es scheint, er habe
weiß und braun mit dem Pinsel nachschattiert.
Unter den mannigfachen Einzelausstellungen, die
von Kunsthandlungen, Salons, kunstgewerblichen Maga-
zinen veranstaltet wurden, ist hervorzuheben der Über-
blick über Henri Binards Wetke, den die Salle
Aeolian darbot. Henri Binard ist ein mondäner Land-
schafter, mit Träumerei und weiblichem Stimmungs-
genießertum. Luft, Teich, Uferbord und Schwan
werden fast zu Dunst und goldener Vision, doch ver-
meidet Binard geschickt das Süßliche.
Das neue Jahr begann mit einer sehr sehenswerten,
84 Nummern umfassenden Aquarellausstellung im
Studio-Saale. Von den Künstlern seien angeführt:
Cassiers, Charlet, Crespin, Creten, Delaunois,
Franz Gailliard, Theo Hamon, V. Hageman,
M. Hagemans, Hoeterickx, R.Janssens, Khnopff,
Lemmen, A. Lynen, Marcette, Mellery, Michel
Pinot, Ramah Rieh ir, G. M. Stevens, Titz, Tous-
saint und Van de Leene.
Als äußerst interessant und eindrucksvoll stehen
hier bleibend in meiner Erinnerung die kleinen Stadt-
ansichten von A. Delaunois, graue, silbrige, hell-
kühle Blätter, dann das große Bild »Letzter Akkord«,
eineFrau am Klavier vom Rücken ausgesehen, von Jules
Van de Leene, das den hohen Verkaufspreis, den ein
Herr aus Bremen dafür zahlte, vollauf verdiente, und
schließlich das starke Blatt von Henri Cassiers, die
Genter Pforte von Brügge darstellend.
Di ese Ausstellung, die bei Publikum und Presse
verdienten Beifall fand, ist jetzt abgelöst von einer
Schau recht mäßiger und konventioneller Bilder der
beiden Maler Alexander Marcette und Herman
Richir; mit reinem Gewissen kann man hier viel An-
erkennendes nicht sagen; es ist die Kunst, die immer
sein und bleiben wird neben der eigentlichen und
Geschichte machenden Kunst.
Nicht, weil sie sich »Independants« nennen, son-
dern weil wirklich innere Berufung sie modern macht,
muß man das lobende Wort: sie treibe das Schicksal,
zubilligen der Gruppe jener Künstler, die in einem
hübschen Saale der rue Royale soeben ihre »Moderne
Künstlerausstellung« eröffnen. Die Ausstellung um-
faßt 109 Nummern, unter denen mit 18 Nummern
am reichsten der Porträtist, Interieurmaler und Land-
schafter Georges Creten vertreten ist. Man muß
den Namen dieses Neuauftauchenden im Gedächt-
nis behalten; seine Malweise hat den großen Zug der
gestaltenden, umdeutenden Schöpferleidenschaft; seine
Das jetzige Kunstleben in Brüssel
252
Thema gar keine Rolle. Die lauschige Wärme eines
Gemaches, wo zwei Frauen Mühle spielen (van Zeven-
berghen) und der klirrende Frost eines Winterabends
im Bois de la Cambre (Taelemans), der Durchblick
eines Korridors mit einer arbeitenden Näherin (Stielle-
mans) und das glutvoll leuchtende Kücheninnere von
Verhaeren — das sind vier gegensätzlichste Gegenstände,
dramatisch die einen, die anderen lyrisch, die einen
mit anekdotischem Inhalt, Menschen und Vorgängen,
die anderen nur Stilleben bedeutend — aber dennoch
geht durch die vier Künstler jene Verwandtschaft eines
gleichen Verfahrens, wodurch die Bilder der Genannten
nur wie Abstufungen derselben optischen Einstellung
und Inbrunst erscheinen. Die Richtung geht weiter
über die Malereien von S. M. Stevens und wird zum
Ende geführt von Emile Hoeterickx, dessen zwei
Stücke aus dem »Bois« sich beinahe ganz der Auf-
lösung durch das Licht, durch die Baumschatten und
den Dunst dieser nebligen nordischen Lande hingeben.
Es waren vielleicht die besten Arbeiten der Ausstellung.
Auf große Dekoration und Monumentalität hinaus
zu gelangen sucht Eugen Laermans. Seine Arbeiter-
gruppe »En banlieu« erinnert an den deutschen Egger-
Lienz; aber das Pathos bei diesem ist bedeutender,
bei dem Belgier dafür vielleicht das artistische Können
der Farbengebung. Die Arbeiten von Leon Loudot
(»apres l'orage«) sind satt und saftig; die Landschaft
hat ein gutes natürliches, mittlerem Temperament ver-
trautes Antlitz. Van Holders »Enfant au bonnet
rouge« stammt aus der gleichen Gesinnung eines
tüchtigen, normal eingegrenzten Sehens. Zu dieser
Gruppe hinzuzählen darf man schließlich noch P. N.
de Vessel, der ein reiches, sommerlichgelbes Ȁhren-
feld« ausgestellt hat. Die feingestrichelten holländisch
sauberen Stücke von Suzanne Cocqs (cour de ferme)
gehören schon mehr in die stilisierende Richtung;
aber man wird sie schön und beruhigend finden
vor manchem bloßen Atelierblender.
Unter den plastischen Werken fiel des Materials
wegen — Onyx und Elfenbein — eine Madonna von
Isidore de Ruder auf. Über die Gefälligkeit einer
bloßen Schreibtischnippsache hob sich auch das schlanke
Elfenbeinfigürchen von Philippe Wolfers, aber die
eigentlich plastische starke Überzeugung wohnte nur
etwa in dem Frauenkopfe (Psyche) von Pierre Bra ecke,
der eine schraffierende Oberflächenbehandlung des
Marmors zeigt und damit unendlich schmiegsame
Lichtlagerungen erzielt, und in dem Bronzekopfe von
E. de Valeriola.
Um diese selbe Zeit vor Weihnachten 1915 gab
es in dem sehr gut belichteten Studio-Saale der rue
des Petites Cannes eine Ausstellung belgischer Graph i k,
veranstaltet zugunsten von Malern, die in deutschen
Gefangenenlagern leben. Das Dargebotene war vielfältig
und etwas wirr, am stärksten vertreten war August
Danse; die Höhe des Könnens ist unbezweifelbar, aber
man soll es mir nicht verwehren, die Striche dieser
akademischen Nadel als sehr wenig erlebt, sehr wenig
geistig, dafür allzu schön-rednerisch und nur eben
»arrangiert« zu empfinden. Nahe steht dieser Machart
die Kunst Omer Coppens, der, da er hübsch und
gefällig arbeitet, einen vielfachen Absatz seiner Sachen
verzeichnen konnte. Ramahs Blätter reden von einer
fleischigen, entschlossenen Faust. Der Schiffersmann,
der seinen kleinen Kahn gegen die Wogen stemmt,
ist ungemein wirkungsvoll mit seiner realistischen,
auf engstem Räume ausgedrückten Anstrengung; keine
Literatur, nur Sachlichkeit, kräftiger Zug der Strichlagen.
Schließlich seien noch zwei Nacktstudien von Jean
Frisson erwähnt, an denen man lange studiert, mit
welchem verborgenen Kunstgriff der Künstler seine
Radierverfahren zu einer so weichen und warmen
Tonigkeit ausgebildet hat, daß es scheint, er habe
weiß und braun mit dem Pinsel nachschattiert.
Unter den mannigfachen Einzelausstellungen, die
von Kunsthandlungen, Salons, kunstgewerblichen Maga-
zinen veranstaltet wurden, ist hervorzuheben der Über-
blick über Henri Binards Wetke, den die Salle
Aeolian darbot. Henri Binard ist ein mondäner Land-
schafter, mit Träumerei und weiblichem Stimmungs-
genießertum. Luft, Teich, Uferbord und Schwan
werden fast zu Dunst und goldener Vision, doch ver-
meidet Binard geschickt das Süßliche.
Das neue Jahr begann mit einer sehr sehenswerten,
84 Nummern umfassenden Aquarellausstellung im
Studio-Saale. Von den Künstlern seien angeführt:
Cassiers, Charlet, Crespin, Creten, Delaunois,
Franz Gailliard, Theo Hamon, V. Hageman,
M. Hagemans, Hoeterickx, R.Janssens, Khnopff,
Lemmen, A. Lynen, Marcette, Mellery, Michel
Pinot, Ramah Rieh ir, G. M. Stevens, Titz, Tous-
saint und Van de Leene.
Als äußerst interessant und eindrucksvoll stehen
hier bleibend in meiner Erinnerung die kleinen Stadt-
ansichten von A. Delaunois, graue, silbrige, hell-
kühle Blätter, dann das große Bild »Letzter Akkord«,
eineFrau am Klavier vom Rücken ausgesehen, von Jules
Van de Leene, das den hohen Verkaufspreis, den ein
Herr aus Bremen dafür zahlte, vollauf verdiente, und
schließlich das starke Blatt von Henri Cassiers, die
Genter Pforte von Brügge darstellend.
Di ese Ausstellung, die bei Publikum und Presse
verdienten Beifall fand, ist jetzt abgelöst von einer
Schau recht mäßiger und konventioneller Bilder der
beiden Maler Alexander Marcette und Herman
Richir; mit reinem Gewissen kann man hier viel An-
erkennendes nicht sagen; es ist die Kunst, die immer
sein und bleiben wird neben der eigentlichen und
Geschichte machenden Kunst.
Nicht, weil sie sich »Independants« nennen, son-
dern weil wirklich innere Berufung sie modern macht,
muß man das lobende Wort: sie treibe das Schicksal,
zubilligen der Gruppe jener Künstler, die in einem
hübschen Saale der rue Royale soeben ihre »Moderne
Künstlerausstellung« eröffnen. Die Ausstellung um-
faßt 109 Nummern, unter denen mit 18 Nummern
am reichsten der Porträtist, Interieurmaler und Land-
schafter Georges Creten vertreten ist. Man muß
den Namen dieses Neuauftauchenden im Gedächt-
nis behalten; seine Malweise hat den großen Zug der
gestaltenden, umdeutenden Schöpferleidenschaft; seine