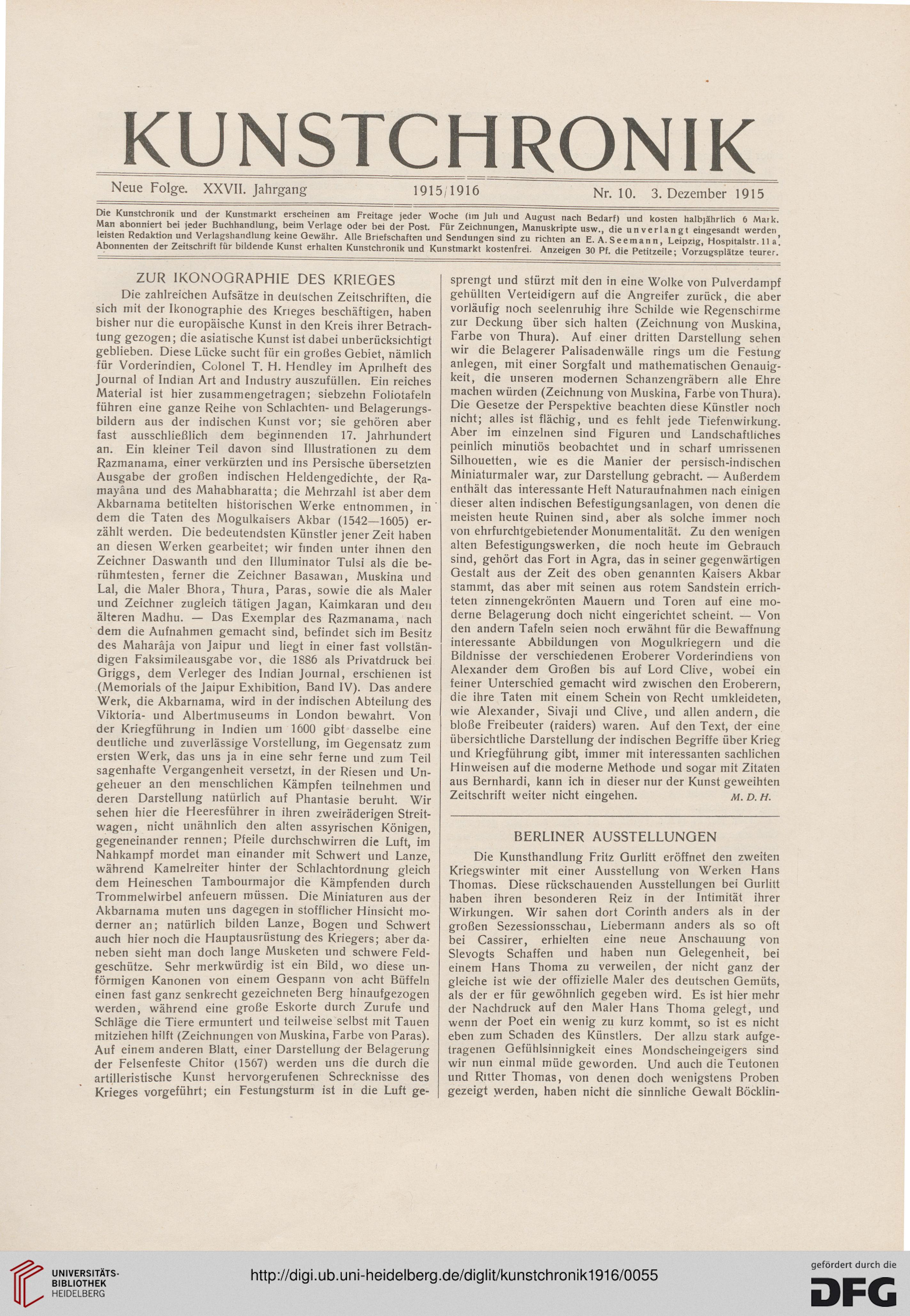KUNSTCHRONIK
Neue Folge. XXVII. Jahrgang
19151916
Nr. 10. 3. Dezember 1915
Die Kunstchronik und der Kunstmarkt erscheinen am Freitage jeder Woche (im Juli und August nach Bedarf) und kosten halbjährlich 6 Mark.
Man abonniert bei jeder Buchhandlung, beim Verlage oder bei der Post. Für Zeichnungen, Manuskripte usw., die unverlangt eingesandt werden
leisten Redaktion und Verlagshandlung keine Gewähr. Alle Briefschaften und Sendungen sind zu richten an E. A. Seemann, Leipzig, Hospitalstr. 11 a!
Abonnenten der Zeitschrift für bildende Kunst erhalten Kunstchronik und Kunstmarkt kostenfrei. Anzeigen 30 Pf. die Petitzeile; Vorzugsplätze teurer.
ZUR IKONOGRAPHIE DES KRIEGES
Die zahlreichen Aufsätze in deutschen Zeitschriften, die
sich mit der Ikonographie des Krieges beschäftigen, haben
bisher nur die europäische Kunst in den Kreis ihrer Betrach-
tung gezogen; die asiatische Kunst ist dabei unberücksichtigt
geblieben. Diese Lücke sucht für ein großes Gebiet, nämlich
für Vorderindien, Colone! T. H. Hendley im Aprilheft des
Journal of Indian Art and Industry auszufüllen. Ein reiches
Material ist hier zusammengetragen; siebzehn Foliotafeln
führen eine ganze Reihe von Schlachten- und Belagerungs-
bildern aus der indischen Kunst vor; sie gehören aber
fast ausschließlich dem beginnenden 17. Jahrhundert
an. Ein kleiner Teil davon sind Illustrationen zu dem
Razmanama, einer verkürzten und ins Persische übersetzten
Ausgabe der großen indischen Heldengedichte, der Ra-
mayäna und des Mahabharatta; die Mehrzahl ist aber dem
Akbarnama betitelten historischen Werke entnommen, in
dem die Taten des Mogulkaisers Akbar (1542—1605) er-
zählt werden. Die bedeutendsten Künstler jener Zeit haben
an diesen Werken gearbeitet; wir finden unter ihnen den
Zeichner Daswanth und den Illuminator Tulsi als die be-
rühmtesten, ferner die Zeichner Basawan, Muskina und
Lal, die Maler Bhora, Thura, Paras, sowie die als Maler
und Zeichner zugleich tätigen Jagan, Kaimkaran und den
älteren Madhu. — Das Exemplar des Razmanama, nach
dem die Aufnahmen gemacht sind, befindet sich im Besitz
des Maharäja von Jaipur und liegt in einer fast vollstän-
digen Faksimileausgabe vor, die 1886 als Privatdruck bei
Origgs, dem Verleger des Indian Journal, erschienen ist
(Memorials of the Jaipur Exhibition, Band IV). Das andere
Werk, die Akbarnama, wird in der indischen Abteilung des
Viktoria- und Albertmuseums in London bewahrt. Von
der Kriegführung in Indien um 1600 gibt dasselbe eine
deutliche und zuverlässige Vorstellung, im Gegensatz zum
ersten Werk, das uns ja in eine sehr ferne und zum Teil
sagenhafte Vergangenheit versetzt, in der Riesen und Un-
geheuer an den menschlichen Kämpfen teilnehmen und
deren Darstellung natürlich auf Phantasie beruht. Wir
sehen hier die Heeresführer in ihren zweiräderigen Streit-
wagen, nicht unähnlich den alten assyrischen Königen,
gegeneinander rennen; Pfeile durchschwirren die Luft, im
Nahkampf mordet man einander mit Schwert und Lanze,
während Kamelreiter hinter der Schlachtordnung gleich
dem Heineschen Tambourmajor die Kämpfenden durch
Trommelwirbel anfeuern müssen. Die Miniaturen aus der
Akbarnama muten uns dagegen in stofflicher Hinsicht mo-
derner an; natürlich bilden Lanze, Bogen und Schwert
auch hier noch die Hauptausrüstung des Kriegers; aber da-
neben sieht man doch lange Musketen und schwere Feld-
geschütze. Sehr merkwürdig ist ein Bild, wo diese un-
förmigen Kanonen von einem Gespann von acht Büffeln
einen fast ganz senkrecht gezeichneten Berg hinaufgezogen
werden, während eine große Eskorte durch Zurufe und
Schläge die Tiere ermuntert und teilweise selbst mit Tauen
mitziehen hilft (Zeichnungen von Muskina, Farbe von Paras).
Auf einem anderen Blatt, einer Darstellung der Belagerung
der Felsenfeste Chitor (1567) werden uns die durch die
artilleristische Kunst hervorgerufenen Schrecknisse des
Krieges vorgeführt; ein Festungsturm ist in die Luft ge-
sprengt und stürzt mit den in eine Wolke von Pulverdampf
gehüllten Verteidigern auf die Angreifer zurück, die aber
vorläufig noch seelenruhig ihre Schilde wie Regenschirme
zur Deckung über sich halten (Zeichnung von Muskina,
Farbe von Thura). Auf einer dritten Darstellung sehen
wir die Belagerer Palisadenwälle rings um die Festung
anlegen, mit einer Sorgfalt und mathematischen Genauig-
keit, die unseren modernen Schanzengräbern alle Ehre
machen würden (Zeichnung von Muskina, Farbe von Thura).
Die Gesetze der Perspektive beachten diese Künstler noch
nicht; alles ist flächig, und es fehlt jede Tiefenwirkung.
Aber im einzelnen sind Figuren und Landschaftliches
peinlich minutiös beobachtet und in scharf umrissenen
Silhouetten, wie es die Manier der persisch-indischen
Miniaturmaler war, zur Darstellung gebracht. — Außerdem
enthält das interessante Heft Naturaufnahmen nach einigen
dieser alten indischen Befestigungsanlagen, von denen die
meisten heute Ruinen sind, aber als solche immer noch
von ehrfurchtgebietender Monumentalität. Zu den wenigen
alten Befestigungswerken, die noch heute im Gebrauch
sind, gehört das Fort in Agra, das in seiner gegenwärtigen
Gestalt aus der Zeit des oben genannten Kaisers Akbar
stammt, das aber mit seinen aus rotem Sandstein errich-
teten zinnengekrönten Mauern und Toren auf eine mo-
derne Belagerung doch nicht eingerichtet scheint. — Von
den andern Tafeln seien noch erwähnt für die Bewaffnung
interessante Abbildungen von Mogulkriegern und die
Bildnisse der verschiedenen Eroberer Vorderindiens von
Alexander dem Großen bis auf Lord Clive, wobei ein
feiner Unterschied gemacht wird zwischen den Eroberern,
die ihre Taten mit einem Schein von Recht umkleideten,
wie Alexander, Sivaji und Clive, und allen andern, die
bloße Freibeuter (raiders) waren. Auf den Text, der eine
übersichtliche Darstellung der indischen Begriffe über Krieg
und Kriegführung gibt, immer mit interessanten sachlichen
Hinweisen auf die moderne Methode und sogar mit Zitaten
aus Bernhardi, kann ich in dieser nur der Kunst geweihten
Zeitschrift weiter nicht eingehen. m. d. h.
BERLINER AUSSTELLUNGEN
Die Kunsthandlung Fritz Gurlitt eröffnet den zweiten
Kriegswinter mit einer Ausstellung von Werken Hans
Thomas. Diese rückschauenden Ausstellungen bei Gurlitt
haben ihren besonderen Reiz in der Intimität ihrer
Wirkungen. Wir sahen dort Corinth anders als in der
großen Sezessionsschau, Liebermann anders als so oft
bei Cassirer, erhielten eine neue Anschauung von
Slevogts Schaffen und haben nun Gelegenheit, bei
einem Hans Thoma zu verweilen, der nicht ganz der
gleiche ist wie der offizielle Maler des deutschen Gemüts,
als der er für gewöhnlich gegeben wird. Es ist hier mehr
der Nachdruck auf den Maler Hans Thoma gelegt, und
wenn der Poet ein wenig zu kurz kommt, so ist es nicht
eben zum Schaden des Künstlers. Der allzu stark aufge-
tragenen Gefühlsinnigkeit eines Mondscheingeigers sind
wir nun einmal müde geworden. Und auch die Teutonen
und Ritter Thomas, von denen doch wenigstens Proben
gezeigt werden, haben nicht die sinnliche Gewalt Böcklin-
Neue Folge. XXVII. Jahrgang
19151916
Nr. 10. 3. Dezember 1915
Die Kunstchronik und der Kunstmarkt erscheinen am Freitage jeder Woche (im Juli und August nach Bedarf) und kosten halbjährlich 6 Mark.
Man abonniert bei jeder Buchhandlung, beim Verlage oder bei der Post. Für Zeichnungen, Manuskripte usw., die unverlangt eingesandt werden
leisten Redaktion und Verlagshandlung keine Gewähr. Alle Briefschaften und Sendungen sind zu richten an E. A. Seemann, Leipzig, Hospitalstr. 11 a!
Abonnenten der Zeitschrift für bildende Kunst erhalten Kunstchronik und Kunstmarkt kostenfrei. Anzeigen 30 Pf. die Petitzeile; Vorzugsplätze teurer.
ZUR IKONOGRAPHIE DES KRIEGES
Die zahlreichen Aufsätze in deutschen Zeitschriften, die
sich mit der Ikonographie des Krieges beschäftigen, haben
bisher nur die europäische Kunst in den Kreis ihrer Betrach-
tung gezogen; die asiatische Kunst ist dabei unberücksichtigt
geblieben. Diese Lücke sucht für ein großes Gebiet, nämlich
für Vorderindien, Colone! T. H. Hendley im Aprilheft des
Journal of Indian Art and Industry auszufüllen. Ein reiches
Material ist hier zusammengetragen; siebzehn Foliotafeln
führen eine ganze Reihe von Schlachten- und Belagerungs-
bildern aus der indischen Kunst vor; sie gehören aber
fast ausschließlich dem beginnenden 17. Jahrhundert
an. Ein kleiner Teil davon sind Illustrationen zu dem
Razmanama, einer verkürzten und ins Persische übersetzten
Ausgabe der großen indischen Heldengedichte, der Ra-
mayäna und des Mahabharatta; die Mehrzahl ist aber dem
Akbarnama betitelten historischen Werke entnommen, in
dem die Taten des Mogulkaisers Akbar (1542—1605) er-
zählt werden. Die bedeutendsten Künstler jener Zeit haben
an diesen Werken gearbeitet; wir finden unter ihnen den
Zeichner Daswanth und den Illuminator Tulsi als die be-
rühmtesten, ferner die Zeichner Basawan, Muskina und
Lal, die Maler Bhora, Thura, Paras, sowie die als Maler
und Zeichner zugleich tätigen Jagan, Kaimkaran und den
älteren Madhu. — Das Exemplar des Razmanama, nach
dem die Aufnahmen gemacht sind, befindet sich im Besitz
des Maharäja von Jaipur und liegt in einer fast vollstän-
digen Faksimileausgabe vor, die 1886 als Privatdruck bei
Origgs, dem Verleger des Indian Journal, erschienen ist
(Memorials of the Jaipur Exhibition, Band IV). Das andere
Werk, die Akbarnama, wird in der indischen Abteilung des
Viktoria- und Albertmuseums in London bewahrt. Von
der Kriegführung in Indien um 1600 gibt dasselbe eine
deutliche und zuverlässige Vorstellung, im Gegensatz zum
ersten Werk, das uns ja in eine sehr ferne und zum Teil
sagenhafte Vergangenheit versetzt, in der Riesen und Un-
geheuer an den menschlichen Kämpfen teilnehmen und
deren Darstellung natürlich auf Phantasie beruht. Wir
sehen hier die Heeresführer in ihren zweiräderigen Streit-
wagen, nicht unähnlich den alten assyrischen Königen,
gegeneinander rennen; Pfeile durchschwirren die Luft, im
Nahkampf mordet man einander mit Schwert und Lanze,
während Kamelreiter hinter der Schlachtordnung gleich
dem Heineschen Tambourmajor die Kämpfenden durch
Trommelwirbel anfeuern müssen. Die Miniaturen aus der
Akbarnama muten uns dagegen in stofflicher Hinsicht mo-
derner an; natürlich bilden Lanze, Bogen und Schwert
auch hier noch die Hauptausrüstung des Kriegers; aber da-
neben sieht man doch lange Musketen und schwere Feld-
geschütze. Sehr merkwürdig ist ein Bild, wo diese un-
förmigen Kanonen von einem Gespann von acht Büffeln
einen fast ganz senkrecht gezeichneten Berg hinaufgezogen
werden, während eine große Eskorte durch Zurufe und
Schläge die Tiere ermuntert und teilweise selbst mit Tauen
mitziehen hilft (Zeichnungen von Muskina, Farbe von Paras).
Auf einem anderen Blatt, einer Darstellung der Belagerung
der Felsenfeste Chitor (1567) werden uns die durch die
artilleristische Kunst hervorgerufenen Schrecknisse des
Krieges vorgeführt; ein Festungsturm ist in die Luft ge-
sprengt und stürzt mit den in eine Wolke von Pulverdampf
gehüllten Verteidigern auf die Angreifer zurück, die aber
vorläufig noch seelenruhig ihre Schilde wie Regenschirme
zur Deckung über sich halten (Zeichnung von Muskina,
Farbe von Thura). Auf einer dritten Darstellung sehen
wir die Belagerer Palisadenwälle rings um die Festung
anlegen, mit einer Sorgfalt und mathematischen Genauig-
keit, die unseren modernen Schanzengräbern alle Ehre
machen würden (Zeichnung von Muskina, Farbe von Thura).
Die Gesetze der Perspektive beachten diese Künstler noch
nicht; alles ist flächig, und es fehlt jede Tiefenwirkung.
Aber im einzelnen sind Figuren und Landschaftliches
peinlich minutiös beobachtet und in scharf umrissenen
Silhouetten, wie es die Manier der persisch-indischen
Miniaturmaler war, zur Darstellung gebracht. — Außerdem
enthält das interessante Heft Naturaufnahmen nach einigen
dieser alten indischen Befestigungsanlagen, von denen die
meisten heute Ruinen sind, aber als solche immer noch
von ehrfurchtgebietender Monumentalität. Zu den wenigen
alten Befestigungswerken, die noch heute im Gebrauch
sind, gehört das Fort in Agra, das in seiner gegenwärtigen
Gestalt aus der Zeit des oben genannten Kaisers Akbar
stammt, das aber mit seinen aus rotem Sandstein errich-
teten zinnengekrönten Mauern und Toren auf eine mo-
derne Belagerung doch nicht eingerichtet scheint. — Von
den andern Tafeln seien noch erwähnt für die Bewaffnung
interessante Abbildungen von Mogulkriegern und die
Bildnisse der verschiedenen Eroberer Vorderindiens von
Alexander dem Großen bis auf Lord Clive, wobei ein
feiner Unterschied gemacht wird zwischen den Eroberern,
die ihre Taten mit einem Schein von Recht umkleideten,
wie Alexander, Sivaji und Clive, und allen andern, die
bloße Freibeuter (raiders) waren. Auf den Text, der eine
übersichtliche Darstellung der indischen Begriffe über Krieg
und Kriegführung gibt, immer mit interessanten sachlichen
Hinweisen auf die moderne Methode und sogar mit Zitaten
aus Bernhardi, kann ich in dieser nur der Kunst geweihten
Zeitschrift weiter nicht eingehen. m. d. h.
BERLINER AUSSTELLUNGEN
Die Kunsthandlung Fritz Gurlitt eröffnet den zweiten
Kriegswinter mit einer Ausstellung von Werken Hans
Thomas. Diese rückschauenden Ausstellungen bei Gurlitt
haben ihren besonderen Reiz in der Intimität ihrer
Wirkungen. Wir sahen dort Corinth anders als in der
großen Sezessionsschau, Liebermann anders als so oft
bei Cassirer, erhielten eine neue Anschauung von
Slevogts Schaffen und haben nun Gelegenheit, bei
einem Hans Thoma zu verweilen, der nicht ganz der
gleiche ist wie der offizielle Maler des deutschen Gemüts,
als der er für gewöhnlich gegeben wird. Es ist hier mehr
der Nachdruck auf den Maler Hans Thoma gelegt, und
wenn der Poet ein wenig zu kurz kommt, so ist es nicht
eben zum Schaden des Künstlers. Der allzu stark aufge-
tragenen Gefühlsinnigkeit eines Mondscheingeigers sind
wir nun einmal müde geworden. Und auch die Teutonen
und Ritter Thomas, von denen doch wenigstens Proben
gezeigt werden, haben nicht die sinnliche Gewalt Böcklin-