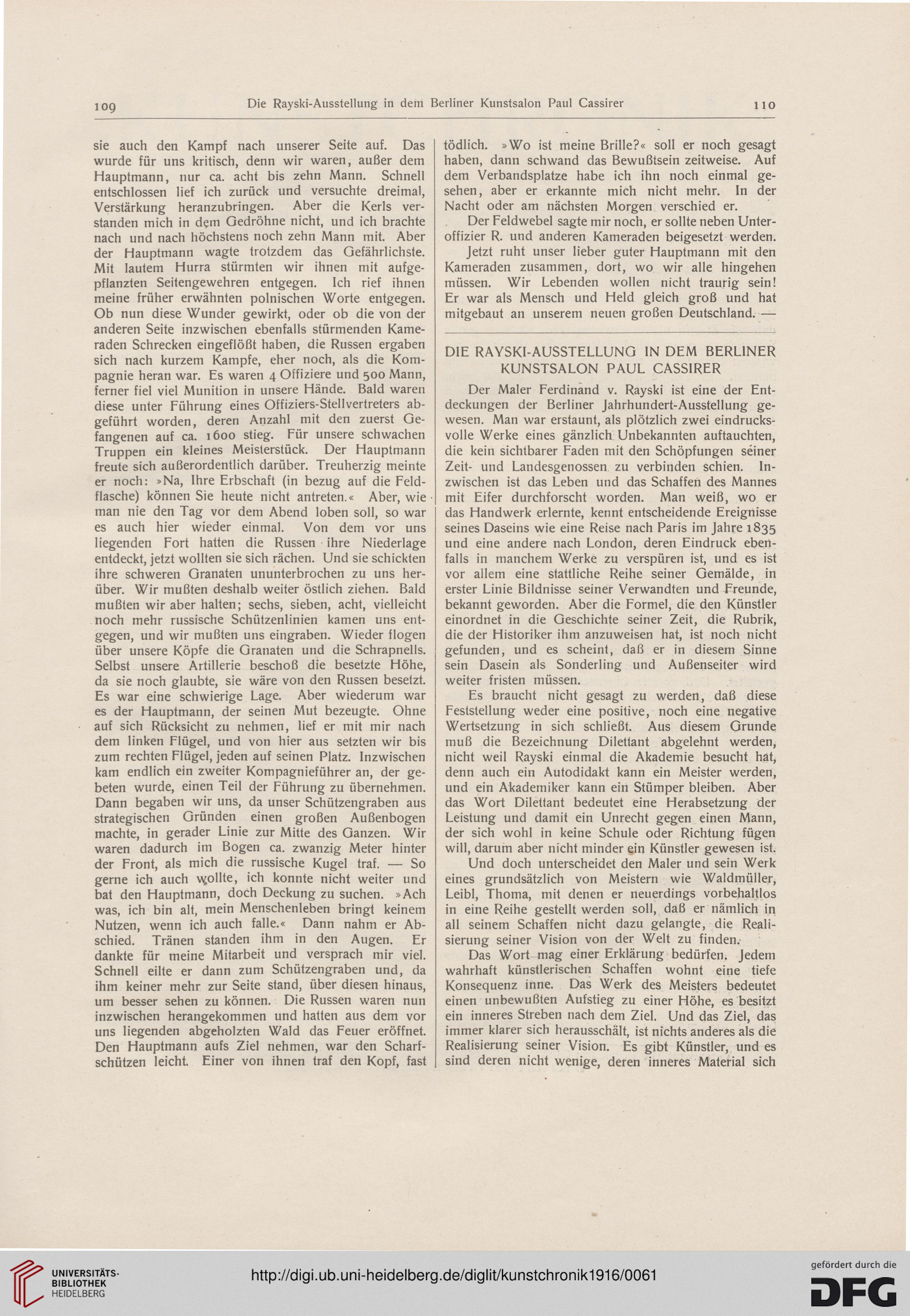109
Die Rayski-Ausstellung in dem Berliner Kunstsalon Paul Cassirer
1 10
sie auch den Kampf nach unserer Seite auf. Das
wurde für uns kritisch, denn wir waren, außer dem
Hauptmann, nur ca. acht bis zehn Mann. Schnell
entschlossen lief ich zurück und versuchte dreimal,
Verstärkung heranzubringen. Aber die Kerls ver-
standen mich in dem Gedröhne nicht, und ich brachte
nach und nach höchstens noch zehn Mann mit. Aber
der Hauptmann wagte trotzdem das Gefährlichste.
Mit lautem Hurra stürmten wir ihnen mit aufge-
pflanzten Seitengewehren entgegen. Ich rief ihnen
meine früher erwähnten polnischen Worte entgegen.
Ob nun diese Wunder gewirkt, oder ob die von der
anderen Seite inzwischen ebenfalls stürmenden Kame-
raden Schrecken eingeflößt haben, die Russen ergaben
sich nach kurzem Kampfe, eher noch, als die Kom-
pagnie heran war. Es waren 4 Offiziere und 500 Mann,
ferner fiel viel Munition in unsere Hände. Bald waren
diese unter Führung eines Offiziers-Stellvertreters ab-
geführt worden, deren Anzahl mit den zuerst Ge-
fangenen auf ca. 1600 stieg. Für unsere schwachen
Truppen ein kleines Meisterstück. Der Hauptmann
freute sich außerordentlich darüber. Treuherzig meinte
er noch: »Na, Ihre Erbschaft (in bezug auf die Feld-
flasche) können Sie heute nicht antreten.« Aber, wie
man nie den Tag vor dem Abend loben soll, so war
es auch hier wieder einmal. Von dem vor uns
liegenden Fort hatten die Russen ihre Niederlage
entdeckt, jetzt wollten sie sich rächen. Und sie schickten
ihre schweren Granaten ununterbrochen zu uns her-
über. Wir mußten deshalb weiter östlich ziehen. Bald
mußten wir aber halten; sechs, sieben, acht, vielleicht
noch mehr russische Schützenlinien kamen uns ent-
gegen, und wir mußten uns eingraben. Wieder flogen
über unsere Köpfe die Granaten und die Schrapnells.
Selbst unsere Artillerie beschoß die besetzte Höhe,
da sie noch glaubte, sie wäre von den Russen besetzt.
Es war eine schwierige Lage. Aber wiederum war
es der Hauptmann, der seinen Mut bezeugte. Ohne
auf sich Rücksicht zu nehmen, lief er mit mir nach
dem linken Flügel, und von hier aus setzten wir bis
zum rechten Flügel, jeden auf seinen Platz. Inzwischen
kam endlich ein zweiter Kompagnieführer an, der ge-
beten wurde, einen Teil der Führung zu übernehmen.
Dann begaben wir uns, da unser Schützengraben aus
strategischen Gründen einen großen Außenbogen
machte, in gerader Linie zur Mitte des Ganzen. Wir
waren dadurch im Bogen ca. zwanzig Meter hinter
der Front, als mich die russische Kugel traf. — So
gerne ich auch w,ollte, ich konnte nicht weiter und
bat den Hauptmann, doch Deckung zu suchen. »Ach
was, ich bin alt, mein Menschenleben bringt keinem
Nutzen, wenn ich auch falle.« Dann nahm er Ab-
schied. Tränen standen ihm in den Augen. Er
dankte für meine Mitarbeit und versprach mir viel.
Schnell eilte er dann zum Schützengraben und, da
ihm keiner mehr zur Seite stand, über diesen hinaus,
um besser sehen zu können. Die Russen waren nun
inzwischen herangekommen und hatten aus dem vor
uns liegenden abgeholzten Wald das Feuer eröffnet.
Den Hauptmann aufs Ziel nehmen, war den Scharf-
schützen leicht. Einer von ihnen traf den Kopf, fast
tödlich. »Wo ist meine Brille?« soll er noch gesagt
haben, dann schwand das Bewußtsein zeitweise. Auf
dem Verbandsplatze habe ich ihn noch einmal ge-
sehen, aber er erkannte mich nicht mehr. In der
Nacht oder am nächsten Morgen verschied er.
Der Feldwebel sagte mir noch, er sollte neben Unter-
offizier R. und anderen Kameraden beigesetzt werden.
Jetzt ruht unser lieber guter Hauptmann mit den
Kameraden zusammen, dort, wo wir alle hingehen
müssen. Wir Lebenden wollen nicht traurig sein!
Er war als Mensch und Held gleich groß und hat
mitgebaut an unserem neuen großen Deutschland. —
DIE RAYSKI-AUSSTELLUNG IN DEM BERLINER
KUNSTSALON PAUL CASSIRER
Der Maler Ferdinand v. Rayski ist eine der Ent-
deckungen der Berliner Jahrhundert-Ausstellung ge-
wesen. Man war erstaunt, als plötzlich zwei eindrucks-
volle Werke eines gänzlich Unbekannten auftauchten,
die kein sichtbarer Faden mit den Schöpfungen seiner
Zeit- und Landesgenossen zu verbinden schien. In-
zwischen ist das Leben und das Schaffen des Mannes
mit Eifer durchforscht worden. Man weiß, wo er
das Handwerk erlernte, kennt entscheidende Ereignisse
seines Daseins wie eine Reise nach Paris im Jahre 1835
und eine andere nach London, deren Eindruck eben-
falls in manchem Werke zu verspüren ist, und es ist
vor allem eine stattliche Reihe seiner Gemälde, in
erster Linie Bildnisse seiner Verwandten und Freunde,
bekannt geworden. Aber die Formel, die den Künstler
einordnet in die Geschichte seiner Zeit, die Rubrik,
die der Historiker ihm anzuweisen hat, ist noch nicht
gefunden, und es scheint, daß er in diesem Sinne
sein Dasein als Sonderling und Außenseiter wird
weiter fristen müssen.
Es braucht nicht gesagt zu werden, daß diese
Feststellung weder eine positive, noch eine negative
Wertsetzung in sich schließt. Aus diesem Grunde
muß die Bezeichnung Dilettant abgelehnt werden,
nicht weil Rayski einmal die Akademie besucht hat,
denn auch ein Autodidakt kann ein Meister werden,
und ein Akademiker kann ein Stümper bleiben. Aber
das Wort Dilettant bedeutet eine Herabsetzung der
Leistung und damit ein Unrecht gegen einen Mann,
der sich wohl in keine Schule oder Richtung fügen
will, darum aber nicht minder ein Künstler gewesen ist.
Und doch unterscheidet den Maler und sein Werk
eines grundsätzlich von Meistern wie Waldmüller,
Leibi, Thoma, mit denen er neuerdings vorbehaltlos
in eine Reihe gestellt werden soll, daß er nämlich in
all seinem Schaffen nicht dazu gelangte, die Reali-
sierung seiner Vision von der Welt zu finden.
Das Wort mag einer Erklärung bedürfen. Jedem
wahrhaft künstlerischen Schaffen wohnt eine tiefe
Konsequenz inne. Das Werk des Meisters bedeutet
einen unbewußten Aufstieg zu einer Höhe, es besitzt
ein inneres Streben nach dem Ziel. Und das Ziel, das
immer klarer sich herausschält, ist nichts anderes als die
Realisierung seiner Vision. Es gibt Künstler, und es
sind deren nicht wenige, deren inneres Material sich
Die Rayski-Ausstellung in dem Berliner Kunstsalon Paul Cassirer
1 10
sie auch den Kampf nach unserer Seite auf. Das
wurde für uns kritisch, denn wir waren, außer dem
Hauptmann, nur ca. acht bis zehn Mann. Schnell
entschlossen lief ich zurück und versuchte dreimal,
Verstärkung heranzubringen. Aber die Kerls ver-
standen mich in dem Gedröhne nicht, und ich brachte
nach und nach höchstens noch zehn Mann mit. Aber
der Hauptmann wagte trotzdem das Gefährlichste.
Mit lautem Hurra stürmten wir ihnen mit aufge-
pflanzten Seitengewehren entgegen. Ich rief ihnen
meine früher erwähnten polnischen Worte entgegen.
Ob nun diese Wunder gewirkt, oder ob die von der
anderen Seite inzwischen ebenfalls stürmenden Kame-
raden Schrecken eingeflößt haben, die Russen ergaben
sich nach kurzem Kampfe, eher noch, als die Kom-
pagnie heran war. Es waren 4 Offiziere und 500 Mann,
ferner fiel viel Munition in unsere Hände. Bald waren
diese unter Führung eines Offiziers-Stellvertreters ab-
geführt worden, deren Anzahl mit den zuerst Ge-
fangenen auf ca. 1600 stieg. Für unsere schwachen
Truppen ein kleines Meisterstück. Der Hauptmann
freute sich außerordentlich darüber. Treuherzig meinte
er noch: »Na, Ihre Erbschaft (in bezug auf die Feld-
flasche) können Sie heute nicht antreten.« Aber, wie
man nie den Tag vor dem Abend loben soll, so war
es auch hier wieder einmal. Von dem vor uns
liegenden Fort hatten die Russen ihre Niederlage
entdeckt, jetzt wollten sie sich rächen. Und sie schickten
ihre schweren Granaten ununterbrochen zu uns her-
über. Wir mußten deshalb weiter östlich ziehen. Bald
mußten wir aber halten; sechs, sieben, acht, vielleicht
noch mehr russische Schützenlinien kamen uns ent-
gegen, und wir mußten uns eingraben. Wieder flogen
über unsere Köpfe die Granaten und die Schrapnells.
Selbst unsere Artillerie beschoß die besetzte Höhe,
da sie noch glaubte, sie wäre von den Russen besetzt.
Es war eine schwierige Lage. Aber wiederum war
es der Hauptmann, der seinen Mut bezeugte. Ohne
auf sich Rücksicht zu nehmen, lief er mit mir nach
dem linken Flügel, und von hier aus setzten wir bis
zum rechten Flügel, jeden auf seinen Platz. Inzwischen
kam endlich ein zweiter Kompagnieführer an, der ge-
beten wurde, einen Teil der Führung zu übernehmen.
Dann begaben wir uns, da unser Schützengraben aus
strategischen Gründen einen großen Außenbogen
machte, in gerader Linie zur Mitte des Ganzen. Wir
waren dadurch im Bogen ca. zwanzig Meter hinter
der Front, als mich die russische Kugel traf. — So
gerne ich auch w,ollte, ich konnte nicht weiter und
bat den Hauptmann, doch Deckung zu suchen. »Ach
was, ich bin alt, mein Menschenleben bringt keinem
Nutzen, wenn ich auch falle.« Dann nahm er Ab-
schied. Tränen standen ihm in den Augen. Er
dankte für meine Mitarbeit und versprach mir viel.
Schnell eilte er dann zum Schützengraben und, da
ihm keiner mehr zur Seite stand, über diesen hinaus,
um besser sehen zu können. Die Russen waren nun
inzwischen herangekommen und hatten aus dem vor
uns liegenden abgeholzten Wald das Feuer eröffnet.
Den Hauptmann aufs Ziel nehmen, war den Scharf-
schützen leicht. Einer von ihnen traf den Kopf, fast
tödlich. »Wo ist meine Brille?« soll er noch gesagt
haben, dann schwand das Bewußtsein zeitweise. Auf
dem Verbandsplatze habe ich ihn noch einmal ge-
sehen, aber er erkannte mich nicht mehr. In der
Nacht oder am nächsten Morgen verschied er.
Der Feldwebel sagte mir noch, er sollte neben Unter-
offizier R. und anderen Kameraden beigesetzt werden.
Jetzt ruht unser lieber guter Hauptmann mit den
Kameraden zusammen, dort, wo wir alle hingehen
müssen. Wir Lebenden wollen nicht traurig sein!
Er war als Mensch und Held gleich groß und hat
mitgebaut an unserem neuen großen Deutschland. —
DIE RAYSKI-AUSSTELLUNG IN DEM BERLINER
KUNSTSALON PAUL CASSIRER
Der Maler Ferdinand v. Rayski ist eine der Ent-
deckungen der Berliner Jahrhundert-Ausstellung ge-
wesen. Man war erstaunt, als plötzlich zwei eindrucks-
volle Werke eines gänzlich Unbekannten auftauchten,
die kein sichtbarer Faden mit den Schöpfungen seiner
Zeit- und Landesgenossen zu verbinden schien. In-
zwischen ist das Leben und das Schaffen des Mannes
mit Eifer durchforscht worden. Man weiß, wo er
das Handwerk erlernte, kennt entscheidende Ereignisse
seines Daseins wie eine Reise nach Paris im Jahre 1835
und eine andere nach London, deren Eindruck eben-
falls in manchem Werke zu verspüren ist, und es ist
vor allem eine stattliche Reihe seiner Gemälde, in
erster Linie Bildnisse seiner Verwandten und Freunde,
bekannt geworden. Aber die Formel, die den Künstler
einordnet in die Geschichte seiner Zeit, die Rubrik,
die der Historiker ihm anzuweisen hat, ist noch nicht
gefunden, und es scheint, daß er in diesem Sinne
sein Dasein als Sonderling und Außenseiter wird
weiter fristen müssen.
Es braucht nicht gesagt zu werden, daß diese
Feststellung weder eine positive, noch eine negative
Wertsetzung in sich schließt. Aus diesem Grunde
muß die Bezeichnung Dilettant abgelehnt werden,
nicht weil Rayski einmal die Akademie besucht hat,
denn auch ein Autodidakt kann ein Meister werden,
und ein Akademiker kann ein Stümper bleiben. Aber
das Wort Dilettant bedeutet eine Herabsetzung der
Leistung und damit ein Unrecht gegen einen Mann,
der sich wohl in keine Schule oder Richtung fügen
will, darum aber nicht minder ein Künstler gewesen ist.
Und doch unterscheidet den Maler und sein Werk
eines grundsätzlich von Meistern wie Waldmüller,
Leibi, Thoma, mit denen er neuerdings vorbehaltlos
in eine Reihe gestellt werden soll, daß er nämlich in
all seinem Schaffen nicht dazu gelangte, die Reali-
sierung seiner Vision von der Welt zu finden.
Das Wort mag einer Erklärung bedürfen. Jedem
wahrhaft künstlerischen Schaffen wohnt eine tiefe
Konsequenz inne. Das Werk des Meisters bedeutet
einen unbewußten Aufstieg zu einer Höhe, es besitzt
ein inneres Streben nach dem Ziel. Und das Ziel, das
immer klarer sich herausschält, ist nichts anderes als die
Realisierung seiner Vision. Es gibt Künstler, und es
sind deren nicht wenige, deren inneres Material sich