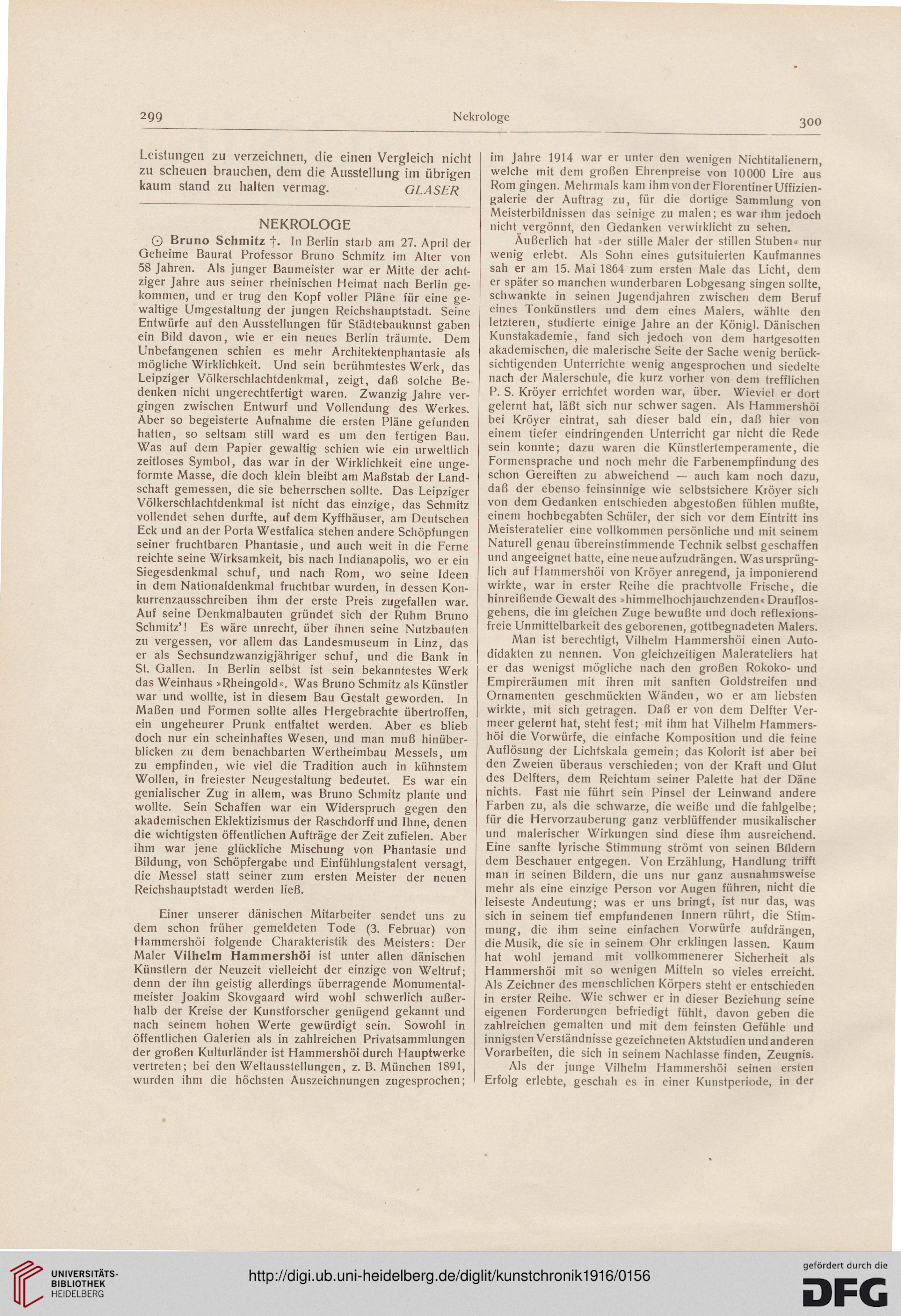299
Nekrologe
300
Leistungen zu verzeichnen, die einen Vergleich nicht
zu scheuen brauchen, dem die Ausstellung im übrigen
kaum stand zu halten vermag. GLASER
NEKROLOGE
O Bruno Schmitz f. In Berlin starb am 27. April der
Geh eime Baurat Professor Bruno Schmitz im Alter von
58 Jahren. Als junger Baumeister war er Mitte der acht-
ziger Jahre aus seiner rheinischen Heimat nach Berlin ge-
kommen, und er trug den Kopf voller Pläne für eine ge-
waltige Umgestaltung der jungen Reichshauptstadt. Seine
Entwürfe auf den Ausstellungen für Städtebaukunst gaben
ein Bild davon, wie er ein neues Berlin träumte. Dem
Unbefangenen schien es mehr Architektenphantasie als
mögliche Wirklichkeit. Und sein berühmtestes Werk, das
Leipziger Völkerschlachtdenkmal, zeigt, daß solche Be-
denken nicht ungerechtfertigt waren. Zwanzig Jahre ver-
gingen zwischen Entwurf und Vollendung des Werkes.
Aber so begeisterte Aufnahme die ersten Pläne gefunden
hatten, so seltsam still ward es um den fertigen Bau.
Was auf dem Papier gewaltig schien wie ein urweltlich
zeitloses Symbol, das war in der Wirklichkeit eine unge-
formte Masse, die doch klein bleibt am Maßstab der Land-
schaft gemessen, die sie beherrschen sollte. Das Leipziger
Völkerschlachtdenkmal ist nicht das einzige, das Schmitz
vollendet sehen durfte, auf dem Kyffhäuser, am Deutschen
Eck und an der Porta Westfalica stehen andere Schöpfungen
seiner fruchtbaren Phantasie, und auch weit in die Ferne
reichte seine Wirksamkeit, bis nach Indianapolis, wo er ein
Siegesdenkmal schuf, und nach Rom, wo seine Ideen
in dem Nationaldenkmal fruchtbar wurden, in dessen Kon-
kurrenzausschreiben ihm der erste Preis zugefallen war.
Auf seine Denkmalbauten gründet sich der Ruhm Bruno
Schmitz'! Es wäre unrecht, über ihnen seine Nutzbauten
zu vergessen, vor allem das Landesmuseum in Linz, das
er als Sechsundzwanzigjähriger schuf, und die Bank in
St. Gallen. In Berlin selbst ist sein bekanntestes Werk
das Weinhaus »Rheingold«. Was Bruno Schmitz als Künstler
war und wollte, ist in diesem Bau Gestalt geworden. In
Maßen und Formen sollte alles Hergebrachte übertroffen,
ein ungeheurer Prunk entfaltet werden. Aber es blieb
doch nur ein scheinhaftes Wesen, und man muß hinüber-
blicken zu dem benachbarten Wertheimbau Messels, um
zu empfinden, wie viel die Tradition auch in kühnstem
Wollen, in freiester Neugestaltung bedeutet. Es war ein
genialischer Zug in allem, was Bruno Schmitz plante und
wollte. Sein Schaffen war ein Widerspruch gegen den
akademischen Eklektizismus der Raschdorffund Ihne, denen
die wichtigsten öffentlichen Aufträge der Zeit zufielen. Aber
ihm war jene glückliche Mischung von Phantasie und
Bildung, von Schöpfergabe und Einfühlungstalent versagt,
die Messel statt seiner zum ersten Meister der neuen
Reichshauptstadt werden ließ.
Einer unserer dänischen Mitarbeiter sendet uns zu
dem schon früher gemeldeten Tode (3. Februar) von
Hammershöi folgende Charakteristik des Meisters: Der
Maler Vilhelm Hammershöi ist unter allen dänischen
Künstlern der Neuzeit vielleicht der einzige von Weltruf;
denn der ihn geistig allerdings überragende Monumental-
meister Joakim Skovgaard wird wohl schwerlich außer-
halb der Kreise der Kunstforscher genügend gekannt und
nach seinem hohen Werte gewürdigt sein. Sowohl in
öffentlichen Galerien als in zahlreichen Privatsammlungen
der großen Kulturländer ist Hammershöi durch Hauptwerke
vertreten; bei den Weltausstellungen, z. B.München 1891,
wurden ihm die höchsten Auszeichnungen zugesprochen;
im Jahre 1914 war er unter den wenigen Nichtitalienern,
welche mit dem großen Ehrenpreise von 10000 Lire aus
Rom gingen. Mehrmals kam ihm von der Florentiner Uffizien-
galerie der Auftrag zu, für die dortige Sammlung von
Meisterbildnissen das seinige zu malen; es war ihm jedoch
nicht vergönnt, den Gedanken verwirklicht zu sehen.
Äußerlich hat »der stille Maler der stillen Stuben« nur
wenig erlebt. Als Sohn eines gutsituierten Kaufmannes
sah er am 15. Mai 1864 zum ersten Male das Licht, dem
er später so manchen wunderbaren Lobgesang singen sollte,
schwankte in seinen Jugendjahren zwischen dem Beruf
eines Tonkünstlers und dem eines Malers, wählte den
letzteren, studierte einige Jahre an der Königl. Dänischen
Kunstakademie, fand sich jedoch von dem hartgesotten
akademischen, die malerische Seite der Sache wenig berück-
sichtigenden Unterrichte wenig angesprochen und siedelte
nach der Malerschule, die kurz vorher von dem trefflichen
P, S. Kröyer errichtet worden war, über. Wieviel er dort
gelernt hat, läßt sich nur schwer sagen. Als Hammershöi
bei Kröyer eintrat, sah dieser bald ein, daß hier von
einem tiefer eindringenden Unterricht gar nicht die Rede
sein konnte; dazu waren die Künstlertemperamente, die
Formensprache und noch mehr die Farbenempfindung des
schon Gereiften zu abweichend — auch kam noch dazu,
daß der ebenso feinsinnige wie selbstsichere Kröyer sich
von dem Gedanken entschieden abgestoßen fühlen mußte,
einem hochbegabten Schüler, der sich vor dem Eintritt ins
Meisteratelier eine vollkommen persönliche und mit seinem
Naturell genau übereinstimmende Technik selbst geschaffen
und angeeignet halte, eine neueaufzudrängen. Wasursprüng-
lich auf Hammershöi von Kröyer anregend, ja imponierend
wirkte, war in erster Reihe die prachtvolle Frische, die
hinreißende Gewalt des »himmelhochjauchzenden« Drauflos-
gehens, die im gleichen Zuge bewußte und doch reflexions-
freie Unmittelbarkeit des geborenen, gottbegnadeten Malers.
Man ist berechtigt, Vilhelm Hammershöi einen Auto-
didakten zu nennen. Von gleichzeitigen Malerateliers hat
er das wenigst mögliche nach den großen Rokoko- und
Empireräumen mit ihren mit sanften Goldstreifen und
Ornamenten geschmückten Wänden, wo er am liebsten
wirkte, mit sich getragen. Daß er von dem Delfter Ver-
meer gelernt hat, steht fest; mit ihm hat Vilhelm Hammers-
höi die Vorwürfe, die einfache Komposition und die feine
Auflösung der Lichtskala gemein; das Kolorit ist aber bei
den Zweien überaus verschieden; von der Kraft und Glut
des Delfters, dem Reichtum seiner Palette hat der Däne
nichts. Fast nie führt sein Pinsel der Leinwand andere
Farben zu, als die schwarze, die weiße und die fahlgelbe;
für die Hervorzauberung ganz verblüffender musikalischer
und malerischer Wirkungen sind diese ihm ausreichend.
Eine sanfte lyrische Stimmung strömt von seinen Bildern
dem Beschauer entgegen. Von Erzählung, Handlung trifft
man in seinen Bildern, die uns nur ganz ausnahmsweise
mehr als eine einzige Person vor Augen führen, nicht die
leiseste Andeutung; was er uns bringt, ist nur das, was
sich in seinem tief empfundenen Innern rührt, die Stim-
mung, die ihm seine einfachen Vorwürfe aufdrängen,
die Musik, die sie in seinem Ohr erklingen lassen. Kaum
hat wohl jemand mit vollkommenerer Sicherheit als
Hammershöi mit so wenigen Mitteln so vieles erreicht.
Als Zeichner des menschlichen Körpers steht er entschieden
in erster Reihe. Wie schwer er in dieser Beziehung seine
eigenen Forderungen befriedigt fühlt, davon geben die
zahlreichen gemalten und mit dem feinsten Gefühle und
innigsten Verständnisse gezeichneten Aktstudien und anderen
Vorarbeiten, die sich in seinem Nachlasse finden, Zeugnis.
Als der junge Vilhelm Hammershöi seinen ersten
Erfolg erlebte, geschah es in einer Kunstperiode, in der
Nekrologe
300
Leistungen zu verzeichnen, die einen Vergleich nicht
zu scheuen brauchen, dem die Ausstellung im übrigen
kaum stand zu halten vermag. GLASER
NEKROLOGE
O Bruno Schmitz f. In Berlin starb am 27. April der
Geh eime Baurat Professor Bruno Schmitz im Alter von
58 Jahren. Als junger Baumeister war er Mitte der acht-
ziger Jahre aus seiner rheinischen Heimat nach Berlin ge-
kommen, und er trug den Kopf voller Pläne für eine ge-
waltige Umgestaltung der jungen Reichshauptstadt. Seine
Entwürfe auf den Ausstellungen für Städtebaukunst gaben
ein Bild davon, wie er ein neues Berlin träumte. Dem
Unbefangenen schien es mehr Architektenphantasie als
mögliche Wirklichkeit. Und sein berühmtestes Werk, das
Leipziger Völkerschlachtdenkmal, zeigt, daß solche Be-
denken nicht ungerechtfertigt waren. Zwanzig Jahre ver-
gingen zwischen Entwurf und Vollendung des Werkes.
Aber so begeisterte Aufnahme die ersten Pläne gefunden
hatten, so seltsam still ward es um den fertigen Bau.
Was auf dem Papier gewaltig schien wie ein urweltlich
zeitloses Symbol, das war in der Wirklichkeit eine unge-
formte Masse, die doch klein bleibt am Maßstab der Land-
schaft gemessen, die sie beherrschen sollte. Das Leipziger
Völkerschlachtdenkmal ist nicht das einzige, das Schmitz
vollendet sehen durfte, auf dem Kyffhäuser, am Deutschen
Eck und an der Porta Westfalica stehen andere Schöpfungen
seiner fruchtbaren Phantasie, und auch weit in die Ferne
reichte seine Wirksamkeit, bis nach Indianapolis, wo er ein
Siegesdenkmal schuf, und nach Rom, wo seine Ideen
in dem Nationaldenkmal fruchtbar wurden, in dessen Kon-
kurrenzausschreiben ihm der erste Preis zugefallen war.
Auf seine Denkmalbauten gründet sich der Ruhm Bruno
Schmitz'! Es wäre unrecht, über ihnen seine Nutzbauten
zu vergessen, vor allem das Landesmuseum in Linz, das
er als Sechsundzwanzigjähriger schuf, und die Bank in
St. Gallen. In Berlin selbst ist sein bekanntestes Werk
das Weinhaus »Rheingold«. Was Bruno Schmitz als Künstler
war und wollte, ist in diesem Bau Gestalt geworden. In
Maßen und Formen sollte alles Hergebrachte übertroffen,
ein ungeheurer Prunk entfaltet werden. Aber es blieb
doch nur ein scheinhaftes Wesen, und man muß hinüber-
blicken zu dem benachbarten Wertheimbau Messels, um
zu empfinden, wie viel die Tradition auch in kühnstem
Wollen, in freiester Neugestaltung bedeutet. Es war ein
genialischer Zug in allem, was Bruno Schmitz plante und
wollte. Sein Schaffen war ein Widerspruch gegen den
akademischen Eklektizismus der Raschdorffund Ihne, denen
die wichtigsten öffentlichen Aufträge der Zeit zufielen. Aber
ihm war jene glückliche Mischung von Phantasie und
Bildung, von Schöpfergabe und Einfühlungstalent versagt,
die Messel statt seiner zum ersten Meister der neuen
Reichshauptstadt werden ließ.
Einer unserer dänischen Mitarbeiter sendet uns zu
dem schon früher gemeldeten Tode (3. Februar) von
Hammershöi folgende Charakteristik des Meisters: Der
Maler Vilhelm Hammershöi ist unter allen dänischen
Künstlern der Neuzeit vielleicht der einzige von Weltruf;
denn der ihn geistig allerdings überragende Monumental-
meister Joakim Skovgaard wird wohl schwerlich außer-
halb der Kreise der Kunstforscher genügend gekannt und
nach seinem hohen Werte gewürdigt sein. Sowohl in
öffentlichen Galerien als in zahlreichen Privatsammlungen
der großen Kulturländer ist Hammershöi durch Hauptwerke
vertreten; bei den Weltausstellungen, z. B.München 1891,
wurden ihm die höchsten Auszeichnungen zugesprochen;
im Jahre 1914 war er unter den wenigen Nichtitalienern,
welche mit dem großen Ehrenpreise von 10000 Lire aus
Rom gingen. Mehrmals kam ihm von der Florentiner Uffizien-
galerie der Auftrag zu, für die dortige Sammlung von
Meisterbildnissen das seinige zu malen; es war ihm jedoch
nicht vergönnt, den Gedanken verwirklicht zu sehen.
Äußerlich hat »der stille Maler der stillen Stuben« nur
wenig erlebt. Als Sohn eines gutsituierten Kaufmannes
sah er am 15. Mai 1864 zum ersten Male das Licht, dem
er später so manchen wunderbaren Lobgesang singen sollte,
schwankte in seinen Jugendjahren zwischen dem Beruf
eines Tonkünstlers und dem eines Malers, wählte den
letzteren, studierte einige Jahre an der Königl. Dänischen
Kunstakademie, fand sich jedoch von dem hartgesotten
akademischen, die malerische Seite der Sache wenig berück-
sichtigenden Unterrichte wenig angesprochen und siedelte
nach der Malerschule, die kurz vorher von dem trefflichen
P, S. Kröyer errichtet worden war, über. Wieviel er dort
gelernt hat, läßt sich nur schwer sagen. Als Hammershöi
bei Kröyer eintrat, sah dieser bald ein, daß hier von
einem tiefer eindringenden Unterricht gar nicht die Rede
sein konnte; dazu waren die Künstlertemperamente, die
Formensprache und noch mehr die Farbenempfindung des
schon Gereiften zu abweichend — auch kam noch dazu,
daß der ebenso feinsinnige wie selbstsichere Kröyer sich
von dem Gedanken entschieden abgestoßen fühlen mußte,
einem hochbegabten Schüler, der sich vor dem Eintritt ins
Meisteratelier eine vollkommen persönliche und mit seinem
Naturell genau übereinstimmende Technik selbst geschaffen
und angeeignet halte, eine neueaufzudrängen. Wasursprüng-
lich auf Hammershöi von Kröyer anregend, ja imponierend
wirkte, war in erster Reihe die prachtvolle Frische, die
hinreißende Gewalt des »himmelhochjauchzenden« Drauflos-
gehens, die im gleichen Zuge bewußte und doch reflexions-
freie Unmittelbarkeit des geborenen, gottbegnadeten Malers.
Man ist berechtigt, Vilhelm Hammershöi einen Auto-
didakten zu nennen. Von gleichzeitigen Malerateliers hat
er das wenigst mögliche nach den großen Rokoko- und
Empireräumen mit ihren mit sanften Goldstreifen und
Ornamenten geschmückten Wänden, wo er am liebsten
wirkte, mit sich getragen. Daß er von dem Delfter Ver-
meer gelernt hat, steht fest; mit ihm hat Vilhelm Hammers-
höi die Vorwürfe, die einfache Komposition und die feine
Auflösung der Lichtskala gemein; das Kolorit ist aber bei
den Zweien überaus verschieden; von der Kraft und Glut
des Delfters, dem Reichtum seiner Palette hat der Däne
nichts. Fast nie führt sein Pinsel der Leinwand andere
Farben zu, als die schwarze, die weiße und die fahlgelbe;
für die Hervorzauberung ganz verblüffender musikalischer
und malerischer Wirkungen sind diese ihm ausreichend.
Eine sanfte lyrische Stimmung strömt von seinen Bildern
dem Beschauer entgegen. Von Erzählung, Handlung trifft
man in seinen Bildern, die uns nur ganz ausnahmsweise
mehr als eine einzige Person vor Augen führen, nicht die
leiseste Andeutung; was er uns bringt, ist nur das, was
sich in seinem tief empfundenen Innern rührt, die Stim-
mung, die ihm seine einfachen Vorwürfe aufdrängen,
die Musik, die sie in seinem Ohr erklingen lassen. Kaum
hat wohl jemand mit vollkommenerer Sicherheit als
Hammershöi mit so wenigen Mitteln so vieles erreicht.
Als Zeichner des menschlichen Körpers steht er entschieden
in erster Reihe. Wie schwer er in dieser Beziehung seine
eigenen Forderungen befriedigt fühlt, davon geben die
zahlreichen gemalten und mit dem feinsten Gefühle und
innigsten Verständnisse gezeichneten Aktstudien und anderen
Vorarbeiten, die sich in seinem Nachlasse finden, Zeugnis.
Als der junge Vilhelm Hammershöi seinen ersten
Erfolg erlebte, geschah es in einer Kunstperiode, in der