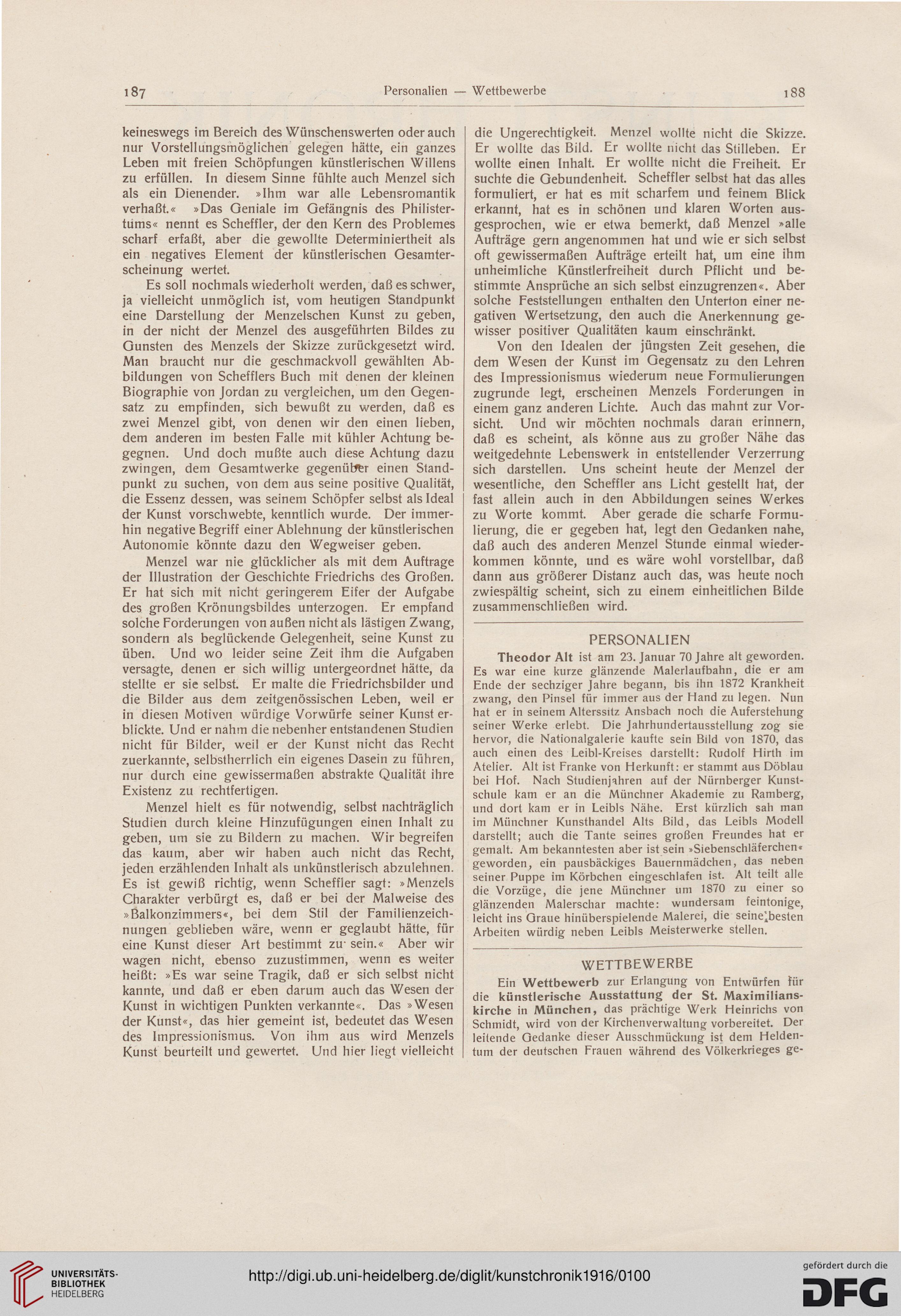18?
Personalien — Wettbewerbe
188
keineswegs im Bereich des Wünschenswerten oder auch
nur Vorstellungsmöglichen gelegen hätte, ein ganzes
Leben mit freien Schöpfungen künstlerischen Willens
zu erfüllen. In diesem Sinne fühlte auch Menzel sich
als ein Dienender. »Ihm war alle Lebensromantik
verhaßt.« »Das Geniale im Gefängnis des Philister-
tums« nennt es Schettler, der den Kern des Problemes
scharf erfaßt, aber die gewollte Determiniertheit als
ein negatives Element der künstlerischen Gesamter-
scheinung wertet.
Es soll nochmals wiederholt werden, daß es schwer,
ja vielleicht unmöglich ist, vom heutigen Standpunkt
eine Darstellung der Menzelschen Kunst zu geben,
in der nicht der Menzel des ausgeführten Bildes zu
Gunsten des Menzels der Skizze zurückgesetzt wird.
Man braucht nur die geschmackvoll gewählten Ab-
bildungen von Schettlers Buch mit denen der kleinen
Biographie von Jordan zu vergleichen, um den Gegen-
satz zu empfinden, sich bewußt zu werden, daß es
zwei Menzel gibt, von denen wir den einen lieben,
dem anderen im besten Falle mit kühler Achtung be-
gegnen. Und doch mußte auch diese Achtung dazu
zwingen, dem Gesamtwerke gegenüber einen Stand-
punkt zu suchen, von dem aus seine positive Qualität,
die Essenz dessen, was seinem Schöpfer selbst als Ideal
der Kunst vorschwebte, kenntlich wurde. Der immer-
hin negative Begriff einer Ablehnung der künstlerischen
Autonomie könnte dazu den Wegweiser geben.
Menzel war nie glücklicher als mit dem Auftrage
der Illustration der Geschichte Friedrichs des Großen.
Er hat sich mit nicht geringerem Eifer der Aufgabe
des großen Krönungsbildes unterzogen. Er empfand
solche Forderungen von außen nicht als lästigen Zwang,
sondern als beglückende Gelegenheit, seine Kunst zu
üben. Und wo leider seine Zeit ihm die Aufgaben
versagte, denen er sich willig untergeordnet hätte, da
stellte er sie selbst. Er malte die Friedrichsbilder und
die Bilder aus dem zeitgenössischen Leben, weil er
in diesen Motiven würdige Vorwürfe seiner Kunst er-
blickte. Und er nahm die nebenher entstandenen Studien
nicht für Bilder, weil er der Kunst nicht das Recht
zuerkannte, selbstherrlich ein eigenes Dasein zu führen,
nur durch eine gewissermaßen abstrakte Qualität ihre
Existenz zu rechtfertigen.
Menzel hielt es für notwendig, selbst nachträglich
Studien durch kleine Hinzufügungen einen Inhalt zu
geben, um sie zu Bildern zu machen. Wir begreifen
das kaum, aber wir haben auch nicht das Recht,
jeden erzählenden Inhalt als unkünstlerisch abzulehnen.
Es ist gewiß richtig, wenn Scheffier sagt: »Menzels
Charakter verbürgt es, daß er bei der Malweise des
»Balkonzimmers«, bei dem Stil der Familienzeich-
nungen geblieben wäre, wenn er geglaubt hätte, für
eine Kunst dieser Art bestimmt zu- sein.« Aber wir
wagen nicht, ebenso zuzustimmen, wenn es weiter
heißt: »Es war seine Tragik, daß er sich selbst nicht
kannte, und daß er eben darum auch das Wesen der
Kunst in wichtigen Punkten verkannte«. Das »Wesen
der Kunst«, das hier gemeint ist, bedeutet das Wesen
des Impressionismus. Von ihm aus wird Menzels
Kunst beurteilt und gewertet. Und hier liegt vielleicht
die Ungerechtigkeit. Menzel wollte nicht die Skizze.
Er wollte das Bild. Er wollte nicht das Stilleben. Er
wollte einen Inhalt. Er wollte nicht die Freiheit. Er
suchte die Gebundenheit. Scheffier selbst hat das alles
formuliert, er hat es mit scharfem und feinem Blick
erkannt, hat es in schönen und klaren Worten aus-
gesprochen, wie er etwa bemerkt, daß Menzel »alle
Aufträge gern angenommen hat und wie er sich selbst
oft gewissermaßen Aufträge erteilt hat, um eine ihm
unheimliche Künstlerfreiheit durch Pflicht und be-
stimmte Ansprüche an sich selbst einzugrenzen«. Aber
solche Feststellungen enthalten den Unterton einer ne-
gativen Wertsetzung, den auch die Anerkennung ge-
wisser positiver Qualitäten kaum einschränkt.
Von den Idealen der jüngsten Zeit gesehen, die
dem Wesen der Kunst im Gegensatz zu den Lehren
des Impressionismus wiederum neue Formulierungen
zugrunde legt, erscheinen Menzels Forderungen in
einem ganz anderen Lichte. Auch das mahnt zur Vor-
sicht. Und wir möchten nochmals daran erinnern,
daß es scheint, als könne aus zu großer Nähe das
weitgedehnte Lebenswerk in entstellender Verzerrung
sich darstellen. Uns scheint heute der Menzel der
wesentliche, den Scheffier ans Licht gestellt hat, der
fast allein auch in den Abbildungen seines Werkes
zu Worte kommt. Aber gerade die scharfe Formu-
lierung, die er gegeben hat, legt den Gedanken nahe,
daß auch des anderen Menzel Stunde einmal wieder-
kommen könnte, und es wäre wohl vorstellbar, daß
dann aus größerer Distanz auch das, was heute noch
zwiespältig scheint, sich zu einem einheitlichen Bilde
zusammenschließen wird.
PERSONALIEN
Theodor Alt ist am 23. Januar 70 Jahre alt geworden.
Es war eine kurze glänzende Malerlaufbahn, die er am
Ende der sechziger Jahre begann, bis ihn 1872 Krankheit
zwang, den Pinsel für immer aus der Hand zu legen. Nun
hat er in seinem Alterssitz Ansbach noch die Auferstehung
seiner Werke erlebt. Die Jahrhundertausstellung zog sie
hervor, die Nationalgalerie kaufte sein Bild von 1870, das
auch einen des Leibi-Kreises darstellt: Rudolf Hirth im
Atelier. Alt ist Franke von Herkunft: er stammt aus Döblau
bei Hof. Nach Studienjahren auf der Nürnberger Kunst-
schule kam er an die Münchner Akademie zu Ramberg,
und dort kam er in Leibis Nähe. Erst kürzlich sah man
im Münchner Kunsthandel Alts Bild, das Leibis Modell
darstellt; auch die Tante seines großen Freundes hat er
gemalt. Am bekanntesten aber ist sein »Siebenschläferchen*
geworden, ein pausbäckiges Bauernmädchen, das neben
seiner Puppe im Körbchen eingeschlafen ist. Alt teilt alle
die Vorzüge, die jene Münchner um 1870 zu einer so
glänzenden Malerschar machte: wundersam feintonige,
leicht ins Graue hinüberspielende Malerei, die seine^besten
Arbeiten würdig neben Leibis Meisterwerke stellen.
WETTBEWERBE
Ein Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für
die künstlerische Ausstattung der St. Maximilians-
kirche in München, das prächtige Werk Heinrichs von
Schmidt, wird von der Kirchenverwaltung vorbereitet. Der
leitende Oedanke dieser Ausschmückung ist dem Helden-
tum der deutschen Frauen während des Völkerkrieges ge-
Personalien — Wettbewerbe
188
keineswegs im Bereich des Wünschenswerten oder auch
nur Vorstellungsmöglichen gelegen hätte, ein ganzes
Leben mit freien Schöpfungen künstlerischen Willens
zu erfüllen. In diesem Sinne fühlte auch Menzel sich
als ein Dienender. »Ihm war alle Lebensromantik
verhaßt.« »Das Geniale im Gefängnis des Philister-
tums« nennt es Schettler, der den Kern des Problemes
scharf erfaßt, aber die gewollte Determiniertheit als
ein negatives Element der künstlerischen Gesamter-
scheinung wertet.
Es soll nochmals wiederholt werden, daß es schwer,
ja vielleicht unmöglich ist, vom heutigen Standpunkt
eine Darstellung der Menzelschen Kunst zu geben,
in der nicht der Menzel des ausgeführten Bildes zu
Gunsten des Menzels der Skizze zurückgesetzt wird.
Man braucht nur die geschmackvoll gewählten Ab-
bildungen von Schettlers Buch mit denen der kleinen
Biographie von Jordan zu vergleichen, um den Gegen-
satz zu empfinden, sich bewußt zu werden, daß es
zwei Menzel gibt, von denen wir den einen lieben,
dem anderen im besten Falle mit kühler Achtung be-
gegnen. Und doch mußte auch diese Achtung dazu
zwingen, dem Gesamtwerke gegenüber einen Stand-
punkt zu suchen, von dem aus seine positive Qualität,
die Essenz dessen, was seinem Schöpfer selbst als Ideal
der Kunst vorschwebte, kenntlich wurde. Der immer-
hin negative Begriff einer Ablehnung der künstlerischen
Autonomie könnte dazu den Wegweiser geben.
Menzel war nie glücklicher als mit dem Auftrage
der Illustration der Geschichte Friedrichs des Großen.
Er hat sich mit nicht geringerem Eifer der Aufgabe
des großen Krönungsbildes unterzogen. Er empfand
solche Forderungen von außen nicht als lästigen Zwang,
sondern als beglückende Gelegenheit, seine Kunst zu
üben. Und wo leider seine Zeit ihm die Aufgaben
versagte, denen er sich willig untergeordnet hätte, da
stellte er sie selbst. Er malte die Friedrichsbilder und
die Bilder aus dem zeitgenössischen Leben, weil er
in diesen Motiven würdige Vorwürfe seiner Kunst er-
blickte. Und er nahm die nebenher entstandenen Studien
nicht für Bilder, weil er der Kunst nicht das Recht
zuerkannte, selbstherrlich ein eigenes Dasein zu führen,
nur durch eine gewissermaßen abstrakte Qualität ihre
Existenz zu rechtfertigen.
Menzel hielt es für notwendig, selbst nachträglich
Studien durch kleine Hinzufügungen einen Inhalt zu
geben, um sie zu Bildern zu machen. Wir begreifen
das kaum, aber wir haben auch nicht das Recht,
jeden erzählenden Inhalt als unkünstlerisch abzulehnen.
Es ist gewiß richtig, wenn Scheffier sagt: »Menzels
Charakter verbürgt es, daß er bei der Malweise des
»Balkonzimmers«, bei dem Stil der Familienzeich-
nungen geblieben wäre, wenn er geglaubt hätte, für
eine Kunst dieser Art bestimmt zu- sein.« Aber wir
wagen nicht, ebenso zuzustimmen, wenn es weiter
heißt: »Es war seine Tragik, daß er sich selbst nicht
kannte, und daß er eben darum auch das Wesen der
Kunst in wichtigen Punkten verkannte«. Das »Wesen
der Kunst«, das hier gemeint ist, bedeutet das Wesen
des Impressionismus. Von ihm aus wird Menzels
Kunst beurteilt und gewertet. Und hier liegt vielleicht
die Ungerechtigkeit. Menzel wollte nicht die Skizze.
Er wollte das Bild. Er wollte nicht das Stilleben. Er
wollte einen Inhalt. Er wollte nicht die Freiheit. Er
suchte die Gebundenheit. Scheffier selbst hat das alles
formuliert, er hat es mit scharfem und feinem Blick
erkannt, hat es in schönen und klaren Worten aus-
gesprochen, wie er etwa bemerkt, daß Menzel »alle
Aufträge gern angenommen hat und wie er sich selbst
oft gewissermaßen Aufträge erteilt hat, um eine ihm
unheimliche Künstlerfreiheit durch Pflicht und be-
stimmte Ansprüche an sich selbst einzugrenzen«. Aber
solche Feststellungen enthalten den Unterton einer ne-
gativen Wertsetzung, den auch die Anerkennung ge-
wisser positiver Qualitäten kaum einschränkt.
Von den Idealen der jüngsten Zeit gesehen, die
dem Wesen der Kunst im Gegensatz zu den Lehren
des Impressionismus wiederum neue Formulierungen
zugrunde legt, erscheinen Menzels Forderungen in
einem ganz anderen Lichte. Auch das mahnt zur Vor-
sicht. Und wir möchten nochmals daran erinnern,
daß es scheint, als könne aus zu großer Nähe das
weitgedehnte Lebenswerk in entstellender Verzerrung
sich darstellen. Uns scheint heute der Menzel der
wesentliche, den Scheffier ans Licht gestellt hat, der
fast allein auch in den Abbildungen seines Werkes
zu Worte kommt. Aber gerade die scharfe Formu-
lierung, die er gegeben hat, legt den Gedanken nahe,
daß auch des anderen Menzel Stunde einmal wieder-
kommen könnte, und es wäre wohl vorstellbar, daß
dann aus größerer Distanz auch das, was heute noch
zwiespältig scheint, sich zu einem einheitlichen Bilde
zusammenschließen wird.
PERSONALIEN
Theodor Alt ist am 23. Januar 70 Jahre alt geworden.
Es war eine kurze glänzende Malerlaufbahn, die er am
Ende der sechziger Jahre begann, bis ihn 1872 Krankheit
zwang, den Pinsel für immer aus der Hand zu legen. Nun
hat er in seinem Alterssitz Ansbach noch die Auferstehung
seiner Werke erlebt. Die Jahrhundertausstellung zog sie
hervor, die Nationalgalerie kaufte sein Bild von 1870, das
auch einen des Leibi-Kreises darstellt: Rudolf Hirth im
Atelier. Alt ist Franke von Herkunft: er stammt aus Döblau
bei Hof. Nach Studienjahren auf der Nürnberger Kunst-
schule kam er an die Münchner Akademie zu Ramberg,
und dort kam er in Leibis Nähe. Erst kürzlich sah man
im Münchner Kunsthandel Alts Bild, das Leibis Modell
darstellt; auch die Tante seines großen Freundes hat er
gemalt. Am bekanntesten aber ist sein »Siebenschläferchen*
geworden, ein pausbäckiges Bauernmädchen, das neben
seiner Puppe im Körbchen eingeschlafen ist. Alt teilt alle
die Vorzüge, die jene Münchner um 1870 zu einer so
glänzenden Malerschar machte: wundersam feintonige,
leicht ins Graue hinüberspielende Malerei, die seine^besten
Arbeiten würdig neben Leibis Meisterwerke stellen.
WETTBEWERBE
Ein Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für
die künstlerische Ausstattung der St. Maximilians-
kirche in München, das prächtige Werk Heinrichs von
Schmidt, wird von der Kirchenverwaltung vorbereitet. Der
leitende Oedanke dieser Ausschmückung ist dem Helden-
tum der deutschen Frauen während des Völkerkrieges ge-