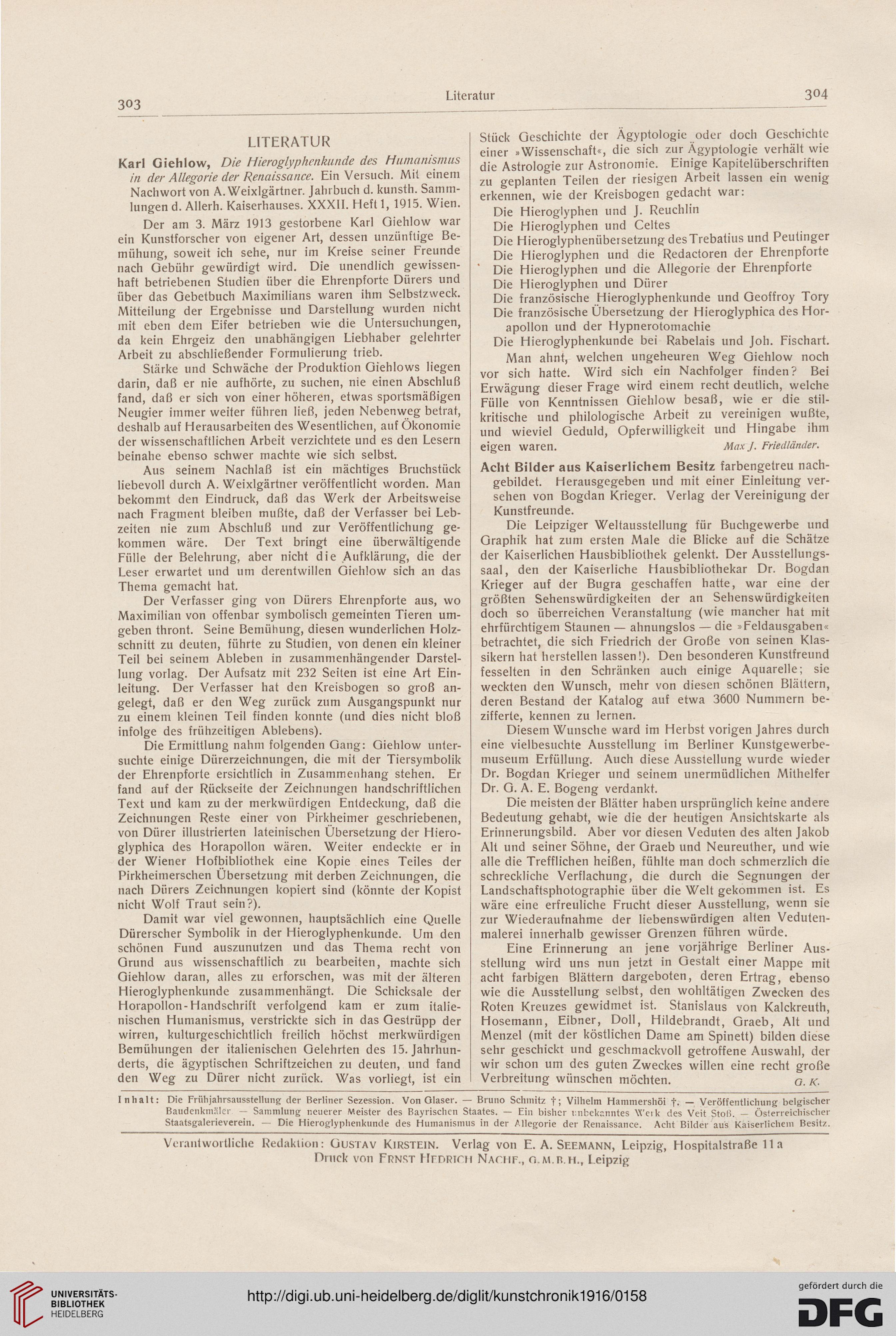303
Literatur
304
LITERATUR
Karl Giehlow, Die Hieroglyphcnkuiide des Humanismus
in der Allegorie der Renaissance. Ein Versuch. Mit einem
Nachwort von A. Weixlgärtner. Jahrbuch d. kunsth. Samm-
lungen d. Alierh. Kaiserhauses. XXXII. Heft 1, 1915. Wien.
Der am 3. März 1913 gestorbene Karl Giehlow war
ein Kunstforscher von eigener Art, dessen unzünftige Be-
mühung, soweit ich sehe, nur im Kreise seiner Freunde
nach Gebühr gewürdigt wird. Die unendlich gewissen-
haft betriebenen Studien über die Ehrenpforte Dürers und
über das Gebetbuch Maximilians waren ihm Selbstzweck.
Mitteilung der Ergebnisse und Darstellung wurden nicht
mit eben dem Eifer betrieben wie die Untersuchungen,
da kein Ehrgeiz den unabhängigen Liebhaber gelehrter
Arbeit zu abschließender Formulierung trieb.
Stärke und Schwäche der Produktion Giehlows liegen
darin, daß er nie aufhörte, zu suchen, nie einen Abschluß
fand, daß er sich von einer höheren, etwas sportsmäßigen
Neugier immer weiter führen ließ, jeden Nebenweg betrat,
deshalb auf Herausarbeiten des Wesentlichen, auf Ökonomie
der wissenschaftlichen Arbeit verzichtete und es den Lesern
beinahe ebenso schwer machte wie sich selbst.
Aus seinem Nachlaß ist ein mächtiges Bruchstück
liebevoll durch A. Weixlgärtner veröffentlicht worden. Man
bekommt den Eindruck, daß das Werk der Arbeitsweise
nach Fragment bleiben mußte, daß der Verfasser bei Leb-
zeiten nie zum Abschluß und zur Veröffentlichung ge-
kommen wäre. Der Text bringt eine überwältigende
Fülle der Belehrung, aber nicht die Aufklärung, die der
Leser erwartet und um derentwillen Giehlow sich an das
Thema gemacht hat.
Der Verfasser ging von Dürers Ehrenpforte aus, wo
Maximilian von offenbar symbolisch gemeinten Tieren um-
geben thront. Seine Bemühung, diesen wunderlichen Holz-
schnitt zu deuten, führte zu Studien, von denen ein kleiner
Teil bei seinem Ableben in zusammenhängender Darstel-
lung vorlag. Der Aufsatz mit 232 Seiten ist eine Art Ein-
leitung. Der Verfasser hat den Kreisbogen so groß an-
gelegt, daß er den Weg zurück zum Ausgangspunkt nur
zu einem kleinen Teil finden konnte (und dies nicht bloß
infolge des frühzeitigen Ablebens).
Die Ermittlung nahm folgenden Gang: Giehlow unter-
suchte einige Dürerzeichnungen, die mit der Tiersymbolik
der Ehrenpforte ersichtlich in Zusammenhang stehen. Er
fand auf der Rückseite der Zeichnungen handschriftlichen
Text und kam zu der merkwürdigen Entdeckung, daß die
Zeichnungen Reste einer von Pirkheimer geschriebenen,
von Dürer illustrierten lateinischen Übersetzung der Hiero-
glyphica des Horapollon wären. Weiter endeckte er in
der Wiener Hofbibliothek eine Kopie eines Teiles der
Pirkheimerschen Übersetzung mit derben Zeichnungen, die
nach Dürers Zeichnungen kopiert sind (könnte der Kopist
nicht Wolf Traut sein?).
Damit war viel gewonnen, hauptsächlich eine Quelle
Dürerscher Symbolik in der Hieroglyphenkunde. Um den
schönen Fund auszunutzen und das Thema recht von
Grund aus wissenschaftlich zu bearbeiten, machte sich
Giehlow daran, alles zu erforschen, was mit der älteren
Hieroglyphenkunde zusammenhängt. Die Schicksale der
Horapollon-Handschrift verfolgend kam er zum italie-
nischen Humanismus, verstrickte sich in das Gestrüpp der
wirren, kulturgeschichtlich freilich höchst merkwürdigen
Bemühungen der italienischen Gelehrten des 15. Jahrhun-
derts, die ägyptischen Schriftzeichen zu deuten, und fand
den Weg zu Dürer nicht zurück. Was vorliegt, ist ein
Stück Geschichte der Ägyptologie oder doch Geschichte
einer »Wissenschaft«, die sich zur Ägyptologie verhält wie
die Astrologie zur Astronomie. Einige Kapitelüberschriften
zu geplanten Teilen der riesigen Arbeit lassen ein wenig
erkennen, wie der Kreisbogen gedacht war:
Die Hieroglyphen und J. Reuchlin
Die Hieroglyphen und Celtes
Die Hieroglyphenübersetzung desTrebatius und Peutinger
Die Hieroglyphen und die Redactoren der Ehrenpforte
Die Hieroglyphen und die Allegorie der Ehrenpforte
Die Hieroglyphen und Dürer
Die französische Hieroglyphenkunde und Geoffroy Tory
Die französische Übersetzung der Hieroglyphica des Hor-
apollon und der Hypnerotomachie
Die Hieroglyphenkunde bei Rabelais und Job. Fischart.
Man ahnt, welchen ungeheuren Weg Giehlow noch
vor sich hatte. Wird sich ein Nachfolger finden? Bei
Erwägung dieser Frage wird einem recht deutlich, welche
Fülle von Kenntnissen Giehlow besaß, wie er die stil-
kritische und philologische Arbeit zu vereinigen wußte,
und wieviel Geduld, Opferwilligkeit und Hingabe ihm
eigen waren. Max J. Friedländer.
Acht Bilder aus Kaiserlichem Besitz farbengetreu nach-
gebildet. Herausgegeben und mit einer Einleitung ver-
sehen von Bogdan Krieger. Verlag der Vereinigung der
Kunstfreunde.
Die Leipziger Weltausstellung für Buchgewerbe und
Graphik hat zum ersten Male die Blicke auf die Schätze
der Kaiserlichen Hausbibliothek gelenkt. Der Ausstellungs-
saal, den der Kaiserliche Hausbibliothekar Dr. Bogdan
Krieger auf der Bugra geschaffen hatte, war eine der
größten Sehenswürdigkeiten der an Sehenswürdigkeilen
doch so überreichen Veranstaltung (wie mancher hat mit
ehrfürchtigem Staunen — ahnungslos — die »Feldausgaben«
betrachtet, die sich Friedrich der Große von seinen Klas-
sikern hat herstellen lassen!). Den besonderen Kunstfreund
fesselten in den Schränken auch einige Aquarelle; sie
weckten den Wunsch, mehr von diesen schönen Blättern,
deren Bestand der Katalog auf etwa 3600 Nummern be-
zifferte, kennen zu lernen.
Diesem Wunsche ward im Herbst vorigen Jahres durch
eine vielbesuchte Ausstellung im Berliner Kunstgewerbe-
museum Erfüllung. Auch diese Ausstellung wurde wieder
Dr. Bogdan Krieger und seinem unermüdlichen Mithelfer
Dr. G. A. E. Bogeng verdankt.
Die meisten der Blätter haben ursprünglich keine andere
Bedeutung gehabt, wie die der heutigen Ansichtskarte als
Erinnerungsbild. Aber vor diesen Veduten des alten Jakob
Alt und seiner Söhne, der Graeb und Neureuther, und wie
alle die Trefflichen heißen, fühlte man doch schmerzlich die
schreckliche Verflachung, die durch die Segnungen der
Landschaftsphotographie über die Welt gekommen ist. Es
wäre eine erfreuliche Frucht dieser Ausstellung, wenn sie
zur Wiederaufnahme der liebenswürdigen alten Veduten-
malerei innerhalb gewisser Grenzen führen würde.
Eine Erinnerung an jene vorjährige Berliner Aus-
stellung wird uns nun jetzt in Gestalt einer Mappe mit
acht farbigen Blättern dargeboten, deren Ertrag, ebenso
wie die Ausstellung selbst, den wohltätigen Zwecken des
Roten Kreuzes gewidmet ist. Stanislaus von Kalckreuth,
Hosemann, Eibner, Doli, Hildebrandt, Graeb, Alt und
Menzel (mit der köstlichen Dame am Spinett) bilden diese
sehr geschickt und geschmackvoll getroffene Auswahl, der
wir schon um des guten Zweckes willen eine recht große
Verbreitung wünschen möchten. q. k.
Inhalt: Die Frühjahrsausstellung der Berliner Sezession. Von Olaser. — Bruno Schmitz f; Vilhelm Hammershöi f. — Veröffentlichung belgischer
Baudenkmäler - Sammlung neuerer Meister des Bayrischen Staates. — Ein bisher unbekanntes W'cik des Veit Stoli. - Österreichischer
_Staatsgalerieverein. — Die Hieroglyplienkunde des Humanismus in der Allegorie der Renaissance. Acht Bilder aus Kaiserlichem Besitz.
Verantwortliche Redaktion: Gustav Kirstein. Verlag von E. A. Seemann, Leipzig, Hospitalstraße 11 a
Druck von Frnst HrDRim Nacht., o.m.b.H., Leipzig
Literatur
304
LITERATUR
Karl Giehlow, Die Hieroglyphcnkuiide des Humanismus
in der Allegorie der Renaissance. Ein Versuch. Mit einem
Nachwort von A. Weixlgärtner. Jahrbuch d. kunsth. Samm-
lungen d. Alierh. Kaiserhauses. XXXII. Heft 1, 1915. Wien.
Der am 3. März 1913 gestorbene Karl Giehlow war
ein Kunstforscher von eigener Art, dessen unzünftige Be-
mühung, soweit ich sehe, nur im Kreise seiner Freunde
nach Gebühr gewürdigt wird. Die unendlich gewissen-
haft betriebenen Studien über die Ehrenpforte Dürers und
über das Gebetbuch Maximilians waren ihm Selbstzweck.
Mitteilung der Ergebnisse und Darstellung wurden nicht
mit eben dem Eifer betrieben wie die Untersuchungen,
da kein Ehrgeiz den unabhängigen Liebhaber gelehrter
Arbeit zu abschließender Formulierung trieb.
Stärke und Schwäche der Produktion Giehlows liegen
darin, daß er nie aufhörte, zu suchen, nie einen Abschluß
fand, daß er sich von einer höheren, etwas sportsmäßigen
Neugier immer weiter führen ließ, jeden Nebenweg betrat,
deshalb auf Herausarbeiten des Wesentlichen, auf Ökonomie
der wissenschaftlichen Arbeit verzichtete und es den Lesern
beinahe ebenso schwer machte wie sich selbst.
Aus seinem Nachlaß ist ein mächtiges Bruchstück
liebevoll durch A. Weixlgärtner veröffentlicht worden. Man
bekommt den Eindruck, daß das Werk der Arbeitsweise
nach Fragment bleiben mußte, daß der Verfasser bei Leb-
zeiten nie zum Abschluß und zur Veröffentlichung ge-
kommen wäre. Der Text bringt eine überwältigende
Fülle der Belehrung, aber nicht die Aufklärung, die der
Leser erwartet und um derentwillen Giehlow sich an das
Thema gemacht hat.
Der Verfasser ging von Dürers Ehrenpforte aus, wo
Maximilian von offenbar symbolisch gemeinten Tieren um-
geben thront. Seine Bemühung, diesen wunderlichen Holz-
schnitt zu deuten, führte zu Studien, von denen ein kleiner
Teil bei seinem Ableben in zusammenhängender Darstel-
lung vorlag. Der Aufsatz mit 232 Seiten ist eine Art Ein-
leitung. Der Verfasser hat den Kreisbogen so groß an-
gelegt, daß er den Weg zurück zum Ausgangspunkt nur
zu einem kleinen Teil finden konnte (und dies nicht bloß
infolge des frühzeitigen Ablebens).
Die Ermittlung nahm folgenden Gang: Giehlow unter-
suchte einige Dürerzeichnungen, die mit der Tiersymbolik
der Ehrenpforte ersichtlich in Zusammenhang stehen. Er
fand auf der Rückseite der Zeichnungen handschriftlichen
Text und kam zu der merkwürdigen Entdeckung, daß die
Zeichnungen Reste einer von Pirkheimer geschriebenen,
von Dürer illustrierten lateinischen Übersetzung der Hiero-
glyphica des Horapollon wären. Weiter endeckte er in
der Wiener Hofbibliothek eine Kopie eines Teiles der
Pirkheimerschen Übersetzung mit derben Zeichnungen, die
nach Dürers Zeichnungen kopiert sind (könnte der Kopist
nicht Wolf Traut sein?).
Damit war viel gewonnen, hauptsächlich eine Quelle
Dürerscher Symbolik in der Hieroglyphenkunde. Um den
schönen Fund auszunutzen und das Thema recht von
Grund aus wissenschaftlich zu bearbeiten, machte sich
Giehlow daran, alles zu erforschen, was mit der älteren
Hieroglyphenkunde zusammenhängt. Die Schicksale der
Horapollon-Handschrift verfolgend kam er zum italie-
nischen Humanismus, verstrickte sich in das Gestrüpp der
wirren, kulturgeschichtlich freilich höchst merkwürdigen
Bemühungen der italienischen Gelehrten des 15. Jahrhun-
derts, die ägyptischen Schriftzeichen zu deuten, und fand
den Weg zu Dürer nicht zurück. Was vorliegt, ist ein
Stück Geschichte der Ägyptologie oder doch Geschichte
einer »Wissenschaft«, die sich zur Ägyptologie verhält wie
die Astrologie zur Astronomie. Einige Kapitelüberschriften
zu geplanten Teilen der riesigen Arbeit lassen ein wenig
erkennen, wie der Kreisbogen gedacht war:
Die Hieroglyphen und J. Reuchlin
Die Hieroglyphen und Celtes
Die Hieroglyphenübersetzung desTrebatius und Peutinger
Die Hieroglyphen und die Redactoren der Ehrenpforte
Die Hieroglyphen und die Allegorie der Ehrenpforte
Die Hieroglyphen und Dürer
Die französische Hieroglyphenkunde und Geoffroy Tory
Die französische Übersetzung der Hieroglyphica des Hor-
apollon und der Hypnerotomachie
Die Hieroglyphenkunde bei Rabelais und Job. Fischart.
Man ahnt, welchen ungeheuren Weg Giehlow noch
vor sich hatte. Wird sich ein Nachfolger finden? Bei
Erwägung dieser Frage wird einem recht deutlich, welche
Fülle von Kenntnissen Giehlow besaß, wie er die stil-
kritische und philologische Arbeit zu vereinigen wußte,
und wieviel Geduld, Opferwilligkeit und Hingabe ihm
eigen waren. Max J. Friedländer.
Acht Bilder aus Kaiserlichem Besitz farbengetreu nach-
gebildet. Herausgegeben und mit einer Einleitung ver-
sehen von Bogdan Krieger. Verlag der Vereinigung der
Kunstfreunde.
Die Leipziger Weltausstellung für Buchgewerbe und
Graphik hat zum ersten Male die Blicke auf die Schätze
der Kaiserlichen Hausbibliothek gelenkt. Der Ausstellungs-
saal, den der Kaiserliche Hausbibliothekar Dr. Bogdan
Krieger auf der Bugra geschaffen hatte, war eine der
größten Sehenswürdigkeiten der an Sehenswürdigkeilen
doch so überreichen Veranstaltung (wie mancher hat mit
ehrfürchtigem Staunen — ahnungslos — die »Feldausgaben«
betrachtet, die sich Friedrich der Große von seinen Klas-
sikern hat herstellen lassen!). Den besonderen Kunstfreund
fesselten in den Schränken auch einige Aquarelle; sie
weckten den Wunsch, mehr von diesen schönen Blättern,
deren Bestand der Katalog auf etwa 3600 Nummern be-
zifferte, kennen zu lernen.
Diesem Wunsche ward im Herbst vorigen Jahres durch
eine vielbesuchte Ausstellung im Berliner Kunstgewerbe-
museum Erfüllung. Auch diese Ausstellung wurde wieder
Dr. Bogdan Krieger und seinem unermüdlichen Mithelfer
Dr. G. A. E. Bogeng verdankt.
Die meisten der Blätter haben ursprünglich keine andere
Bedeutung gehabt, wie die der heutigen Ansichtskarte als
Erinnerungsbild. Aber vor diesen Veduten des alten Jakob
Alt und seiner Söhne, der Graeb und Neureuther, und wie
alle die Trefflichen heißen, fühlte man doch schmerzlich die
schreckliche Verflachung, die durch die Segnungen der
Landschaftsphotographie über die Welt gekommen ist. Es
wäre eine erfreuliche Frucht dieser Ausstellung, wenn sie
zur Wiederaufnahme der liebenswürdigen alten Veduten-
malerei innerhalb gewisser Grenzen führen würde.
Eine Erinnerung an jene vorjährige Berliner Aus-
stellung wird uns nun jetzt in Gestalt einer Mappe mit
acht farbigen Blättern dargeboten, deren Ertrag, ebenso
wie die Ausstellung selbst, den wohltätigen Zwecken des
Roten Kreuzes gewidmet ist. Stanislaus von Kalckreuth,
Hosemann, Eibner, Doli, Hildebrandt, Graeb, Alt und
Menzel (mit der köstlichen Dame am Spinett) bilden diese
sehr geschickt und geschmackvoll getroffene Auswahl, der
wir schon um des guten Zweckes willen eine recht große
Verbreitung wünschen möchten. q. k.
Inhalt: Die Frühjahrsausstellung der Berliner Sezession. Von Olaser. — Bruno Schmitz f; Vilhelm Hammershöi f. — Veröffentlichung belgischer
Baudenkmäler - Sammlung neuerer Meister des Bayrischen Staates. — Ein bisher unbekanntes W'cik des Veit Stoli. - Österreichischer
_Staatsgalerieverein. — Die Hieroglyplienkunde des Humanismus in der Allegorie der Renaissance. Acht Bilder aus Kaiserlichem Besitz.
Verantwortliche Redaktion: Gustav Kirstein. Verlag von E. A. Seemann, Leipzig, Hospitalstraße 11 a
Druck von Frnst HrDRim Nacht., o.m.b.H., Leipzig