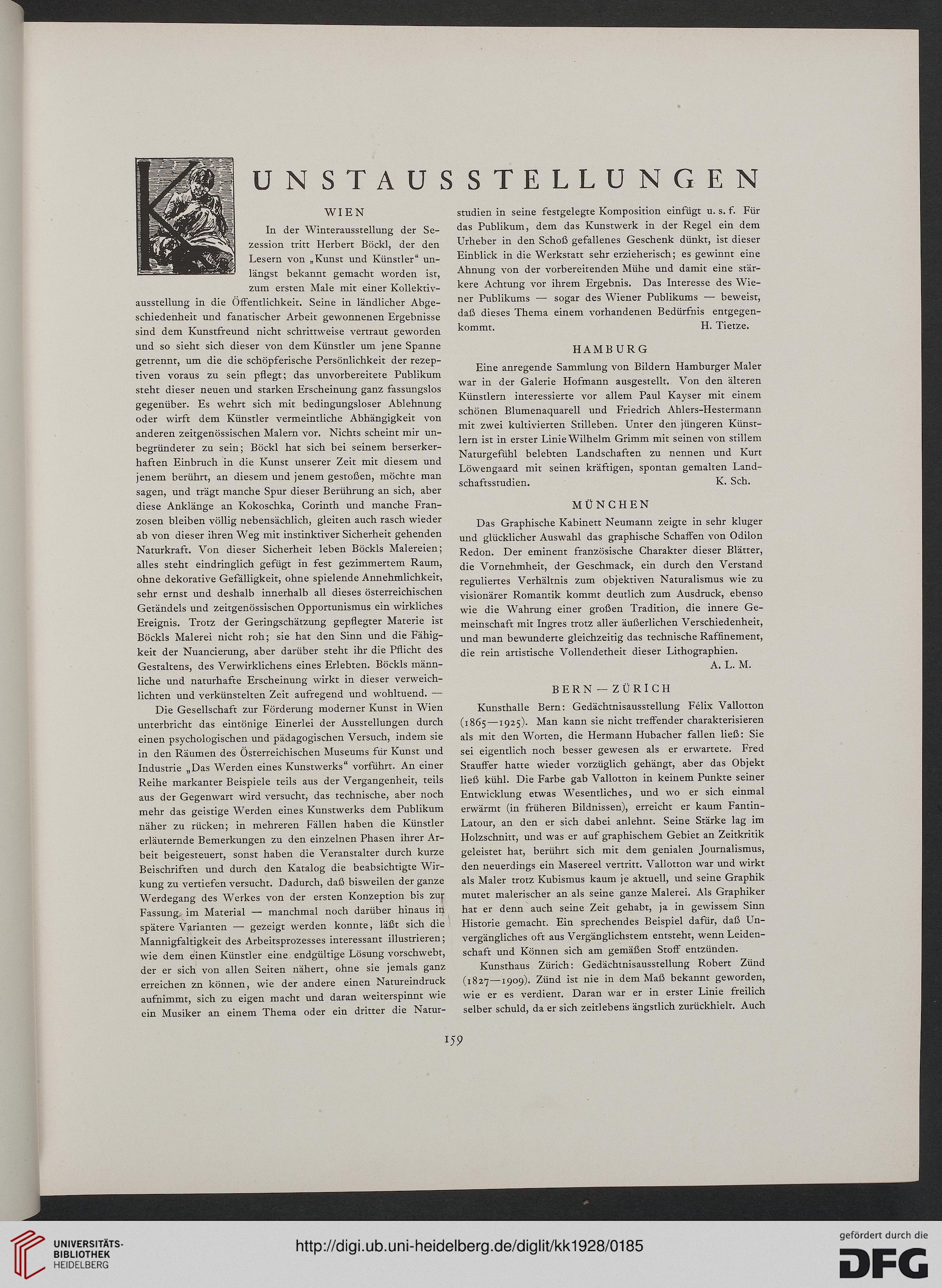UNSTAUSSTELLUNGEN
WIEN
In der Winterausstellung der Se-
zession tritt Herbert Böckl, der den
Lesern von „Kunst und Künstler" un-
längst bekannt gemacht worden ist,
zum ersten Male mit einer Kollektiv-
ausstellung in die Öffentlichkeit. Seine in ländlicher Abge-
schiedenheit und fanatischer Arbeit gewonnenen Ergebnisse
sind dem Kunstfreund nicht schrittweise vertraut geworden
und so sieht sich dieser von dem Künstler um jene Spanne
getrennt, um die die schöpferische Persönlichkeit der rezep-
tiven voraus zu sein pflegt; das unvorbereitete Publikum
steht dieser neuen und starken Erscheinung ganz fassungslos
gegenüber. Es wehrt sich mit bedingungsloser Ablehnung
oder wirft dem Künstler vermeintliche Abhängigkeit von
anderen zeitgenössischen Malern vor. Nichts scheint mir un-
begründeter zu sein; Böckl hat sich bei seinem berserker-
haften Einbruch in die Kunst unserer Zeit mit diesem und
jenem berührt, an diesem und jenem gestoßen, möchte man
sagen, und trägt manche Spur dieser Berührung an sich, aber
diese Anklänge an Kokoschka, Gorinth und manche Fran-
zosen bleiben völlig nebensächlich, gleiten auch rasch wieder
ab von dieser ihren Weg mit instinktiver Sicherheit gehenden
Naturkraft. Von dieser Sicherheit leben Böckls Malereien;
alles steht eindringlich gefügt in fest gezimmertem Raum,
ohne dekorative Gefälligkeit, ohne spielende Annehmlichkeit,
sehr ernst und deshalb innerhalb all dieses österreichischen
Getändels und zeitgenössischen Opportunismus ein wirkliches
Ereignis. Trotz der Geringschätzung gepflegter Materie ist
Böckls Malerei nicht roh; sie hat den Sinn und die Fähig-
keit der Nuancierung, aber darüber steht ihr die Pflicht des
Gestaltens, des Verwirklichens eines Erlebten. Böckls männ-
liche und naturhafte Erscheinung wirkt in dieser verweich-
lichten und verkünstelten Zeit aufregend und wohltuend. —
Die Gesellschaft zur Förderung moderner Kunst in Wien
unterbricht das eintönige Einerlei der Ausstellungen durch
einen psychologischen und pädagogischen Versuch, indem sie
in den Räumen des Österreichischen Museums für Kunst und
Industrie „Das Werden eines Kunstwerks" vorführt. An einer
Reihe markanter Beispiele teils aus der Vergangenheit, teils
aus der Gegenwart wird versucht, das technische, aber noch
mehr das geistige Werden eines Kunstwerks dem Publikum
näher zu rücken; in mehreren Fällen haben die Künstler
erläuternde Bemerkungen zu den einzelnen Phasen ihrer Ar-
beit beigesteuert, sonst haben die Veranstalter durch kurze
Beischriften und durch den Katalog die beabsichtigte Wir-
kung zu vertiefen versucht. Dadurch, daß bisweilen der ganze
Werdegang des Werkes von der ersten Konzeption bis zur
Fassung, im Material — manchmal noch darüber hinaus in
spätere Varianten — gezeigt werden konnte, läßt sich die
Mannigfaltigkeit des Arbeitsprozesses interessant illustrieren;
wie dem einen Künstler eine endgültige Lösung vorschwebt,
der er sich von allen Seiten nähert, ohne sie jemals ganz
erreichen zn können, wie der andere einen Natureindruck
aufnimmt, sich zu eigen macht und daran weiterspinnt wie
ein Musiker an einem Thema oder ein dritter die Natur-
studien in seine festgelegte Komposition einfügt u. s. f. Für
das Publikum, dem das Kunstwerk in der Regel ein dem
Urheber in den Schoß gefallenes Geschenk dünkt, ist dieser
Einblick in die Werkstatt sehr erzieherisch; es gewinnt eine
Ahnung von der vorbereitenden Mühe und damit eine stär-
kere Achtung vor ihrem Ergebnis. Das Interesse des Wie-
ner Publikums — sogar des Wiener Publikums — beweist,
daß dieses Thema einem vorhandenen Bedürfnis entgegen-
kommt. H. Tietze.
HAMBURG
Eine anregende Sammlung von Bildern Hamburger Maler
war in der Galerie Hofmann ausgestellt. Von den älteren
Künstlern interessierte vor allem Paul Kayser mit einem
schönen Blumenaquarell und Friedrich Ahlers-Hestermann
mit Zwei kultivierten Stilleben. Unter den jüngeren Künst-
lern ist in erster Linie Wilhelm Grimm mit seinen von stillem
Naturgefühl belebten Landschaften zu nennen und Kurt
Löwengaard mit seinen kräftigen, spontan gemalten Land-
schaftsstudien. K. Sch.
MÜNCHEN
Das Graphische Kabinett Neumann zeigte in sehr kluger
und glücklicher Auswahl das graphische Schaffen von Odilon
Redon. Der eminent französische Charakter dieser Blätter,
die Vornehmheit, der Geschmack, ein durch den Verstand
reguliertes Verhältnis zum objektiven Naturalismus wie zu
visionärer Romantik kommt deutlich zum Ausdruck, ebenso
wie die Wahrung einer großen Tradition, die innere Ge-
meinschaft mit Ingres trotz aller äußerlichen Verschiedenheit,
und man bewunderte gleichzeitig das technische Raffinement,
die rein artistische Vollendetheit dieser Lithographien.
A. L. M.
BERN — ZÜRICH
Kunsthalle Bern: Gedächtnisausstellung Felix Vallotton
(1865 —1925)- Man kann sie nicht treffender charakterisieren
als mit den Worten, die Hermann Hubacher fallen ließ: Sie
sei eigentlich noch besser gewesen als er erwartete. Fred
Srauffer hatte wieder vorzüglich gehängt, aber das Objekt
ließ kühl. Die Farbe gab Vallotton in keinem Punkte seiner
Entwicklung etwas Wesentliches, und wo er sich einmal
erwärmt (in früheren Bildnissen), erreicht er kaum Fantin-
Latour, an den er sich dabei anlehnt. Seine Stärke lag im
Holzschnitt, und was er auf graphischem Gebiet an Zeitkritik
geleistet hat, berührt sich mit dem genialen Journalismus,
den neuerdings ein Masereel vertritt. Vallotton war und wirkt
als Maler trotz Kubismus kaum je aktuell, und seine Graphik
mutet malerischer an als seine ganze Malerei. Als Graphiker
hat er denn auch seine Zeit gehabt, ja in gewissem Sinn
Historie gemacht. Ein sprechendes Beispiel dafür, daß Un-
vergängliches oft aus Vergänglichstem entsteht, wenn Leiden-
schaft und Können sich am gemäßen Stoff entzünden.
Kunsthaus Zürich: Gedächtnisausstellung Robert Zünd
(1827—1909). Zünd ist nie in dem Maß bekannt geworden,
wie er es verdient. Daran war er in erster Linie freilich
selber schuld, da er sich zeitlebens ängstlich zurückhielt. Auch
1)9
WIEN
In der Winterausstellung der Se-
zession tritt Herbert Böckl, der den
Lesern von „Kunst und Künstler" un-
längst bekannt gemacht worden ist,
zum ersten Male mit einer Kollektiv-
ausstellung in die Öffentlichkeit. Seine in ländlicher Abge-
schiedenheit und fanatischer Arbeit gewonnenen Ergebnisse
sind dem Kunstfreund nicht schrittweise vertraut geworden
und so sieht sich dieser von dem Künstler um jene Spanne
getrennt, um die die schöpferische Persönlichkeit der rezep-
tiven voraus zu sein pflegt; das unvorbereitete Publikum
steht dieser neuen und starken Erscheinung ganz fassungslos
gegenüber. Es wehrt sich mit bedingungsloser Ablehnung
oder wirft dem Künstler vermeintliche Abhängigkeit von
anderen zeitgenössischen Malern vor. Nichts scheint mir un-
begründeter zu sein; Böckl hat sich bei seinem berserker-
haften Einbruch in die Kunst unserer Zeit mit diesem und
jenem berührt, an diesem und jenem gestoßen, möchte man
sagen, und trägt manche Spur dieser Berührung an sich, aber
diese Anklänge an Kokoschka, Gorinth und manche Fran-
zosen bleiben völlig nebensächlich, gleiten auch rasch wieder
ab von dieser ihren Weg mit instinktiver Sicherheit gehenden
Naturkraft. Von dieser Sicherheit leben Böckls Malereien;
alles steht eindringlich gefügt in fest gezimmertem Raum,
ohne dekorative Gefälligkeit, ohne spielende Annehmlichkeit,
sehr ernst und deshalb innerhalb all dieses österreichischen
Getändels und zeitgenössischen Opportunismus ein wirkliches
Ereignis. Trotz der Geringschätzung gepflegter Materie ist
Böckls Malerei nicht roh; sie hat den Sinn und die Fähig-
keit der Nuancierung, aber darüber steht ihr die Pflicht des
Gestaltens, des Verwirklichens eines Erlebten. Böckls männ-
liche und naturhafte Erscheinung wirkt in dieser verweich-
lichten und verkünstelten Zeit aufregend und wohltuend. —
Die Gesellschaft zur Förderung moderner Kunst in Wien
unterbricht das eintönige Einerlei der Ausstellungen durch
einen psychologischen und pädagogischen Versuch, indem sie
in den Räumen des Österreichischen Museums für Kunst und
Industrie „Das Werden eines Kunstwerks" vorführt. An einer
Reihe markanter Beispiele teils aus der Vergangenheit, teils
aus der Gegenwart wird versucht, das technische, aber noch
mehr das geistige Werden eines Kunstwerks dem Publikum
näher zu rücken; in mehreren Fällen haben die Künstler
erläuternde Bemerkungen zu den einzelnen Phasen ihrer Ar-
beit beigesteuert, sonst haben die Veranstalter durch kurze
Beischriften und durch den Katalog die beabsichtigte Wir-
kung zu vertiefen versucht. Dadurch, daß bisweilen der ganze
Werdegang des Werkes von der ersten Konzeption bis zur
Fassung, im Material — manchmal noch darüber hinaus in
spätere Varianten — gezeigt werden konnte, läßt sich die
Mannigfaltigkeit des Arbeitsprozesses interessant illustrieren;
wie dem einen Künstler eine endgültige Lösung vorschwebt,
der er sich von allen Seiten nähert, ohne sie jemals ganz
erreichen zn können, wie der andere einen Natureindruck
aufnimmt, sich zu eigen macht und daran weiterspinnt wie
ein Musiker an einem Thema oder ein dritter die Natur-
studien in seine festgelegte Komposition einfügt u. s. f. Für
das Publikum, dem das Kunstwerk in der Regel ein dem
Urheber in den Schoß gefallenes Geschenk dünkt, ist dieser
Einblick in die Werkstatt sehr erzieherisch; es gewinnt eine
Ahnung von der vorbereitenden Mühe und damit eine stär-
kere Achtung vor ihrem Ergebnis. Das Interesse des Wie-
ner Publikums — sogar des Wiener Publikums — beweist,
daß dieses Thema einem vorhandenen Bedürfnis entgegen-
kommt. H. Tietze.
HAMBURG
Eine anregende Sammlung von Bildern Hamburger Maler
war in der Galerie Hofmann ausgestellt. Von den älteren
Künstlern interessierte vor allem Paul Kayser mit einem
schönen Blumenaquarell und Friedrich Ahlers-Hestermann
mit Zwei kultivierten Stilleben. Unter den jüngeren Künst-
lern ist in erster Linie Wilhelm Grimm mit seinen von stillem
Naturgefühl belebten Landschaften zu nennen und Kurt
Löwengaard mit seinen kräftigen, spontan gemalten Land-
schaftsstudien. K. Sch.
MÜNCHEN
Das Graphische Kabinett Neumann zeigte in sehr kluger
und glücklicher Auswahl das graphische Schaffen von Odilon
Redon. Der eminent französische Charakter dieser Blätter,
die Vornehmheit, der Geschmack, ein durch den Verstand
reguliertes Verhältnis zum objektiven Naturalismus wie zu
visionärer Romantik kommt deutlich zum Ausdruck, ebenso
wie die Wahrung einer großen Tradition, die innere Ge-
meinschaft mit Ingres trotz aller äußerlichen Verschiedenheit,
und man bewunderte gleichzeitig das technische Raffinement,
die rein artistische Vollendetheit dieser Lithographien.
A. L. M.
BERN — ZÜRICH
Kunsthalle Bern: Gedächtnisausstellung Felix Vallotton
(1865 —1925)- Man kann sie nicht treffender charakterisieren
als mit den Worten, die Hermann Hubacher fallen ließ: Sie
sei eigentlich noch besser gewesen als er erwartete. Fred
Srauffer hatte wieder vorzüglich gehängt, aber das Objekt
ließ kühl. Die Farbe gab Vallotton in keinem Punkte seiner
Entwicklung etwas Wesentliches, und wo er sich einmal
erwärmt (in früheren Bildnissen), erreicht er kaum Fantin-
Latour, an den er sich dabei anlehnt. Seine Stärke lag im
Holzschnitt, und was er auf graphischem Gebiet an Zeitkritik
geleistet hat, berührt sich mit dem genialen Journalismus,
den neuerdings ein Masereel vertritt. Vallotton war und wirkt
als Maler trotz Kubismus kaum je aktuell, und seine Graphik
mutet malerischer an als seine ganze Malerei. Als Graphiker
hat er denn auch seine Zeit gehabt, ja in gewissem Sinn
Historie gemacht. Ein sprechendes Beispiel dafür, daß Un-
vergängliches oft aus Vergänglichstem entsteht, wenn Leiden-
schaft und Können sich am gemäßen Stoff entzünden.
Kunsthaus Zürich: Gedächtnisausstellung Robert Zünd
(1827—1909). Zünd ist nie in dem Maß bekannt geworden,
wie er es verdient. Daran war er in erster Linie freilich
selber schuld, da er sich zeitlebens ängstlich zurückhielt. Auch
1)9