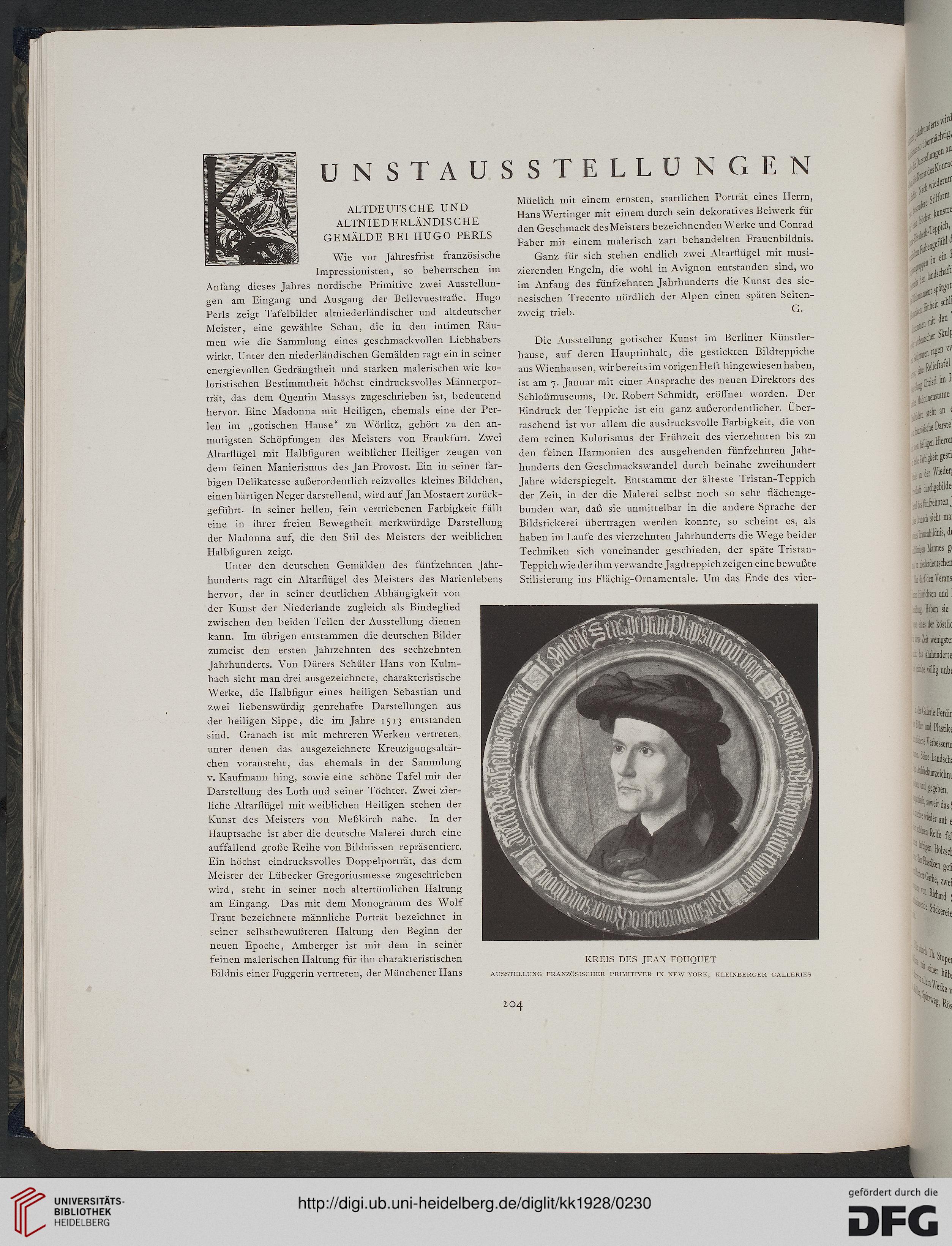UNSTAUSSTELLUNGEN
ALTDEUTSCHE UND
ALTNIE D E RLÄN DI S C H E
GEMÄLDE BEI HUGO PERLS
Wie vor Jahresfrist französische
Impressionisten, so beherrschen im
Anfang dieses Jahres nordische Primitive zwei Ausstellun-
gen am Eingang und Ausgang der Bellevuestraße. Hugo
Perls zeigt Tafelbilder altniederländischer und altdeutscher
Meister, eine gewählte Schau, die in den intimen Räu-
men wie die Sammlung eines geschmackvollen Liebhabers
wirkt. Unter den niederländischen Gemälden ragt ein in seiner
energievollen Gedrängtheit und starken malerischen wie ko-
loristischen Bestimmtheit höchst eindrucksvolles Männerpor-
trät, das dem Quentin Massys Zugeschrieben ist, bedeutend
hervor. Eine Madonna mit Heiligen, ehemals eine der Per-
len im „gotischen Hause" zu Wörlitz, gehört zu den an-
mutigsten Schöpfungen des Meisters von Frankfurt. Zwei
Altarflügel mit Halbfiguren weiblicher Heiliger zeugen von
dem feinen Manierismus des Jan Provost. Ein in seiner far-
bigen Delikatesse außerordentlich reizvolles kleines Bildchen,
einen bärtigen Neger darstellend, wird auf Jan Mostaert zurück-
geführt. In seiner hellen, fein vertriebenen Farbigkeit fällt
eine in ihrer freien Bewegtheit merkwürdige Darstellung
der Madonna auf, die den Stil des Meisters der weiblichen
Halbliguren zeigt.
Unter den deutschen Gemälden des fünfzehnten Jahr-
hunderts ragt ein Altarflügel des Meisters des Marienlebens
hervor, der in seiner deutlichen Abhängigkeit von
der Kunst der Niederlande zugleich als Bindeglied
zwischen den beiden Teilen der Ausstellung dienen
kann. Im übrigen entstammen die deutschen Bilder
zumeist den ersten Jahrzehnten des sechzehnten
Jahrhunderts. Von Dürers Schüler Hans von Kulm-
bach sieht man drei ausgezeichnete, charakteristische
Werke, die Halbfigur eines heiligen Sebastian und
zwei liebenswürdig genrehafte Darstellungen aus
der heiligen Sippe, die im Jahre 1513 entstanden
sind. Cranach ist mit mehreren Werken vertreten,
unter denen das ausgezeichnete Kreuzigungsaltär-
chen voransteht, das ehemals in der Sammlung
v. Kaufmann hing, sowie eine schöne Tafel mit der
Darstellung des Loth und seiner Töchter. Zwei zier-
liche Altarflügel mit weiblichen Heiligen stehen der
Kunst des Meisters von Meßkirch nahe. In der
Hauptsache ist aber die deutsche Malerei durch eine
auffallend große Reihe von Bildnissen repräsentiert.
Ein höchst eindrucksvolles Doppelporträt, das dem
Meister der Lübecker Gregoriusmesse zugeschrieben
wird, steht in seiner noch altertümlichen Haltung
am Eingang. Das mit dem Monogramm des Wolf
Traut bezeichnete männliche Porträt bezeichnet in
seiner selbstbewußteren Haltung den Beginn der
neuen Epoche, Amberger ist mit dem in seiner
fei nen malerischen Haltung für ihn charakteristischen
Müelich mit einem ernsten, stattlichen Porträt eines Herrn,
Hans Wertinger mit einem durch sein dekoratives Beiwerk für
den Geschmack des Meisters bezeichnenden Werke und Conrad
Faber mit einem malerisch zart behandelten Frauenbildnis.
Ganz für sich stehen endlich zwei Altarflügel mit musi-
zierenden Engeln, die wohl in Avignon entstanden sind, wo
im Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts die Kunst des sie-
nesischen Trecento nördlich der Alpen einen späten Seiten-
Zweig trieb. G.
Die Ausstellung gotischer Kunst im Berliner Künstler-
hause, auf deren Hauptinhalt, die gestickten Bildteppiche
aus Wienhausen, wirbereitsim vorigenlleft hingewiesen haben,
ist am 7. Januar mit einer Ansprache des neuen Direktors des
Schloßmuseums, Dr. Robert Schmidt, eröffnet worden. Der
Eindruck der Teppiche ist ein ganz außerordentlicher. Über-
raschend ist vor allem die ausdrucksvolle Farbigkeit, die von
dem reinen Kolorismus der Frühzeit des vierzehnten bis zu
den feinen Harmonien des ausgehenden fünfzehnten Jahr-
hunderts den Geschmackswandel durch beinahe zweihundert
Jahre widerspiegelt. Entstammt der älteste Tristan-Teppich
der Zeit, in der die Malerei selbst noch so sehr flächenge-
bunden war, daß sie unmittelbar in die andere Sprache der
Bildstickerei übertragen werden konnte, so scheint es, als
haben im Laufe des vierzehnten Jahrhunderts die Wege beider
Techniken sich voneinander geschieden, der späte Tristan-
Teppich wie derihm verwandte Jagdteppich zeigen eine bewußte
Stilisierung ins Flächig-Ornamentale. Um das Ende des vier-
Bildnis einer Fuggerin vertreten, der Münchener Hans
KREIS DES JEAX FOUQUET
AUSSTELLUNG FRANZÖSISCHER PRIMITIVER IN NEW YORK, KLEINBERGER GALLERIES
204
ALTDEUTSCHE UND
ALTNIE D E RLÄN DI S C H E
GEMÄLDE BEI HUGO PERLS
Wie vor Jahresfrist französische
Impressionisten, so beherrschen im
Anfang dieses Jahres nordische Primitive zwei Ausstellun-
gen am Eingang und Ausgang der Bellevuestraße. Hugo
Perls zeigt Tafelbilder altniederländischer und altdeutscher
Meister, eine gewählte Schau, die in den intimen Räu-
men wie die Sammlung eines geschmackvollen Liebhabers
wirkt. Unter den niederländischen Gemälden ragt ein in seiner
energievollen Gedrängtheit und starken malerischen wie ko-
loristischen Bestimmtheit höchst eindrucksvolles Männerpor-
trät, das dem Quentin Massys Zugeschrieben ist, bedeutend
hervor. Eine Madonna mit Heiligen, ehemals eine der Per-
len im „gotischen Hause" zu Wörlitz, gehört zu den an-
mutigsten Schöpfungen des Meisters von Frankfurt. Zwei
Altarflügel mit Halbfiguren weiblicher Heiliger zeugen von
dem feinen Manierismus des Jan Provost. Ein in seiner far-
bigen Delikatesse außerordentlich reizvolles kleines Bildchen,
einen bärtigen Neger darstellend, wird auf Jan Mostaert zurück-
geführt. In seiner hellen, fein vertriebenen Farbigkeit fällt
eine in ihrer freien Bewegtheit merkwürdige Darstellung
der Madonna auf, die den Stil des Meisters der weiblichen
Halbliguren zeigt.
Unter den deutschen Gemälden des fünfzehnten Jahr-
hunderts ragt ein Altarflügel des Meisters des Marienlebens
hervor, der in seiner deutlichen Abhängigkeit von
der Kunst der Niederlande zugleich als Bindeglied
zwischen den beiden Teilen der Ausstellung dienen
kann. Im übrigen entstammen die deutschen Bilder
zumeist den ersten Jahrzehnten des sechzehnten
Jahrhunderts. Von Dürers Schüler Hans von Kulm-
bach sieht man drei ausgezeichnete, charakteristische
Werke, die Halbfigur eines heiligen Sebastian und
zwei liebenswürdig genrehafte Darstellungen aus
der heiligen Sippe, die im Jahre 1513 entstanden
sind. Cranach ist mit mehreren Werken vertreten,
unter denen das ausgezeichnete Kreuzigungsaltär-
chen voransteht, das ehemals in der Sammlung
v. Kaufmann hing, sowie eine schöne Tafel mit der
Darstellung des Loth und seiner Töchter. Zwei zier-
liche Altarflügel mit weiblichen Heiligen stehen der
Kunst des Meisters von Meßkirch nahe. In der
Hauptsache ist aber die deutsche Malerei durch eine
auffallend große Reihe von Bildnissen repräsentiert.
Ein höchst eindrucksvolles Doppelporträt, das dem
Meister der Lübecker Gregoriusmesse zugeschrieben
wird, steht in seiner noch altertümlichen Haltung
am Eingang. Das mit dem Monogramm des Wolf
Traut bezeichnete männliche Porträt bezeichnet in
seiner selbstbewußteren Haltung den Beginn der
neuen Epoche, Amberger ist mit dem in seiner
fei nen malerischen Haltung für ihn charakteristischen
Müelich mit einem ernsten, stattlichen Porträt eines Herrn,
Hans Wertinger mit einem durch sein dekoratives Beiwerk für
den Geschmack des Meisters bezeichnenden Werke und Conrad
Faber mit einem malerisch zart behandelten Frauenbildnis.
Ganz für sich stehen endlich zwei Altarflügel mit musi-
zierenden Engeln, die wohl in Avignon entstanden sind, wo
im Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts die Kunst des sie-
nesischen Trecento nördlich der Alpen einen späten Seiten-
Zweig trieb. G.
Die Ausstellung gotischer Kunst im Berliner Künstler-
hause, auf deren Hauptinhalt, die gestickten Bildteppiche
aus Wienhausen, wirbereitsim vorigenlleft hingewiesen haben,
ist am 7. Januar mit einer Ansprache des neuen Direktors des
Schloßmuseums, Dr. Robert Schmidt, eröffnet worden. Der
Eindruck der Teppiche ist ein ganz außerordentlicher. Über-
raschend ist vor allem die ausdrucksvolle Farbigkeit, die von
dem reinen Kolorismus der Frühzeit des vierzehnten bis zu
den feinen Harmonien des ausgehenden fünfzehnten Jahr-
hunderts den Geschmackswandel durch beinahe zweihundert
Jahre widerspiegelt. Entstammt der älteste Tristan-Teppich
der Zeit, in der die Malerei selbst noch so sehr flächenge-
bunden war, daß sie unmittelbar in die andere Sprache der
Bildstickerei übertragen werden konnte, so scheint es, als
haben im Laufe des vierzehnten Jahrhunderts die Wege beider
Techniken sich voneinander geschieden, der späte Tristan-
Teppich wie derihm verwandte Jagdteppich zeigen eine bewußte
Stilisierung ins Flächig-Ornamentale. Um das Ende des vier-
Bildnis einer Fuggerin vertreten, der Münchener Hans
KREIS DES JEAX FOUQUET
AUSSTELLUNG FRANZÖSISCHER PRIMITIVER IN NEW YORK, KLEINBERGER GALLERIES
204