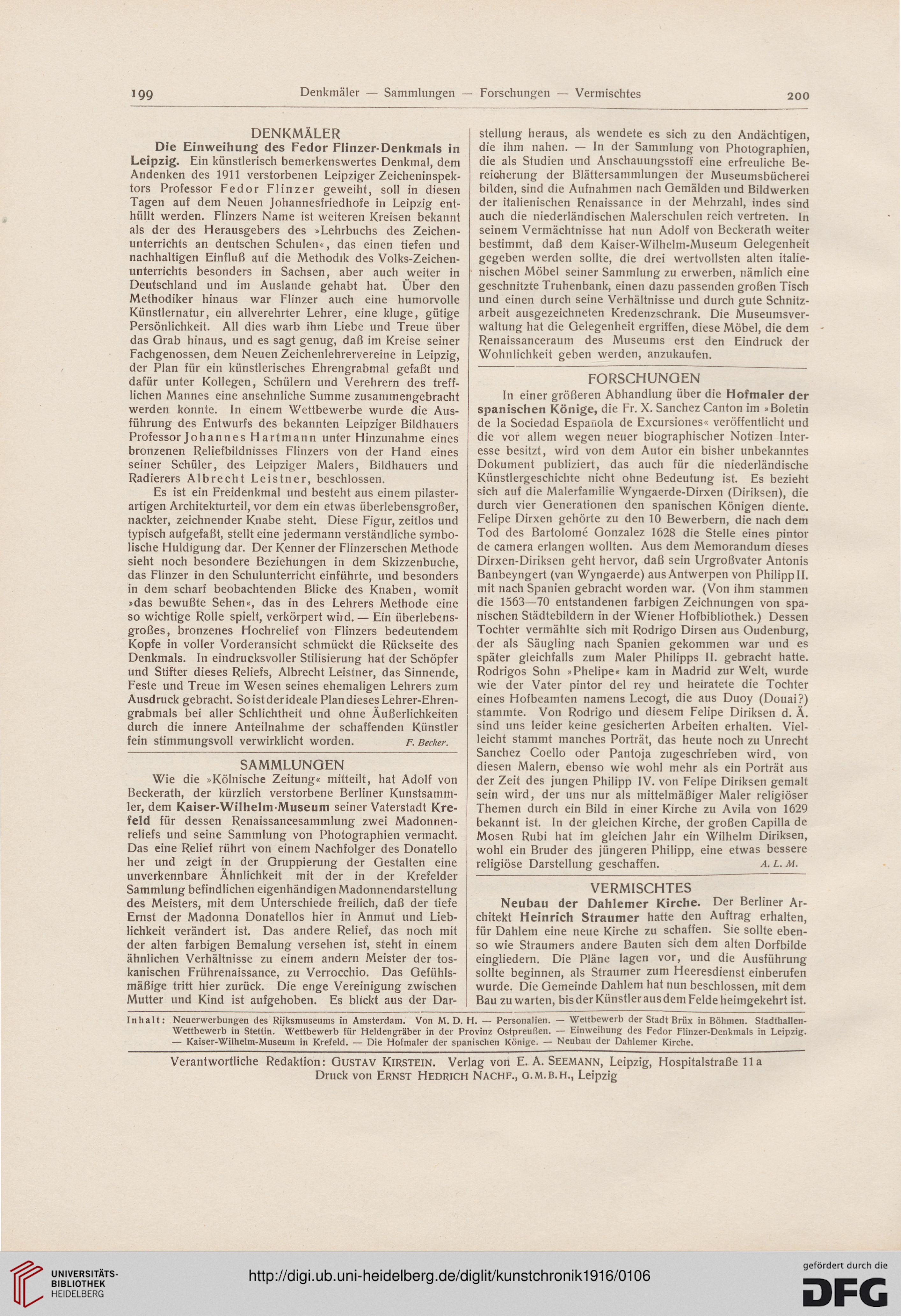199
Denkmäler — Sammlungen — Forschungen — Vermischtes
200
DENKMÄLER
Die Einweihung des Fedor Flinzer-Denkmals in
Leipzig. Ein künstlerisch bemerkenswertes Denkmal, dem
Andenken des 1911 verstorbenen Leipziger Zeicheninspek-
tors Professor Fedor Flinzer geweiht, soll in diesen
Tagen auf dem Neuen Johannesfriedhofe in Leipzig ent-
hüllt werden. Flinzers Name ist weiteren Kreisen bekannt
als der des Herausgebers des »Lehrbuchs des Zeichen-
unterrichts an deutschen Schulen«, das einen tiefen und
nachhaltigen Einfluß auf die Methodik des Volks-Zeichen-
unterrichts besonders in Sachsen, aber auch weiter in
Deutschland und im Auslande gehabt hat. Über den
Methodiker hinaus war Flinzer auch eine humorvolle
Künstlernatur, ein allverehrter Lehrer, eine kluge, gütige
Persönlichkeit. All dies warb ihm Liebe und Treue über
das Grab hinaus, und es sagt genug, daß im Kreise seiner
Fachgenossen, dem Neuen Zeichenlehrervereine in Leipzig,
der Plan für ein künstlerisches Ehrengrabmal gefaßt und
dafür unter Kollegen, Schülern und Verehrern des treff-
lichen Mannes eine ansehnliche Summe zusammengebracht
werden konnte. In einem Wettbewerbe wurde die Aus-
führung des Entwurfs des bekannten Leipziger Bildhauers
Professor Johannes Hartmann unter Hinzunahme eines
bronzenen Reliefbildnisses Flinzers von der Hand eines
seiner Schüler, des Leipziger Malers, Bildhauers und
Radierers Albrecht Leistner, beschlossen.
Es ist ein Freidenkmal und besteht aus einem pilaster-
artigen Architekturteil, vor dem ein etwas überlebensgroßer,
nackter, zeichnender Knabe steht. Diese Figur, zeitlos und
typisch aufgefaßt, stellt eine jedermann verständliche symbo-
lische Huldigung dar. Der Kenner der Flinzerschen Methode
sieht noch besondere Beziehungen in dem Skizzenbuche,
das Flinzer in den Schulunterricht einführte, und besonders
in dem scharf beobachtenden Blicke des Knaben, womit
>das bewußte Sehen«, das in des Lehrers Methode eine
so wichtige Rolle spielt, verkörpert wird.— Ein überlebens-
großes, bronzenes Hochrelief von Flinzers bedeutendem
Kopfe in voller Vorderansicht schmückt die Rückseite des
Denkmals. In eindrucksvoller Stilisierung hat der Schöpfer
und Stifter dieses Reliefs, Albrecht Leislner, das Sinnende,
Feste und Treue im Wesen seines ehemaligen Lehrers zum
Ausdruck gebracht. Soistderideale Plan dieses Lehrer-Ehren-
grabmals bei aller Schlichtheit und ohne Äußerlichkeiten
durch die innere Anteilnahme der schaffenden Künstler
fein stimmungsvoll verwirklicht worden. f. Becker.
SAMMLUNGEN
Wie die »Kölnische Zeitung« mitteilt, hat Adolf von
Beckerath, der kürzlich verstorbene Berliner Kunstsamm-
ler, dem Kaiser-Wilhelm-Museum seiner Vaterstadt Kre-
feld für dessen Renaissancesammlung zwei Madonnen-
reliefs und seine Sammlung von Photographien vermacht.
Das eine Relief rührt von einem Nachfolger des Donatello
her und zeigt in der Gruppierung der Gestalten eine
unverkennbare Ähnlichkeit mit der in der Krefelder
Sammlung befindlichen eigenhändigen Madonnendarstellung
des Meisters, mit dem Unterschiede freilich, daß der tiefe
Ernst der Madonna Donatellos hier in Anmut und Lieb-
lichkeit verändert ist. Das andere Relief, das noch mit
der alten farbigen Bemalung versehen ist, steht in einem
ähnlichen Verhältnisse zu einem andern Meister der tos-
kanischen Frührenaissance, zu Verrocchio. Das Gefühls-
mäßige tritt hier zurück. Die enge Vereinigung zwischen
Mutter und Kind ist aufgehoben. Es blickt aus der Dar-
stellung heraus, als wendete es sich zu den Andächtigen,
die ihm nahen. — In der Sammlung von Photographien,
die als Studien und Anschauungsstoff eine erfreuliche Be-
reicherung der Blättersammlungen der Museumsbücherei
bilden, sind die Aufnahmen nach Gemälden und Bildwerken
der italienischen Renaissance in der Mehrzahl, indes sind
auch die niederländischen Malerschulen reich vertreten. In
seinem Vermächtnisse hat nun Adolf von Beckerath weiter
bestimmt, daß dem Kaiser-Wilhelm-Museum Gelegenheit
gegeben werden sollte, die drei wertvollsten alten italie-
nischen Möbel seiner Sammlung zu erwerben, nämlich eine
geschnitzte Truhenbank, einen dazu passenden großen Tisch
und einen durch seine Verhältnisse und durch gute Schnitz-
arbeit ausgezeichneten Kredenzschrank. Die Museumsver-
waltung hat die Gelegenheit ergriffen, diese Möbel, die dem
Renaissanceraum des Museums erst den Eindruck der
Wohnlichkeit geben werden, anzukaufen.
FORSCHUNGEN
In einer größeren Abhandlung über die Hofmaler der
spanischen Könige, die Fr. X. Sanchez Canton im »Boletin
de la Sociedad Espauola de Excursiones« veröffentlicht und
die vor allem wegen neuer biographischer Notizen Inter-
esse besitzt, wird von dem Autor ein bisher unbekanntes
Dokument publiziert, das auch für die niederländische
Künstlergeschichte nicht ohne Bedeutung ist. Es bezieht
sich auf die Malerfamilie Wyngaerde-Dirxen (Diriksen), die
durch vier Generationen den spanischen Königen diente.
Felipe Dirxen gehörte zu den 10 Bewerbern, die nach dem
Tod des Bartolome Gonzalez 1628 die Stelle eines pintor
de camera erlangen wollten. Aus dem Memorandum dieses
Dirxen-Diriksen geht hervor, daß sein Urgroßvater Antonis
Banbeyngert (van Wyngaerde) aus Antwerpen von Philipp II.
mit nach Spanien gebracht worden war. (Von ihm stammen
die 1563—70 entstandenen farbigen Zeichnungen von spa-
nischen Städtebildern in der Wiener Hofbibliothek.) Dessen
Tochter vermählte sich mit Rodrigo Dirsen aus Oudenburg,
der als Säugling nach Spanien gekommen war und es
später gleichfalls zum Maler Philipps II. gebracht hatte.
Rodrigos Sohn »Phelipe« kam in Madrid zur Welt, wurde
wie der Vater pintor del rey und heiratete die Tochter
eines Hofbeaniten namens Lecogt, die aus Duoy (Douai?)
stammte. Von Rodrigo und diesem Felipe Diriksen d. Ä.
sind uns leider keine gesicherten Arbeiten erhalten. Viel-
leicht stammt manches Porträt, das heute noch zu Unrecht
Sanchez Coello oder Pantoja zugeschrieben wird, von
diesen Malern, ebenso wie wohl mehr als ein Porträt aus
der Zeit des jungen Philipp IV. von Felipe Diriksen gemalt
sein wird, der uns nur als mittelmäßiger Maler religiöser
Themen durch ein Bild in einer Kirche zu Avila von 1629
bekannt ist. In der gleichen Kirche, der großen Capilla de
Mosen Rubi hat im gleichen Jahr ein Wilhelm Diriksen,
wohl ein Bruder des jüngeren Philipp, eine etwas bessere
religiöse Darstellung geschaffen. a. l. m.
VERMISCHTES
Neubau der Dahlemer Kirche. Der Berliner Ar-
chitekt Heinrich Straumer hatte den Auftrag erhalten,
für Dahlem eine neue Kirche zu schaffen. Sie sollte eben-
so wie Straumers andere Bauten sich dem alten Dorfbilde
eingliedern. Die Pläne lagen vor, und die Ausführung
sollte beginnen, als Straumer zum Heeresdienst einberufen
wurde. Die Gemeinde Dahlem hat nun beschlossen, mit dem
Bau zu warten, bis der Künstler aus dem Felde heimgekehrt ist.
— Wettbewerb der Stadt Brüx in Böhmen. Stadthallen-
— Einweihung des Fedor Flinzer-Denkmals in Leipzig.
Neubau der Dahlemer Kirche.
Inhalt: Neuerwerbungen des Rijksmuseums in Amsterdam. Von M. D. H. — Personalien.
Wettbewerb in Stettin. Wettbewerb für Heldengräber in der Provinz Ostpreußen.
— Kaiser-Wilhelm-Museum in Krefeld. — Die Hofmaler der spanischen Könige. —
Verantwortliche Redaktion: Gustav Kirstein. Verlag von E.A.Seemann, Leipzig, Hospitalstraßella
Druck von Ernst Hedrich Nachf., G.m.b.H., Leipzig
Denkmäler — Sammlungen — Forschungen — Vermischtes
200
DENKMÄLER
Die Einweihung des Fedor Flinzer-Denkmals in
Leipzig. Ein künstlerisch bemerkenswertes Denkmal, dem
Andenken des 1911 verstorbenen Leipziger Zeicheninspek-
tors Professor Fedor Flinzer geweiht, soll in diesen
Tagen auf dem Neuen Johannesfriedhofe in Leipzig ent-
hüllt werden. Flinzers Name ist weiteren Kreisen bekannt
als der des Herausgebers des »Lehrbuchs des Zeichen-
unterrichts an deutschen Schulen«, das einen tiefen und
nachhaltigen Einfluß auf die Methodik des Volks-Zeichen-
unterrichts besonders in Sachsen, aber auch weiter in
Deutschland und im Auslande gehabt hat. Über den
Methodiker hinaus war Flinzer auch eine humorvolle
Künstlernatur, ein allverehrter Lehrer, eine kluge, gütige
Persönlichkeit. All dies warb ihm Liebe und Treue über
das Grab hinaus, und es sagt genug, daß im Kreise seiner
Fachgenossen, dem Neuen Zeichenlehrervereine in Leipzig,
der Plan für ein künstlerisches Ehrengrabmal gefaßt und
dafür unter Kollegen, Schülern und Verehrern des treff-
lichen Mannes eine ansehnliche Summe zusammengebracht
werden konnte. In einem Wettbewerbe wurde die Aus-
führung des Entwurfs des bekannten Leipziger Bildhauers
Professor Johannes Hartmann unter Hinzunahme eines
bronzenen Reliefbildnisses Flinzers von der Hand eines
seiner Schüler, des Leipziger Malers, Bildhauers und
Radierers Albrecht Leistner, beschlossen.
Es ist ein Freidenkmal und besteht aus einem pilaster-
artigen Architekturteil, vor dem ein etwas überlebensgroßer,
nackter, zeichnender Knabe steht. Diese Figur, zeitlos und
typisch aufgefaßt, stellt eine jedermann verständliche symbo-
lische Huldigung dar. Der Kenner der Flinzerschen Methode
sieht noch besondere Beziehungen in dem Skizzenbuche,
das Flinzer in den Schulunterricht einführte, und besonders
in dem scharf beobachtenden Blicke des Knaben, womit
>das bewußte Sehen«, das in des Lehrers Methode eine
so wichtige Rolle spielt, verkörpert wird.— Ein überlebens-
großes, bronzenes Hochrelief von Flinzers bedeutendem
Kopfe in voller Vorderansicht schmückt die Rückseite des
Denkmals. In eindrucksvoller Stilisierung hat der Schöpfer
und Stifter dieses Reliefs, Albrecht Leislner, das Sinnende,
Feste und Treue im Wesen seines ehemaligen Lehrers zum
Ausdruck gebracht. Soistderideale Plan dieses Lehrer-Ehren-
grabmals bei aller Schlichtheit und ohne Äußerlichkeiten
durch die innere Anteilnahme der schaffenden Künstler
fein stimmungsvoll verwirklicht worden. f. Becker.
SAMMLUNGEN
Wie die »Kölnische Zeitung« mitteilt, hat Adolf von
Beckerath, der kürzlich verstorbene Berliner Kunstsamm-
ler, dem Kaiser-Wilhelm-Museum seiner Vaterstadt Kre-
feld für dessen Renaissancesammlung zwei Madonnen-
reliefs und seine Sammlung von Photographien vermacht.
Das eine Relief rührt von einem Nachfolger des Donatello
her und zeigt in der Gruppierung der Gestalten eine
unverkennbare Ähnlichkeit mit der in der Krefelder
Sammlung befindlichen eigenhändigen Madonnendarstellung
des Meisters, mit dem Unterschiede freilich, daß der tiefe
Ernst der Madonna Donatellos hier in Anmut und Lieb-
lichkeit verändert ist. Das andere Relief, das noch mit
der alten farbigen Bemalung versehen ist, steht in einem
ähnlichen Verhältnisse zu einem andern Meister der tos-
kanischen Frührenaissance, zu Verrocchio. Das Gefühls-
mäßige tritt hier zurück. Die enge Vereinigung zwischen
Mutter und Kind ist aufgehoben. Es blickt aus der Dar-
stellung heraus, als wendete es sich zu den Andächtigen,
die ihm nahen. — In der Sammlung von Photographien,
die als Studien und Anschauungsstoff eine erfreuliche Be-
reicherung der Blättersammlungen der Museumsbücherei
bilden, sind die Aufnahmen nach Gemälden und Bildwerken
der italienischen Renaissance in der Mehrzahl, indes sind
auch die niederländischen Malerschulen reich vertreten. In
seinem Vermächtnisse hat nun Adolf von Beckerath weiter
bestimmt, daß dem Kaiser-Wilhelm-Museum Gelegenheit
gegeben werden sollte, die drei wertvollsten alten italie-
nischen Möbel seiner Sammlung zu erwerben, nämlich eine
geschnitzte Truhenbank, einen dazu passenden großen Tisch
und einen durch seine Verhältnisse und durch gute Schnitz-
arbeit ausgezeichneten Kredenzschrank. Die Museumsver-
waltung hat die Gelegenheit ergriffen, diese Möbel, die dem
Renaissanceraum des Museums erst den Eindruck der
Wohnlichkeit geben werden, anzukaufen.
FORSCHUNGEN
In einer größeren Abhandlung über die Hofmaler der
spanischen Könige, die Fr. X. Sanchez Canton im »Boletin
de la Sociedad Espauola de Excursiones« veröffentlicht und
die vor allem wegen neuer biographischer Notizen Inter-
esse besitzt, wird von dem Autor ein bisher unbekanntes
Dokument publiziert, das auch für die niederländische
Künstlergeschichte nicht ohne Bedeutung ist. Es bezieht
sich auf die Malerfamilie Wyngaerde-Dirxen (Diriksen), die
durch vier Generationen den spanischen Königen diente.
Felipe Dirxen gehörte zu den 10 Bewerbern, die nach dem
Tod des Bartolome Gonzalez 1628 die Stelle eines pintor
de camera erlangen wollten. Aus dem Memorandum dieses
Dirxen-Diriksen geht hervor, daß sein Urgroßvater Antonis
Banbeyngert (van Wyngaerde) aus Antwerpen von Philipp II.
mit nach Spanien gebracht worden war. (Von ihm stammen
die 1563—70 entstandenen farbigen Zeichnungen von spa-
nischen Städtebildern in der Wiener Hofbibliothek.) Dessen
Tochter vermählte sich mit Rodrigo Dirsen aus Oudenburg,
der als Säugling nach Spanien gekommen war und es
später gleichfalls zum Maler Philipps II. gebracht hatte.
Rodrigos Sohn »Phelipe« kam in Madrid zur Welt, wurde
wie der Vater pintor del rey und heiratete die Tochter
eines Hofbeaniten namens Lecogt, die aus Duoy (Douai?)
stammte. Von Rodrigo und diesem Felipe Diriksen d. Ä.
sind uns leider keine gesicherten Arbeiten erhalten. Viel-
leicht stammt manches Porträt, das heute noch zu Unrecht
Sanchez Coello oder Pantoja zugeschrieben wird, von
diesen Malern, ebenso wie wohl mehr als ein Porträt aus
der Zeit des jungen Philipp IV. von Felipe Diriksen gemalt
sein wird, der uns nur als mittelmäßiger Maler religiöser
Themen durch ein Bild in einer Kirche zu Avila von 1629
bekannt ist. In der gleichen Kirche, der großen Capilla de
Mosen Rubi hat im gleichen Jahr ein Wilhelm Diriksen,
wohl ein Bruder des jüngeren Philipp, eine etwas bessere
religiöse Darstellung geschaffen. a. l. m.
VERMISCHTES
Neubau der Dahlemer Kirche. Der Berliner Ar-
chitekt Heinrich Straumer hatte den Auftrag erhalten,
für Dahlem eine neue Kirche zu schaffen. Sie sollte eben-
so wie Straumers andere Bauten sich dem alten Dorfbilde
eingliedern. Die Pläne lagen vor, und die Ausführung
sollte beginnen, als Straumer zum Heeresdienst einberufen
wurde. Die Gemeinde Dahlem hat nun beschlossen, mit dem
Bau zu warten, bis der Künstler aus dem Felde heimgekehrt ist.
— Wettbewerb der Stadt Brüx in Böhmen. Stadthallen-
— Einweihung des Fedor Flinzer-Denkmals in Leipzig.
Neubau der Dahlemer Kirche.
Inhalt: Neuerwerbungen des Rijksmuseums in Amsterdam. Von M. D. H. — Personalien.
Wettbewerb in Stettin. Wettbewerb für Heldengräber in der Provinz Ostpreußen.
— Kaiser-Wilhelm-Museum in Krefeld. — Die Hofmaler der spanischen Könige. —
Verantwortliche Redaktion: Gustav Kirstein. Verlag von E.A.Seemann, Leipzig, Hospitalstraßella
Druck von Ernst Hedrich Nachf., G.m.b.H., Leipzig