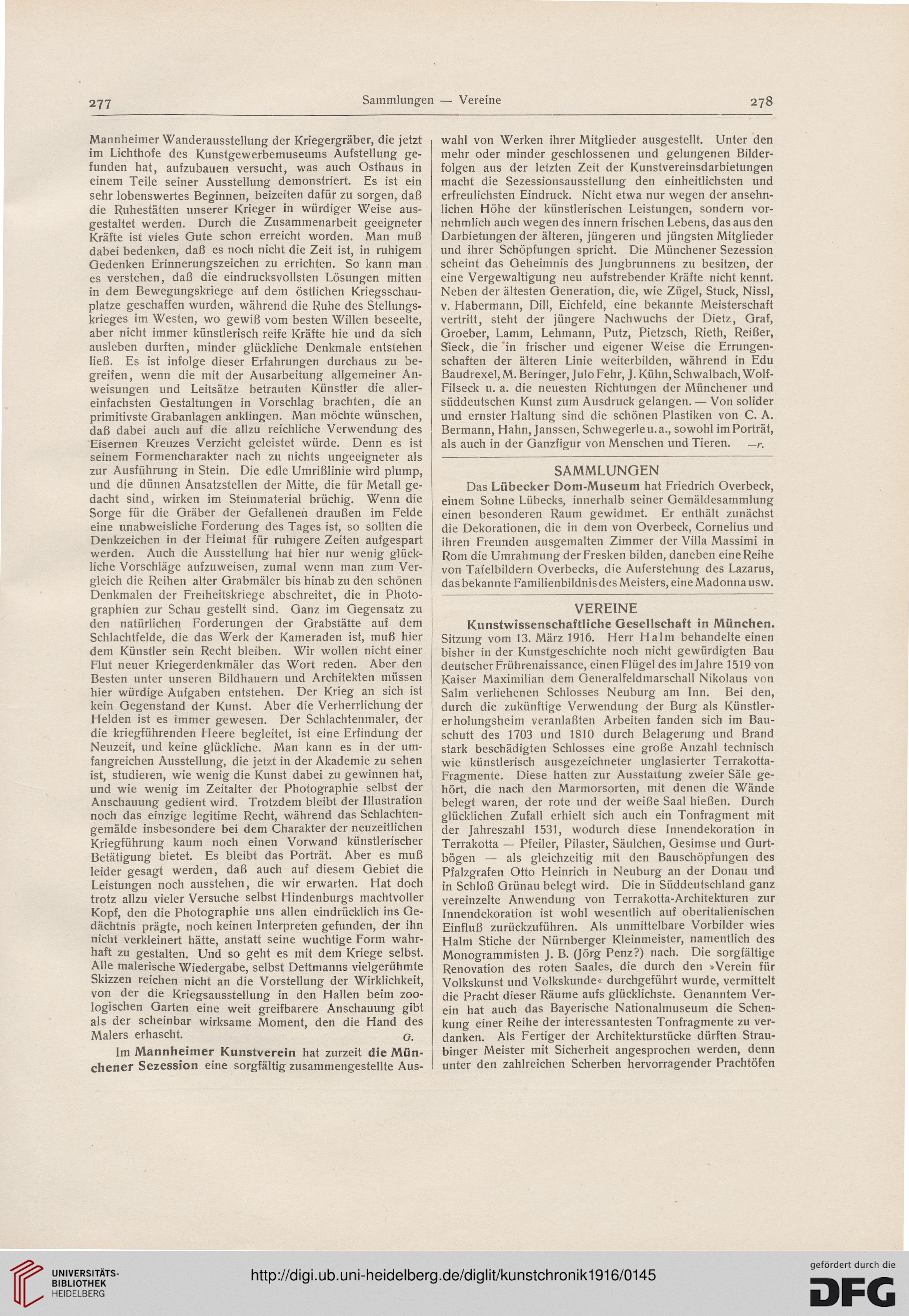277
Sammlungen — Vereine
278
Mannheimer Wanderausstellung der Kriegergräber, die jetzt
im Lichthofe des Kunstgewerbemuseums Aufstellung ge-
funden hat, aufzubauen versucht, was auch Osthaus in
einem Teile seiner Ausstellung demonstriert. Es ist ein
sehr lobenswertes Beginnen, beizeiten dafür zu sorgen, daß
die Ruhestätten unserer Krieger in würdiger Weise aus-
gestaltet werden. Durch die Zusammenarbeit geeigneter
Kräfte ist vieles Oute schon erreicht worden. Man muß
dabei bedenken, daß es noch nicht die Zeit ist, in ruhigem
Gedenken Erinnerungszeichen zu errichten. So kann man
es verstehen, daß die eindrucksvollsten Lösungen mitten
in dem Bewegungskriege auf dem östlichen Kriegsschau-
platze geschaffen wurden, während die Ruhe des Stellungs-
krieges im Westen, wo gewiß vom besten Willen beseelte,
aber nicht immer künstlerisch reife Kräfte hie und da sich
ausleben durften, minder glückliche Denkmale entstehen
ließ. Es ist infolge dieser Erfahrungen durchaus zu be-
greifen, wenn die mit der Ausarbeitung allgemeiner An-
weisungen und Leitsätze betrauten Künstler die aller-
einfachsten Gestaltungen in Vorschlag brachten, die an
primitivste Grabanlagen anklingen. Man möchte wünschen,
daß dabei auch auf die allzu reichliche Verwendung des
Eisernen Kreuzes Verzicht geleistet würde. Denn es ist
seinem Formencharakter nach zu nichts ungeeigneter als
zur Ausführung in Stein. Die edle Umrißlinie wird plump,
und die dünnen Ansatzstellen der Mitte, die für Metall ge-
dacht sind, wirken im Steinmaterial brüchig. Wenn die
Sorge für die Gräber der Gefallenen draußen im Felde
eine unabweisliche Forderung des Tages ist, so sollten die
Denkzeichen in der Heimat für ruhigere Zeiten aufgespart
werden. Auch die Ausstellung hat hier nur wenig glück-
liche Vorschläge aufzuweisen, zumal wenn man zum Ver-
gleich die Reihen alter Grabmäler bis hinab zu den schönen
Denkmalen der Freiheitskriege abschreitet, die in Photo-
graphien zur Schau gestellt sind. Ganz im Gegensatz zu
den natürlichen Forderungen der Grabstätte auf dem
Schlachtfelde, die das Werk der Kameraden ist, muß hier
dem Künstler sein Recht bleiben. Wir wollen nicht einer
Flut neuer Kriegerdenkmäler das Wort reden. Aber den
Besten unter unseren Bildhauern und Architekten müssen
hier würdige Aufgaben entstehen. Der Krieg an sich ist
kein Gegenstand der Kunst. Aber die Verherrlichung der
Helden ist es immer gewesen. Der Schlachtenmaler, der
die kriegführenden Heere begleitet, ist eine Erfindung der
Neuzeit, und keine glückliche. Man kann es in der um-
fangreichen Ausstellung, die jetzt in der Akademie zu sehen
ist, studieren, wie wenig die Kunst dabei zu gewinnen hat,
und wie wenig im Zeitalter der Photographie selbst der
Anschauung gedient wird. Trotzdem bleibt der Illustration
noch das einzige legitime Recht, während das Schlachten-
gemälde insbesondere bei dem Charakter der neuzeitlichen
Kriegführung kaum noch einen Vorwand künstlerischer
Betätigung bietet. Es bleibt das Porträt. Aber es muß
leider gesagt werden, daß auch auf diesem Gebiet die
Leistungen noch ausstehen, die wir erwarten. Hat doch
trotz allzu vieler Versuche selbst Hindenburgs machtvoller
Kopf, den die Photographie uns allen eindrücklich ins Ge-
dächtnis prägte, noch keinen Interpreten gefunden, der ihn
nicht verkleinert hätte, anstatt seine wuchtige Form wahr-
haft zu gestalten. Und so geht es mit dem Kriege selbst.
Alle malerische Wiedergabe, selbst Dettmanns vielgerühmte
Skizzen reichen nicht an die Vorstellung der Wirklichkeit,
von der die Kriegsausstellung in den Hallen beim zoo-
logischen Garten eine weit greifbarere Anschauung gibt
als der scheinbar wirksame Moment, den die Hand des
Malers erhascht. O.
Im Mannheimer Kunstverein hat zurzeit die Mün-
chener Sezession eine sorgfältig zusammengestellte Aus-
wahl von Werken ihrer Mitglieder ausgestellt. Unter den
mehr oder minder geschlossenen und gelungenen Bilder-
folgen aus der letzten Zeit der Kunstvereinsdarbietungen
macht die Sezessionsausstellung den einheitlichsten und
erfreulichsten Eindruck. Nicht etwa nur wegen der ansehn-
lichen Höhe der künstlerischen Leistungen, sondern vor-
nehmlich auch wegen des innern frischen Lebens, das aus den
Darbietungen der älteren, jüngeren und jüngsten Mitglieder
und ihrer Schöpfungen spricht. Die Münchener Sezession
scheint das Geheimnis des Jungbrunnens zu besitzen, der
eine Vergewaltigung neu aufstrebender Kräfte nicht kennt.
Neben der ältesten Generation, die, wie Zügel, Stuck, Nissl,
v. Habermann, Dill, Eichfeld, eine bekannte Meisterschaft
vertritt, steht der jüngere Nachwuchs der Dietz, Graf,
Groeber, Lamm, Lehmann, Putz, Pietzsch, Rieth, Reißer,
Sieck, die in frischer und eigener Weise die Errungen-
schaften der älteren Linie weiterbilden, während in Edu
Baudrexel, M. Beringer, Julo Fehr, J. Kühn, Schwalbach, Wolf-
Filseck u. a. die neuesten Richtungen der Münchener und
süddeutschen Kunst zum Ausdruck gelangen. — Von solider
und ernster Haltung sind die schönen Plastiken von C. A.
Bermann, Hahn, Janssen, Schwegerleu.a., sowohl im Porträt,
als auch in der Ganzfigur von Menschen und Tieren. — r.
SAMMLUNGEN
Das Lübecker Dom-Museum hat Friedrich Overbeck,
einem Sohne Lübecks, innerhalb seiner Gemäldesammlung
einen besonderen Raum gewidmet. Er enthält zunächst
die Dekorationen, die in dem von Overbeck, Cornelius und
ihren Freunden ausgemalten Zimmer der Villa Massimi in
Rom die Umrahmung der Fresken bilden, daneben eine Reihe
von Tafelbildern Overbecks, die Auferstehung des Lazarus,
das bekannte Familienbildnis des Meisters, eine Madonna usw.
VEREINE
Kunstwissenschaftliche Gesellschaft in München.
Sitzung vom 13. März 1916. Herr Halm behandelte einen
bisher in der Kunstgeschichte noch nicht gewürdigten Bau
deutscher Frührenaissance, einen Flügel des imjahre 1519 von
Kaiser Maximilian dem Generalfeldmarschall Nikolaus von
Salm verliehenen Schlosses Neuburg am Inn. Bei den,
durch die zukünftige Verwendung der Burg als Künstler-
erholungsheim veranlaßten Arbeiten fanden sich im Bau-
schutt des 1703 und 1810 durch Belagerung und Brand
stark beschädigten Schlosses eine große Anzahl technisch
wie künstlerisch ausgezeichneter unglasierter Terrakotta-
Fragmente. Diese hatten zur Ausstattung zweier Säle ge-
hört, die nach den Marmorsorten, mit denen die Wände
belegt waren, der rote und der weiße Saal hießen. Durch
glücklichen Zufall erhielt sich auch ein Tonfragment mit
der Jahreszahl 1531, wodurch diese Innendekoration in
Terrakotta — Pfeiler, Pilaster, Säulchen, Gesimse und Gurt-
bögen — als gleichzeitig mit den Bauschöpfimgen des
Pfalzgrafen Otto Heinrich in Neuburg an der Donau und
in Schloß Grünau belegt wird. Die in Süddeutschland ganz
vereinzelte Anwendung von Terrakotta-Architekturen zur
Innendekoration ist wohl wesentlich auf oberitalienischen
Einfluß zurückzuführen. Als unmittelbare Vorbilder wies
Halm Stiche der Nürnberger Kleinmeister, namentlich des
Monogrammisten J. B. (Jörg Penz?) nach. Die sorgfältige
Renovation des roten Saales, die durch den »Verein für
Volkskunst und Volkskunde« durchgeführt wurde, vermittelt
die Pracht dieser Räume aufs glücklichste. Genanntem Ver-
ein hat auch das Bayerische Nationalmuseum die Schen-
kung einer Reihe der interessantesten Tonfragmente zu ver-
danken. Als Fertiger der Architekturstücke dürften Strau-
binger Meister mit Sicherheit angesprochen werden, denn
unter den zahlreichen Scherben hervorragender Prachtöfen
Sammlungen — Vereine
278
Mannheimer Wanderausstellung der Kriegergräber, die jetzt
im Lichthofe des Kunstgewerbemuseums Aufstellung ge-
funden hat, aufzubauen versucht, was auch Osthaus in
einem Teile seiner Ausstellung demonstriert. Es ist ein
sehr lobenswertes Beginnen, beizeiten dafür zu sorgen, daß
die Ruhestätten unserer Krieger in würdiger Weise aus-
gestaltet werden. Durch die Zusammenarbeit geeigneter
Kräfte ist vieles Oute schon erreicht worden. Man muß
dabei bedenken, daß es noch nicht die Zeit ist, in ruhigem
Gedenken Erinnerungszeichen zu errichten. So kann man
es verstehen, daß die eindrucksvollsten Lösungen mitten
in dem Bewegungskriege auf dem östlichen Kriegsschau-
platze geschaffen wurden, während die Ruhe des Stellungs-
krieges im Westen, wo gewiß vom besten Willen beseelte,
aber nicht immer künstlerisch reife Kräfte hie und da sich
ausleben durften, minder glückliche Denkmale entstehen
ließ. Es ist infolge dieser Erfahrungen durchaus zu be-
greifen, wenn die mit der Ausarbeitung allgemeiner An-
weisungen und Leitsätze betrauten Künstler die aller-
einfachsten Gestaltungen in Vorschlag brachten, die an
primitivste Grabanlagen anklingen. Man möchte wünschen,
daß dabei auch auf die allzu reichliche Verwendung des
Eisernen Kreuzes Verzicht geleistet würde. Denn es ist
seinem Formencharakter nach zu nichts ungeeigneter als
zur Ausführung in Stein. Die edle Umrißlinie wird plump,
und die dünnen Ansatzstellen der Mitte, die für Metall ge-
dacht sind, wirken im Steinmaterial brüchig. Wenn die
Sorge für die Gräber der Gefallenen draußen im Felde
eine unabweisliche Forderung des Tages ist, so sollten die
Denkzeichen in der Heimat für ruhigere Zeiten aufgespart
werden. Auch die Ausstellung hat hier nur wenig glück-
liche Vorschläge aufzuweisen, zumal wenn man zum Ver-
gleich die Reihen alter Grabmäler bis hinab zu den schönen
Denkmalen der Freiheitskriege abschreitet, die in Photo-
graphien zur Schau gestellt sind. Ganz im Gegensatz zu
den natürlichen Forderungen der Grabstätte auf dem
Schlachtfelde, die das Werk der Kameraden ist, muß hier
dem Künstler sein Recht bleiben. Wir wollen nicht einer
Flut neuer Kriegerdenkmäler das Wort reden. Aber den
Besten unter unseren Bildhauern und Architekten müssen
hier würdige Aufgaben entstehen. Der Krieg an sich ist
kein Gegenstand der Kunst. Aber die Verherrlichung der
Helden ist es immer gewesen. Der Schlachtenmaler, der
die kriegführenden Heere begleitet, ist eine Erfindung der
Neuzeit, und keine glückliche. Man kann es in der um-
fangreichen Ausstellung, die jetzt in der Akademie zu sehen
ist, studieren, wie wenig die Kunst dabei zu gewinnen hat,
und wie wenig im Zeitalter der Photographie selbst der
Anschauung gedient wird. Trotzdem bleibt der Illustration
noch das einzige legitime Recht, während das Schlachten-
gemälde insbesondere bei dem Charakter der neuzeitlichen
Kriegführung kaum noch einen Vorwand künstlerischer
Betätigung bietet. Es bleibt das Porträt. Aber es muß
leider gesagt werden, daß auch auf diesem Gebiet die
Leistungen noch ausstehen, die wir erwarten. Hat doch
trotz allzu vieler Versuche selbst Hindenburgs machtvoller
Kopf, den die Photographie uns allen eindrücklich ins Ge-
dächtnis prägte, noch keinen Interpreten gefunden, der ihn
nicht verkleinert hätte, anstatt seine wuchtige Form wahr-
haft zu gestalten. Und so geht es mit dem Kriege selbst.
Alle malerische Wiedergabe, selbst Dettmanns vielgerühmte
Skizzen reichen nicht an die Vorstellung der Wirklichkeit,
von der die Kriegsausstellung in den Hallen beim zoo-
logischen Garten eine weit greifbarere Anschauung gibt
als der scheinbar wirksame Moment, den die Hand des
Malers erhascht. O.
Im Mannheimer Kunstverein hat zurzeit die Mün-
chener Sezession eine sorgfältig zusammengestellte Aus-
wahl von Werken ihrer Mitglieder ausgestellt. Unter den
mehr oder minder geschlossenen und gelungenen Bilder-
folgen aus der letzten Zeit der Kunstvereinsdarbietungen
macht die Sezessionsausstellung den einheitlichsten und
erfreulichsten Eindruck. Nicht etwa nur wegen der ansehn-
lichen Höhe der künstlerischen Leistungen, sondern vor-
nehmlich auch wegen des innern frischen Lebens, das aus den
Darbietungen der älteren, jüngeren und jüngsten Mitglieder
und ihrer Schöpfungen spricht. Die Münchener Sezession
scheint das Geheimnis des Jungbrunnens zu besitzen, der
eine Vergewaltigung neu aufstrebender Kräfte nicht kennt.
Neben der ältesten Generation, die, wie Zügel, Stuck, Nissl,
v. Habermann, Dill, Eichfeld, eine bekannte Meisterschaft
vertritt, steht der jüngere Nachwuchs der Dietz, Graf,
Groeber, Lamm, Lehmann, Putz, Pietzsch, Rieth, Reißer,
Sieck, die in frischer und eigener Weise die Errungen-
schaften der älteren Linie weiterbilden, während in Edu
Baudrexel, M. Beringer, Julo Fehr, J. Kühn, Schwalbach, Wolf-
Filseck u. a. die neuesten Richtungen der Münchener und
süddeutschen Kunst zum Ausdruck gelangen. — Von solider
und ernster Haltung sind die schönen Plastiken von C. A.
Bermann, Hahn, Janssen, Schwegerleu.a., sowohl im Porträt,
als auch in der Ganzfigur von Menschen und Tieren. — r.
SAMMLUNGEN
Das Lübecker Dom-Museum hat Friedrich Overbeck,
einem Sohne Lübecks, innerhalb seiner Gemäldesammlung
einen besonderen Raum gewidmet. Er enthält zunächst
die Dekorationen, die in dem von Overbeck, Cornelius und
ihren Freunden ausgemalten Zimmer der Villa Massimi in
Rom die Umrahmung der Fresken bilden, daneben eine Reihe
von Tafelbildern Overbecks, die Auferstehung des Lazarus,
das bekannte Familienbildnis des Meisters, eine Madonna usw.
VEREINE
Kunstwissenschaftliche Gesellschaft in München.
Sitzung vom 13. März 1916. Herr Halm behandelte einen
bisher in der Kunstgeschichte noch nicht gewürdigten Bau
deutscher Frührenaissance, einen Flügel des imjahre 1519 von
Kaiser Maximilian dem Generalfeldmarschall Nikolaus von
Salm verliehenen Schlosses Neuburg am Inn. Bei den,
durch die zukünftige Verwendung der Burg als Künstler-
erholungsheim veranlaßten Arbeiten fanden sich im Bau-
schutt des 1703 und 1810 durch Belagerung und Brand
stark beschädigten Schlosses eine große Anzahl technisch
wie künstlerisch ausgezeichneter unglasierter Terrakotta-
Fragmente. Diese hatten zur Ausstattung zweier Säle ge-
hört, die nach den Marmorsorten, mit denen die Wände
belegt waren, der rote und der weiße Saal hießen. Durch
glücklichen Zufall erhielt sich auch ein Tonfragment mit
der Jahreszahl 1531, wodurch diese Innendekoration in
Terrakotta — Pfeiler, Pilaster, Säulchen, Gesimse und Gurt-
bögen — als gleichzeitig mit den Bauschöpfimgen des
Pfalzgrafen Otto Heinrich in Neuburg an der Donau und
in Schloß Grünau belegt wird. Die in Süddeutschland ganz
vereinzelte Anwendung von Terrakotta-Architekturen zur
Innendekoration ist wohl wesentlich auf oberitalienischen
Einfluß zurückzuführen. Als unmittelbare Vorbilder wies
Halm Stiche der Nürnberger Kleinmeister, namentlich des
Monogrammisten J. B. (Jörg Penz?) nach. Die sorgfältige
Renovation des roten Saales, die durch den »Verein für
Volkskunst und Volkskunde« durchgeführt wurde, vermittelt
die Pracht dieser Räume aufs glücklichste. Genanntem Ver-
ein hat auch das Bayerische Nationalmuseum die Schen-
kung einer Reihe der interessantesten Tonfragmente zu ver-
danken. Als Fertiger der Architekturstücke dürften Strau-
binger Meister mit Sicherheit angesprochen werden, denn
unter den zahlreichen Scherben hervorragender Prachtöfen