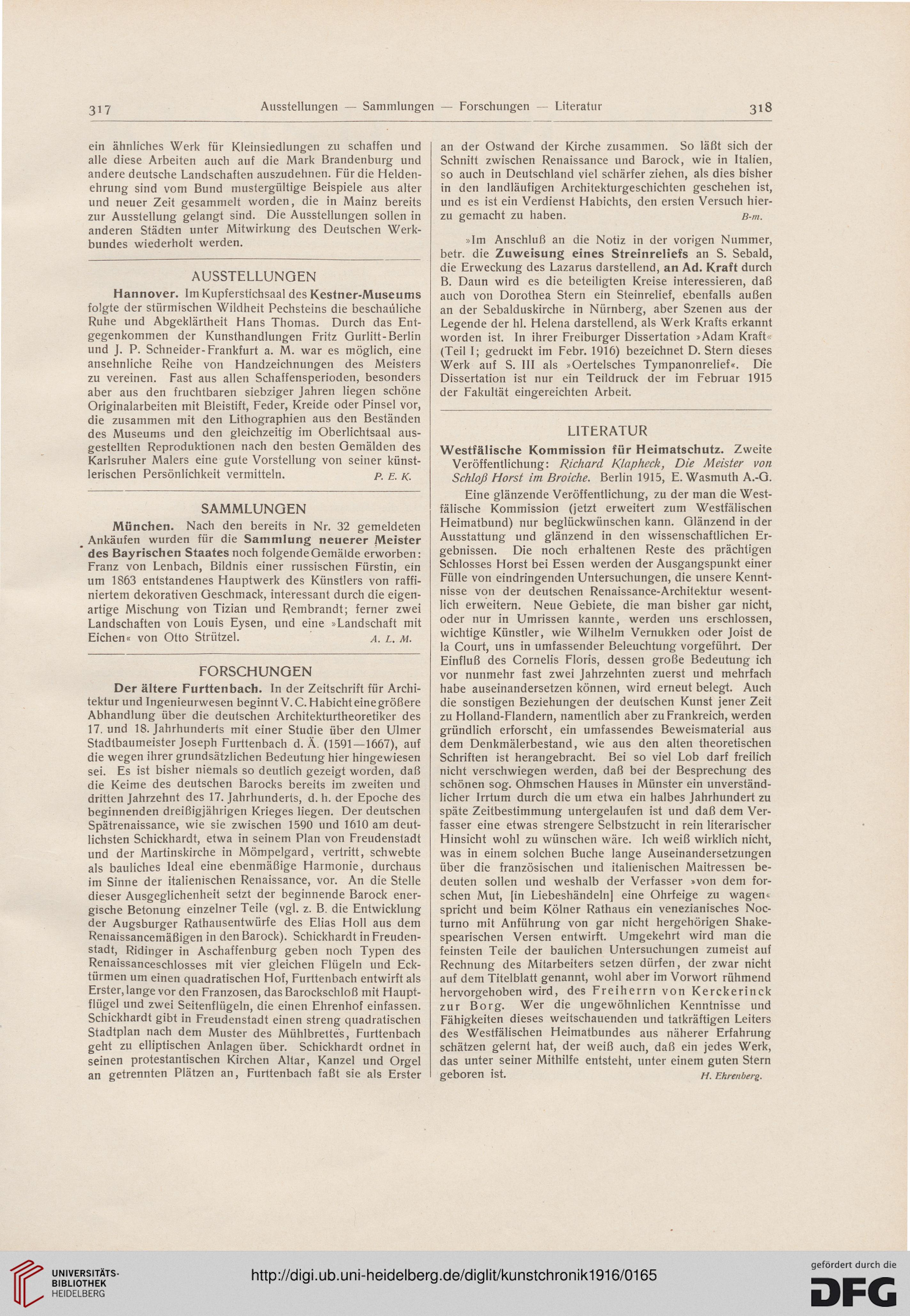317
Ausstellungen — Sammlungen — Forschungen Literatur
318
ein ähnliches Werk für Kleinsiedlungen zu schaffen und
alle diese Arbeiten auch auf die Mark Brandenburg und
andere deutsche Landschaften auszudehnen. Für die Helden-
ehrung sind vom Bund mustergültige Beispiele aus alter
und neuer Zeit gesammelt worden, die in Mainz bereits
zur Ausstellung gelangt sind. Die Ausstellungen sollen in
anderen Städten unter Mitwirkung des Deutschen Werk-
bundes wiederholt werden.
AUSSTELLUNGEN
Hannover. Im Kupferstichsaal des Kestner-Museums
folgte der stürmischen Wildheit Pechsteins die beschauliche
Ruhe und Abgeklärtheit Hans Thomas. Durch das Ent-
gegenkommen der Kunsthandlungen Fritz Ourlitt-Berlin
und J. P. Schneider-Frankfurt a. M. war es möglich, eine
ansehnliche Reihe von Handzeichnungen des Meisters
zu vereinen. Fast aus allen Schaffensperioden, besonders
aber aus den fruchtbaren siebziger Jahren liegen schöne
Originalarbeiten mit Bleistift, Feder, Kreide oder Pinsel vor,
die zusammen mit den Lithographien aus den Beständen
des Museums und den gleichzeitig im Oberlichtsaal aus-
gestellten Reproduktionen nach den besten Gemälden des
Karlsruher Malers eine gute Vorstellung von seiner künst-
lerischen Persönlichkeit vermitteln. p, e. k.
SAMMLUNGEN
München. Nach den bereits in Nr. 32 gemeldeten
Ankäufen wurden für die Sammlung neuerer Meister
des Bayrischen Staates noch folgende Gemälde erworben:
Franz von Lenbach, Bildnis einer russischen Fürstin, ein
um 1863 entstandenes Hauptwerk des Künstlers von raffi-
niertem dekorativen Geschmack, interessant durch die eigen-
artige Mischung von Tizian und Rembrandt; ferner zwei
Landschaften von Louis Eysen, und eine »Landschaft mit
Eichen« von Otto Strützel. a. l. m.
FORSCHUNGEN
Der ältere Furttenbach. In der Zeitschrift für Archi-
tektur und Ingenieurwesen beginnt V. C. Habicht eine größere
Abhandlung über die deutschen Architekturtheoretiker des
17. und 18. Jahrhunderts mit einer Studie über den Ulmer
Stadtbaumeister Joseph Furttenbach d. Ä. (1591—1667), auf
die wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung hier hingewiesen
sei. Es ist bisher niemals so deutlich gezeigt worden, daß
die Keime des deutschen Barocks bereits im zweiten und
dritten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts, d. h. der Epoche des
beginnenden dreißigjährigen Krieges liegen. Der deutschen
Spätrenaissance, wie sie zwischen 1590 und 1610 am deut-
lichsten Schickhardt, etwa in seinem Plan von Freudenstadt
und der Martinskirche in Mömpelgard, vertritt, schwebte
als bauliches Ideal eine ebenmäßige Harmonie, durchaus
im Sinne der italienischen Renaissance, vor. An die Stelle
dieser Ausgeglichenheit setzt der beginnende Barock ener-
gische Betonung einzelner Teile (vgl. z. B. die Entwicklung
der Augsburger Rathausentwürfe des Elias Holl aus dem
Renaissancemäßigen in den Barock). Schickhardt in Freuden-
stadt, Ridinger in Aschaffenburg geben noch Typen des
Renaissanceschlosses mit vier gleichen Flügeln und Eck-
türmen um einen quadratischen Hof, Furttenbach entwirft als
Erster, lange vor den Franzosen, das Barockschloß mit Haupt-
flügel und zwei Seitenflügeln, die einen Ehrenhof einfassen.
Schickhardt gibt in Freudenstadt einen streng quadratischen
Stadtplan nach dem Muster des Mühlbrettes, Furttenbach
geht zu elliptischen Anlagen über. Schickhardt ordnet in
seinen protestantischen Kirchen Altar, Kanzel und Orgel
an getrennten Plätzen an, Furttenbach faßt sie als Erster
an der Ostwand der Kirche zusammen. So läßt sich der
Schnitt zwischen Renaissance und Barock, wie in Italien,
so auch in Deutschland viel schärfer ziehen, als dies bisher
in den landläufigen Architekturgeschichten geschehen ist,
und es ist ein Verdienst Habichts, den ersten Versuch hier-
zu gemacht zu haben. B-m.
»Im Anschluß an die Notiz in der vorigen Nummer,
betr. die Zuweisung eines Streinreliefs an S. Sebald,
die Erweckung des Lazarus darstellend, an Ad. Kraft durch
B. Daun wird es die beteiligten Kreise interessieren, daß
auch von Dorothea Stern ein Steinrelief, ebenfalls außen
an der Sebalduskirche in Nürnberg, aber Szenen aus der
Legende der hl. Helena darstellend, als Werk Krafts erkannt
worden ist. In ihrer Freiburger Dissertation »Adam Kraft«
(Teil I; gedruckt im Febr. 1916) bezeichnet D. Stern dieses
Werk auf S. III als »Oertelsches Tympanonrelief«. Die
Dissertation ist nur ein Teildruck der im Februar 1915
der Fakultät eingereichten Arbeit.
LITERATUR
Westfälische Kommission für Heimatschutz. Zweite
Veröffentlichung: Richard Klapheck, Die Meister von
Schloß Horst im Broiche. Berlin 1915, E. Wasmuth A.-G.
Eine glänzende Veröffentlichung, zu der man die West-
fälische Kommission (jetzt erweitert zum Westfälischen
Heimatbund) nur beglückwünschen kann. Glänzend in der
Ausstattung und glänzend in den wissenschaftlichen Er-
gebnissen. Die noch erhaltenen Reste des prächtigen
Schlosses Horst bei Essen werden der Ausgangspunkt einer
Fülle von eindringenden Untersuchungen, die unsere Kennt-
nisse von der deutschen Renaissance-Architektur wesent-
lich erweitern. Neue Gebiete, die man bisher gar nicht,
oder nur in Umrissen kannte, werden uns erschlossen,
wichtige Künstler, wie Wilhelm Vernukken oder Joist de
la Court, uns in umfassender Beleuchtung vorgeführt. Der
Einfluß des Cornelis Floris, dessen große Bedeutung ich
vor nunmehr fast zwei Jahrzehnten zuerst und mehrfach
habe auseinandersetzen können, wird erneut belegt. Auch
die sonstigen Beziehungen der deutschen Kunst jener Zeit
zu Holland-Flandern, namentlich aber zu Frankreich, werden
gründlich erforscht, ein umfassendes Beweismaterial aus
dem Denkmälerbestand, wie aus den alten theoretischen
Schriften ist herangebracht. Bei so viel Lob darf freilich
nicht verschwiegen werden, daß bei der Besprechung des
schönen sog. Ohmschen Hauses in Münster ein unverständ-
licher Irrtum durch die um etwa ein halbes Jahrhundert zu
späte Zeitbestimmung untergelaufen ist und daß dem Ver-
fasser eine etwas strengere Selbstzucht in rein literarischer
Hinsicht wohl zu wünschen wäre. Ich weiß wirklich nicht,
was in einem solchen Buche lange Auseinandersetzungen
über die französischen und italienischen Maitressen be-
deuten sollen und weshalb der Verfasser »von dem for-
schen Mut, [in Liebeshändeln] eine Ohrfeige zu wagen*
spricht und beim Kölner Rathaus ein venezianisches Noc-
turno mit Anführung von gar nicht hergehörigen Shake-
spearischen Versen entwirft. Umgekehrt wird man die
feinsten Teile der baulichen Untersuchungen zumeist auf
Rechnung des Mitarbeiters setzen dürfen, der zwar nicht
auf dem Titelblatt genannt, wohl aber im Vorwort rühmend
hervorgehoben wird, des Freiherrn von Kerckerinck
zur Borg. Wer die ungewöhnlichen Kenntnisse und
Fähigkeiten dieses weitschauenden und tatkräftigen Leiters
des Westfälischen Heimatbundes aus näherer Erfahrung
schätzen gelernt hat, der weiß auch, daß ein jedes Werk,
das unter seiner Mithilfe entsteht, unter einem guten Stern
geboren ist. h. Ekrenberg.
Ausstellungen — Sammlungen — Forschungen Literatur
318
ein ähnliches Werk für Kleinsiedlungen zu schaffen und
alle diese Arbeiten auch auf die Mark Brandenburg und
andere deutsche Landschaften auszudehnen. Für die Helden-
ehrung sind vom Bund mustergültige Beispiele aus alter
und neuer Zeit gesammelt worden, die in Mainz bereits
zur Ausstellung gelangt sind. Die Ausstellungen sollen in
anderen Städten unter Mitwirkung des Deutschen Werk-
bundes wiederholt werden.
AUSSTELLUNGEN
Hannover. Im Kupferstichsaal des Kestner-Museums
folgte der stürmischen Wildheit Pechsteins die beschauliche
Ruhe und Abgeklärtheit Hans Thomas. Durch das Ent-
gegenkommen der Kunsthandlungen Fritz Ourlitt-Berlin
und J. P. Schneider-Frankfurt a. M. war es möglich, eine
ansehnliche Reihe von Handzeichnungen des Meisters
zu vereinen. Fast aus allen Schaffensperioden, besonders
aber aus den fruchtbaren siebziger Jahren liegen schöne
Originalarbeiten mit Bleistift, Feder, Kreide oder Pinsel vor,
die zusammen mit den Lithographien aus den Beständen
des Museums und den gleichzeitig im Oberlichtsaal aus-
gestellten Reproduktionen nach den besten Gemälden des
Karlsruher Malers eine gute Vorstellung von seiner künst-
lerischen Persönlichkeit vermitteln. p, e. k.
SAMMLUNGEN
München. Nach den bereits in Nr. 32 gemeldeten
Ankäufen wurden für die Sammlung neuerer Meister
des Bayrischen Staates noch folgende Gemälde erworben:
Franz von Lenbach, Bildnis einer russischen Fürstin, ein
um 1863 entstandenes Hauptwerk des Künstlers von raffi-
niertem dekorativen Geschmack, interessant durch die eigen-
artige Mischung von Tizian und Rembrandt; ferner zwei
Landschaften von Louis Eysen, und eine »Landschaft mit
Eichen« von Otto Strützel. a. l. m.
FORSCHUNGEN
Der ältere Furttenbach. In der Zeitschrift für Archi-
tektur und Ingenieurwesen beginnt V. C. Habicht eine größere
Abhandlung über die deutschen Architekturtheoretiker des
17. und 18. Jahrhunderts mit einer Studie über den Ulmer
Stadtbaumeister Joseph Furttenbach d. Ä. (1591—1667), auf
die wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung hier hingewiesen
sei. Es ist bisher niemals so deutlich gezeigt worden, daß
die Keime des deutschen Barocks bereits im zweiten und
dritten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts, d. h. der Epoche des
beginnenden dreißigjährigen Krieges liegen. Der deutschen
Spätrenaissance, wie sie zwischen 1590 und 1610 am deut-
lichsten Schickhardt, etwa in seinem Plan von Freudenstadt
und der Martinskirche in Mömpelgard, vertritt, schwebte
als bauliches Ideal eine ebenmäßige Harmonie, durchaus
im Sinne der italienischen Renaissance, vor. An die Stelle
dieser Ausgeglichenheit setzt der beginnende Barock ener-
gische Betonung einzelner Teile (vgl. z. B. die Entwicklung
der Augsburger Rathausentwürfe des Elias Holl aus dem
Renaissancemäßigen in den Barock). Schickhardt in Freuden-
stadt, Ridinger in Aschaffenburg geben noch Typen des
Renaissanceschlosses mit vier gleichen Flügeln und Eck-
türmen um einen quadratischen Hof, Furttenbach entwirft als
Erster, lange vor den Franzosen, das Barockschloß mit Haupt-
flügel und zwei Seitenflügeln, die einen Ehrenhof einfassen.
Schickhardt gibt in Freudenstadt einen streng quadratischen
Stadtplan nach dem Muster des Mühlbrettes, Furttenbach
geht zu elliptischen Anlagen über. Schickhardt ordnet in
seinen protestantischen Kirchen Altar, Kanzel und Orgel
an getrennten Plätzen an, Furttenbach faßt sie als Erster
an der Ostwand der Kirche zusammen. So läßt sich der
Schnitt zwischen Renaissance und Barock, wie in Italien,
so auch in Deutschland viel schärfer ziehen, als dies bisher
in den landläufigen Architekturgeschichten geschehen ist,
und es ist ein Verdienst Habichts, den ersten Versuch hier-
zu gemacht zu haben. B-m.
»Im Anschluß an die Notiz in der vorigen Nummer,
betr. die Zuweisung eines Streinreliefs an S. Sebald,
die Erweckung des Lazarus darstellend, an Ad. Kraft durch
B. Daun wird es die beteiligten Kreise interessieren, daß
auch von Dorothea Stern ein Steinrelief, ebenfalls außen
an der Sebalduskirche in Nürnberg, aber Szenen aus der
Legende der hl. Helena darstellend, als Werk Krafts erkannt
worden ist. In ihrer Freiburger Dissertation »Adam Kraft«
(Teil I; gedruckt im Febr. 1916) bezeichnet D. Stern dieses
Werk auf S. III als »Oertelsches Tympanonrelief«. Die
Dissertation ist nur ein Teildruck der im Februar 1915
der Fakultät eingereichten Arbeit.
LITERATUR
Westfälische Kommission für Heimatschutz. Zweite
Veröffentlichung: Richard Klapheck, Die Meister von
Schloß Horst im Broiche. Berlin 1915, E. Wasmuth A.-G.
Eine glänzende Veröffentlichung, zu der man die West-
fälische Kommission (jetzt erweitert zum Westfälischen
Heimatbund) nur beglückwünschen kann. Glänzend in der
Ausstattung und glänzend in den wissenschaftlichen Er-
gebnissen. Die noch erhaltenen Reste des prächtigen
Schlosses Horst bei Essen werden der Ausgangspunkt einer
Fülle von eindringenden Untersuchungen, die unsere Kennt-
nisse von der deutschen Renaissance-Architektur wesent-
lich erweitern. Neue Gebiete, die man bisher gar nicht,
oder nur in Umrissen kannte, werden uns erschlossen,
wichtige Künstler, wie Wilhelm Vernukken oder Joist de
la Court, uns in umfassender Beleuchtung vorgeführt. Der
Einfluß des Cornelis Floris, dessen große Bedeutung ich
vor nunmehr fast zwei Jahrzehnten zuerst und mehrfach
habe auseinandersetzen können, wird erneut belegt. Auch
die sonstigen Beziehungen der deutschen Kunst jener Zeit
zu Holland-Flandern, namentlich aber zu Frankreich, werden
gründlich erforscht, ein umfassendes Beweismaterial aus
dem Denkmälerbestand, wie aus den alten theoretischen
Schriften ist herangebracht. Bei so viel Lob darf freilich
nicht verschwiegen werden, daß bei der Besprechung des
schönen sog. Ohmschen Hauses in Münster ein unverständ-
licher Irrtum durch die um etwa ein halbes Jahrhundert zu
späte Zeitbestimmung untergelaufen ist und daß dem Ver-
fasser eine etwas strengere Selbstzucht in rein literarischer
Hinsicht wohl zu wünschen wäre. Ich weiß wirklich nicht,
was in einem solchen Buche lange Auseinandersetzungen
über die französischen und italienischen Maitressen be-
deuten sollen und weshalb der Verfasser »von dem for-
schen Mut, [in Liebeshändeln] eine Ohrfeige zu wagen*
spricht und beim Kölner Rathaus ein venezianisches Noc-
turno mit Anführung von gar nicht hergehörigen Shake-
spearischen Versen entwirft. Umgekehrt wird man die
feinsten Teile der baulichen Untersuchungen zumeist auf
Rechnung des Mitarbeiters setzen dürfen, der zwar nicht
auf dem Titelblatt genannt, wohl aber im Vorwort rühmend
hervorgehoben wird, des Freiherrn von Kerckerinck
zur Borg. Wer die ungewöhnlichen Kenntnisse und
Fähigkeiten dieses weitschauenden und tatkräftigen Leiters
des Westfälischen Heimatbundes aus näherer Erfahrung
schätzen gelernt hat, der weiß auch, daß ein jedes Werk,
das unter seiner Mithilfe entsteht, unter einem guten Stern
geboren ist. h. Ekrenberg.