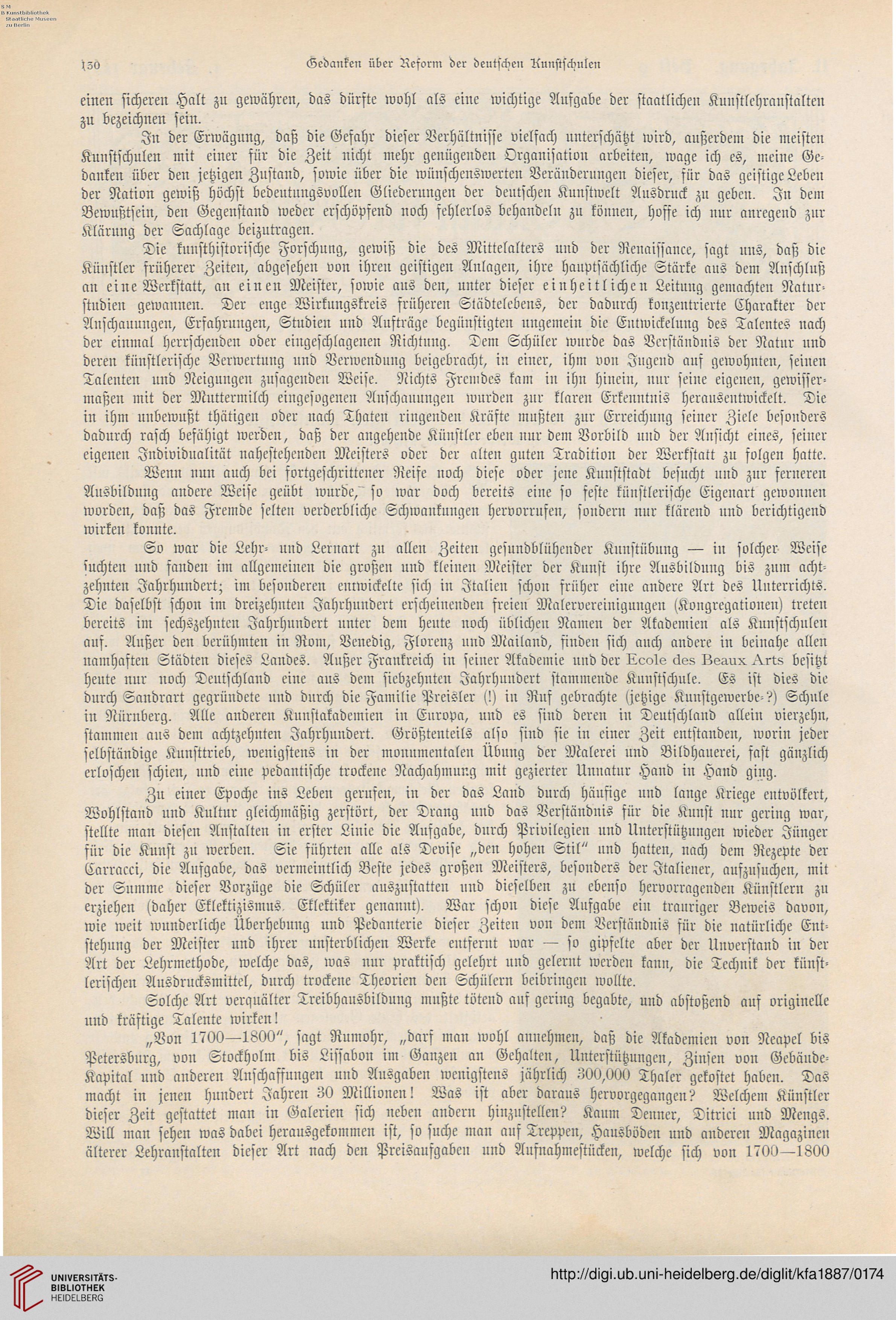^ZO Gedaiiken über Reform der deutschen Runstschulen
einen sicheren Halt zu gewähren, das dürfte wohl als eine wichtige Aufgabe der staatlichen Kunstlehranstalten
zu bezeichnen sein.
Jn der Erwägung, daß die Gefahr dieser Verhältnisse vielfach nnterschätzt wird, anßerdem die meisten
Kunstschulen mit einer für die Zeit nicht mehr genügenden Organisation arbeiten, wage ich es, meine Ge-
danken über den jetzigen Zustand, sowie über die wünschenswerten Veränderungen dieser, sür das geistige Leben
der Nation gewiß höchst bedentnngsvollen Gliederungen der deutschen Kunstwelt Ausdruck zu gebeu. Jn dem
Bewußtsein, den Gegenstand weder erschöpfend noch fehlerlos bchandeln zu können, hoffe ich nnr anregend zur
Klärung der Sachlage beizutragen.
Die kunsthistorische Forschung, gewiß die des Mittelalters und der Renaissance, sagt uns, daß die
Künstler früherer Zeiten, abgesehen von ihren geistigen Anlagen, ihre hauptsächliche Stärke aus dem Anschluß
an eine Werkstatt, an einen Meister, sowie ans den, unter dieser einheitlichen Leitung gemachten Natur-
stndien gewannen. Der enge Wirkungskreis früheren Städtelebens, der dadurch konzentrierte Charakter dcr
Anschauungen, Erfahrungen, Studien und Aufträge beglinstigten nngemein die Entwickelung des Talentes nach
der einmal herrscheuden oder eingeschlagenen Richtnng. Dem Schüler wurde das Verständnis der Natur und
deren künstlerischc Verwertung und Verwendung beigebracht, in einer, ihm von Jugeud auf gewohnten, seinen
Talenten und Neigungen zusagenden Weise. Nichts Frcmdes kam in ihn hinein, nur seine eigenen, gewisser-
maßen mit der Muttermilch eingesogenen Anschauungen wurden znr klaren Erkenntnis herausentwickelt. Die
in ihm unbewußt thätigen oder nach Thaten ringenden Kräfte mußten zur Erreichnng seiner Ziele besonders
dadurch rasch befähigt werden, daß der angehende Künstler eben nur dem Vorbild uud der Ausicht eines, seiner
eigenen Jndividualität nahestehenden Meisters oder dcr alteu guten Tradition der Werkstatt zu folgen hatte.
Wenn nun auch bei fortgeschrittener Reise noch diese oder jene Kunststadt besucht uud zur ferueren
Ausbildung andere Weise geübt wurde,' so war doch bereits eine so seste küustlerische Eigeuart gewonnen
worden, daß das Fremde selteu verderbliche Schwankungen hervorrufen, sondern nur klürend und berichtigend
wirken konnte.
So war die Lehr- uud Lernart zu allen Zeiten gesundblüheuder Kunstübung — in solcher Weise
iuchten und fanden im allgemeinen die großen und kleinen Meister der Kunst ihre Ansbildung bis zum acht-
zehnten Jahrhundert; im besonderen enrwickelte sich in Jtalien schou sriiher eine andere Art des Uuterrichts.
Die daselbst schon im dreizehnten Jahrhundert erscheinenden freieu Malervereinigungen (Kongregationen) treten
bereits im sechszehnten Jahrhundert unter dem heute noch üblichen Namen der Akademien als Kunstschnlen
auf. Außer den berühmten in Rom, Venedig, Florenz und Mailand, finden sich auch andere in beinahe allen
namhaften Städten dieses Landes. Außer Frankreich in seiner Akademie nud der Ucole äss Dsaux ^.rt8 besitzt
heute nur noch Deutschland eine ans dem siebzehnten Jahrhundert stammende Kunstschule. Es ist dies die
durch Sandrart gegründete und durch die Familie Preisler (!) in Ruf gebrachte (jetzige Kunstgewerbe-?) Schule
in Nürnberg. Alle anderen Kunstakademien in Europa, nnd es sind deren in Deutschland allein vierzehn,
stammen aus dem achtzehnten Jahrhnndert. Größtenteils also sind sie in einer Zeit entstanden, worin jeder
selbständige Kunsttrieb, wenigstens in der monumentalen Übung der Malerei und Bildhauerei, fast gänzlich
erloschen schien, und eine pedantische trockene Nachahmung mit gezierter Unuatur Hand in Hand ging.
Zu einer Epoche ins Leben gerufen, in der das Land durch häufige und lange Kriege entvölkert,
Wohlstand und Kultur gleichmäßig zerstört, der Drang und das Verständnis für die Kunst nur gering war,
stellte man diesen Anstalten in erster Linie die Aufgabe, dnrch Privilegien und Unterstützungen wieder Jünger
für die Kunst zu werben. Sie führten alle als Devise „den hohen Stil" nnd hatten, nach dem Rezepte der
Carracci, die Aufgabe, das vermeintlich Beste jedes großen Meisters, besonders der Jtaliener, aufzusuchen, mit
der Snmme dieser Vorzüge die Schüler auszustatten und dieselben zu ebenso hervorragenden Künstlern zu
erziehen (daher Eklektizismns. Eklektiker genannt). War schon diese Aufgabe eiu trauriger Beweis davon,
wie weit wunderliche Uberhebung nnd Pedanterie dieser Zeiten von dem Verständnis für die natürliche Ent-
stehung der Meister nnd ihrer unsterblichen Werke entfernt war — so gipfelte aber der Unverstand in der
Art der Lehrmethode, welche das, was nur praktisch gelehrt und gelernt werden kann, die Technik der künst-
lerischen Ausdrucksmittel, durch trockene Theorien den Schülern beibringen wollte.
Solche Art verquälter Treibhausbildung mnßte tötend auf gering begabte, und abstoßend auf originelle
nnd kräftige Talente wirken!
„Von 1700—1800", sagt Rumohr, „darf man wohl annehmen, daß die Akademien von Neapel bis
Petersburg, von Stockholm bis Lissabon im Ganzen an Gehalten, Unterstützungen, Zinsen von Gebände-
Kapital und anderen Anschaffungen und Ansgaben wenigstens jährlich 300,000 Thaler gekostet haben. Das
macht in jenen hundert Jahren 30 Millionen! Was ist aber daraus hervorgegangen? Welchem Künstler
dieser Zeit gestattet man in Galerien sich neben andern hinzustellen? Kaum Denner, Ditrici und Mengs.
Will man sehen was dabei herausgekommen ist, so suche man auf Treppen, Hausböden und anderen Magazinen
älterer Lehranstalten dieser Art nach den Preisaufgaben und Ausnahmestücken, welche sich von 1700—1800
einen sicheren Halt zu gewähren, das dürfte wohl als eine wichtige Aufgabe der staatlichen Kunstlehranstalten
zu bezeichnen sein.
Jn der Erwägung, daß die Gefahr dieser Verhältnisse vielfach nnterschätzt wird, anßerdem die meisten
Kunstschulen mit einer für die Zeit nicht mehr genügenden Organisation arbeiten, wage ich es, meine Ge-
danken über den jetzigen Zustand, sowie über die wünschenswerten Veränderungen dieser, sür das geistige Leben
der Nation gewiß höchst bedentnngsvollen Gliederungen der deutschen Kunstwelt Ausdruck zu gebeu. Jn dem
Bewußtsein, den Gegenstand weder erschöpfend noch fehlerlos bchandeln zu können, hoffe ich nnr anregend zur
Klärung der Sachlage beizutragen.
Die kunsthistorische Forschung, gewiß die des Mittelalters und der Renaissance, sagt uns, daß die
Künstler früherer Zeiten, abgesehen von ihren geistigen Anlagen, ihre hauptsächliche Stärke aus dem Anschluß
an eine Werkstatt, an einen Meister, sowie ans den, unter dieser einheitlichen Leitung gemachten Natur-
stndien gewannen. Der enge Wirkungskreis früheren Städtelebens, der dadurch konzentrierte Charakter dcr
Anschauungen, Erfahrungen, Studien und Aufträge beglinstigten nngemein die Entwickelung des Talentes nach
der einmal herrscheuden oder eingeschlagenen Richtnng. Dem Schüler wurde das Verständnis der Natur und
deren künstlerischc Verwertung und Verwendung beigebracht, in einer, ihm von Jugeud auf gewohnten, seinen
Talenten und Neigungen zusagenden Weise. Nichts Frcmdes kam in ihn hinein, nur seine eigenen, gewisser-
maßen mit der Muttermilch eingesogenen Anschauungen wurden znr klaren Erkenntnis herausentwickelt. Die
in ihm unbewußt thätigen oder nach Thaten ringenden Kräfte mußten zur Erreichnng seiner Ziele besonders
dadurch rasch befähigt werden, daß der angehende Künstler eben nur dem Vorbild uud der Ausicht eines, seiner
eigenen Jndividualität nahestehenden Meisters oder dcr alteu guten Tradition der Werkstatt zu folgen hatte.
Wenn nun auch bei fortgeschrittener Reise noch diese oder jene Kunststadt besucht uud zur ferueren
Ausbildung andere Weise geübt wurde,' so war doch bereits eine so seste küustlerische Eigeuart gewonnen
worden, daß das Fremde selteu verderbliche Schwankungen hervorrufen, sondern nur klürend und berichtigend
wirken konnte.
So war die Lehr- uud Lernart zu allen Zeiten gesundblüheuder Kunstübung — in solcher Weise
iuchten und fanden im allgemeinen die großen und kleinen Meister der Kunst ihre Ansbildung bis zum acht-
zehnten Jahrhundert; im besonderen enrwickelte sich in Jtalien schou sriiher eine andere Art des Uuterrichts.
Die daselbst schon im dreizehnten Jahrhundert erscheinenden freieu Malervereinigungen (Kongregationen) treten
bereits im sechszehnten Jahrhundert unter dem heute noch üblichen Namen der Akademien als Kunstschnlen
auf. Außer den berühmten in Rom, Venedig, Florenz und Mailand, finden sich auch andere in beinahe allen
namhaften Städten dieses Landes. Außer Frankreich in seiner Akademie nud der Ucole äss Dsaux ^.rt8 besitzt
heute nur noch Deutschland eine ans dem siebzehnten Jahrhundert stammende Kunstschule. Es ist dies die
durch Sandrart gegründete und durch die Familie Preisler (!) in Ruf gebrachte (jetzige Kunstgewerbe-?) Schule
in Nürnberg. Alle anderen Kunstakademien in Europa, nnd es sind deren in Deutschland allein vierzehn,
stammen aus dem achtzehnten Jahrhnndert. Größtenteils also sind sie in einer Zeit entstanden, worin jeder
selbständige Kunsttrieb, wenigstens in der monumentalen Übung der Malerei und Bildhauerei, fast gänzlich
erloschen schien, und eine pedantische trockene Nachahmung mit gezierter Unuatur Hand in Hand ging.
Zu einer Epoche ins Leben gerufen, in der das Land durch häufige und lange Kriege entvölkert,
Wohlstand und Kultur gleichmäßig zerstört, der Drang und das Verständnis für die Kunst nur gering war,
stellte man diesen Anstalten in erster Linie die Aufgabe, dnrch Privilegien und Unterstützungen wieder Jünger
für die Kunst zu werben. Sie führten alle als Devise „den hohen Stil" nnd hatten, nach dem Rezepte der
Carracci, die Aufgabe, das vermeintlich Beste jedes großen Meisters, besonders der Jtaliener, aufzusuchen, mit
der Snmme dieser Vorzüge die Schüler auszustatten und dieselben zu ebenso hervorragenden Künstlern zu
erziehen (daher Eklektizismns. Eklektiker genannt). War schon diese Aufgabe eiu trauriger Beweis davon,
wie weit wunderliche Uberhebung nnd Pedanterie dieser Zeiten von dem Verständnis für die natürliche Ent-
stehung der Meister nnd ihrer unsterblichen Werke entfernt war — so gipfelte aber der Unverstand in der
Art der Lehrmethode, welche das, was nur praktisch gelehrt und gelernt werden kann, die Technik der künst-
lerischen Ausdrucksmittel, durch trockene Theorien den Schülern beibringen wollte.
Solche Art verquälter Treibhausbildung mnßte tötend auf gering begabte, und abstoßend auf originelle
nnd kräftige Talente wirken!
„Von 1700—1800", sagt Rumohr, „darf man wohl annehmen, daß die Akademien von Neapel bis
Petersburg, von Stockholm bis Lissabon im Ganzen an Gehalten, Unterstützungen, Zinsen von Gebände-
Kapital und anderen Anschaffungen und Ansgaben wenigstens jährlich 300,000 Thaler gekostet haben. Das
macht in jenen hundert Jahren 30 Millionen! Was ist aber daraus hervorgegangen? Welchem Künstler
dieser Zeit gestattet man in Galerien sich neben andern hinzustellen? Kaum Denner, Ditrici und Mengs.
Will man sehen was dabei herausgekommen ist, so suche man auf Treppen, Hausböden und anderen Magazinen
älterer Lehranstalten dieser Art nach den Preisaufgaben und Ausnahmestücken, welche sich von 1700—1800