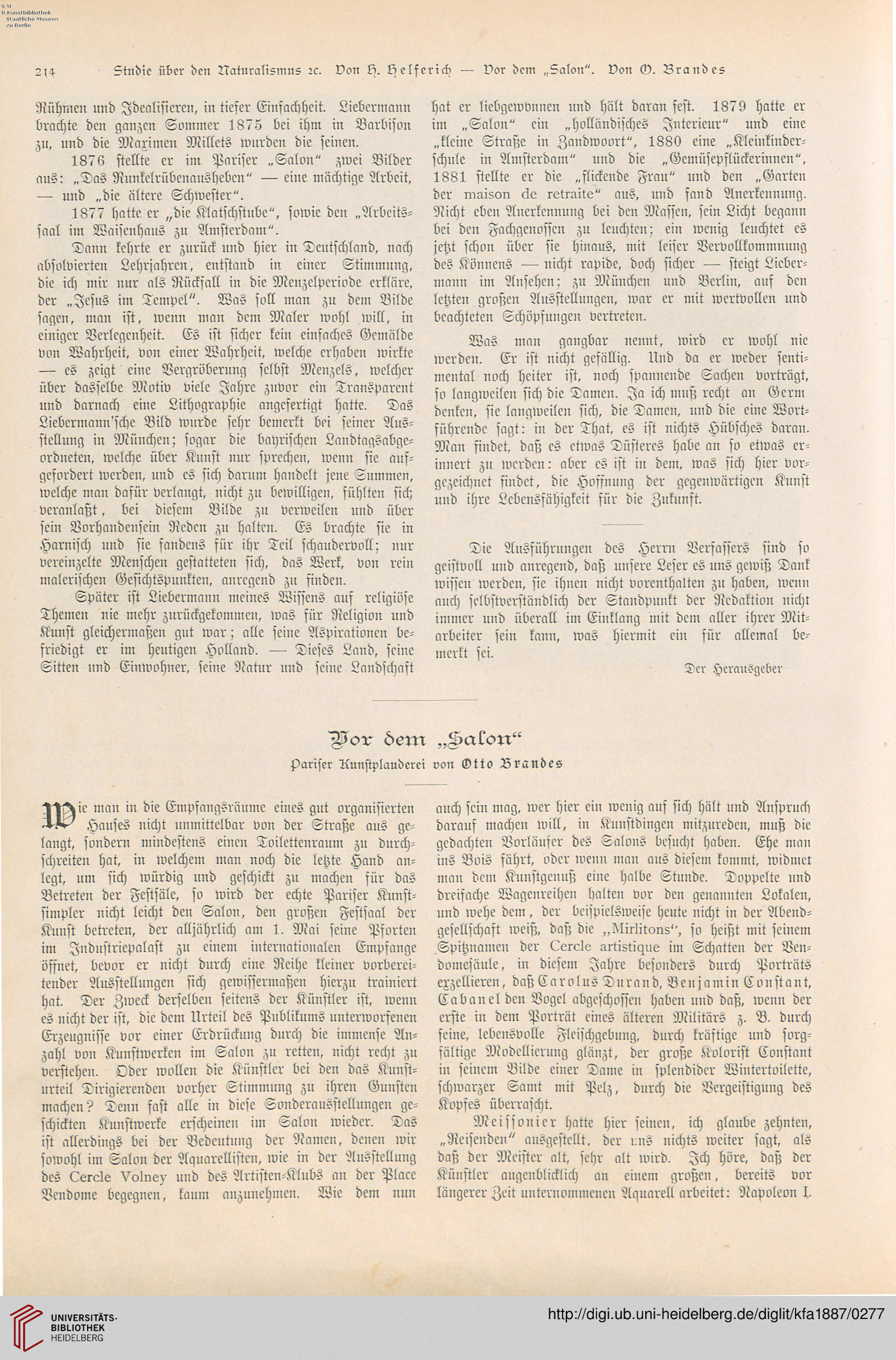2,4
?tndic übcr dcn Natnralismns rc. von lr. kielfcrich — vor dcm „Salon". von G. Brand es
Nühmen und Jdealisieren, in tiefer Einfachheit. Liebermann
brachte den ganzen Sommer 1875 bei ihm in Barbison
zn, nnd die Marimen Millets wurden die seinen.
1876 stellte er im Pariser „Salon" zwei Bilder
ans: „Das Rnnkelrnbenaushebcn" — eine mächtige Arbeit,
— nnd „die ältere Schwester".
1877 hatte er „die Klatschstnbe", sowie den „Arbeits-
saal im Waisenhans zn Amsterdam".
Dann kehrte er zurück nnd hier in Deutschland, nach
absolvierten Lehrjahren, entstand in einer Stimmnng,
die ich mir nnr nls Nückfall in die Menzelperiode crklare,
der „Jesns im Tempel". Was soll man zu dem Bilde
sagen, man ist, wenn man dcm Maler wohl will, in
einiger Vcrlegcnheit. Es ist sicher kcin einfaches Gemälde
von Wahrheit, von einer Wahrheit, welche erhaben wirkte
— es zeigt eine Vergröberung sclbst Menzels, wclcher
über dasselbe Motiv viele Jahre znvor ein Transparent
nnd darnach eine Lithographie angefertigt hattc. Das
Liebcrmann'sche Bild wnrde sehr bemerkt bei seiner Ans-
stellnng in München; sogar die bayrischen Landtagsabgc-
ordneten, welche über Knnst nur sprechen, wenn sie auf-
gefordert werden, nnd cs sich darnm hnndclt jene Summen,
welche man dofür verlangt, nicht zn bewilligen, fühlten sich
veranlaßt, bei diescm Bilde zu verweilcn nnd über
sein Vorhandcnsein Redcn zu halten. Es brachte sie in
Harnisch nnd sie fandcns für ihr Tcil schaudervoll: nnr
vereinzelte Menschen gestatteten sich, das Werk, von rein
malerischen Gesichtspiiiikten, anrcgend zu sinden.
Später ist Liebermann nieines Wissens anf rcligiöse
Themen nie mehr znrückgekommen, was für Religion und
Kunst gleichermaßeu gnt war; alle seine Aspirationen be-
friedigt er im hentigen Holland. — Dieses Laud, seine
Sitten nnd Einwohner, seine Natnr nnd seine Landschaft
hat er liebgewvnnen und hält daran fest. 1879 hatte er
im „Salon" cin „holländisches Jnterieur" und eine
„klcine Straße iu Zandwovrt", 1880 eine „Kleinkindcr-
schule in Amsterdam" nnd die „Gemüsepflückerinnen",
1881 stellte er die „flickeude Frau" nnd den „Garten
der mnisoii cle retraite" aus, nnd fand Anerkcnnnug.
Nicht eben Anerkennuug bei dcn Masscu, sein Licht begann
bei dcn Fachgenosscn zu lenchtcn; ein wcnig leuchtet es
jekt schou über sie hinaus, mit lciscr Bervollkommnung
des Könneus — nicht rapide, doch sicher — steigt Licbcr-
mann im Ansehen; zn Müuchen und Bcrlin, auf dcu
letzten großeu Ausstellungen, war er mit wertvollen und
beachteten Schöpfuugcn vertreten.
Was man gangbar nennt, wird er wohl nie
wcrden. Er ist nicht gefällig. Ilnd da er wcder senti-
mental noch heiter ist, noch spannende Sachen vorträgt,
so langweilen sich die Tamen. Ja ich mnß rccht an Germ
denken, sie laugweilen sich, die Damen, und die eine Wort-
führendc sagt: in der That, es ist nichts Hübsches darau.
Man findet, daß es ctwas Düsteres habe an so etwas er-
innert zn wcrdcn: aber es ist in dem, was sich hier vor-
gczeichnet sindct, die Hoffnung dcr gegeuwärtigcn Kunst
und ihre Lebensfähigkeit sür die Zuknnft.
Die Ansführiingen des Herrn Verfassers sind so
geistvoll nnd anregend, daß unsere Leser es uns gewiß Dank
wissen werden, sie ihnen nicht vorenthalten zu haben, wcnn
anch sclbstverstündlich dcr Standpunkt dcr Nedaktion nicht
imnier und überall im Einklang mit dcm aller ihrer Bcit-
arbeiter sein kann, was hiermit ein für allemal be-
merkt sei.
Der Herausgeber
Wor: öern „Scrton"
pariser Aunstplauderei von Dtto Brandes
l^iie man in die Empfaiigsräume eines gut organisierten
Hanses nicht niimittelbar von der Straße aus ge-
langt, sondern mindestens eincn Toilettenraum zu durch-
schreiten hat, in welchem man noch die letzte Hand an-
legt, nm sich würdig nnd geschickt zu machen für das
Betreten der Festsäle, so wird der echte Pariser Kunst-
simplcr nicht leicht den Salon, den großen Festsaal der
Kunst betieten, dcr alljährlich am 1. Mai seine Pforten
im Jndnstriepalast zu eineni internationalen Empfange
öffnet, bevor er nicht durch ciue Reihe kleiner vorberei-
tender Ausstellungen sich gewissermaßen hierzu trainiert
hat. Der Zweck derselbeu seitens der Küustler ist, wenn
es uicht der ist, die dem Urteil des Pnblikums unterworfenen
Erzeugnisse vor einer Erdrücknng durch die immense An-
zahl von Kunstwerken im Salon zu retten, nicht recht zu
verstehen. Oder wollen die Künstler bci den das Kunst-
urteil Dirigierenden vorher Stimmnng zu ihren Gunstcn
inachen? Denn fast alle in dicse Sonderaiisstellungen ge-
schickten Kunstwerke erscheinen im Salon wieder. Das
ist allerdings bei der Bedentnug der Namen, dcnen wir
sowohl im Salon der Aquarellisten, wie in der Ansstellung
des Lercle Volnev und des Artisten-Klnbs an der Place
Vendome begegneu, kaum anziinehmen. Wie dem nun
anch scin mag, wer hier ein wenig auf sich hält uud Anspruch
darauf machen will, in Kiinstdingen mitzuredcu, muß die
gedachten Vorläufcr des Salous besncht haben. Ehe nian
ins Bois fährt, odcr wenn man aus diescm konimt, widmct
man dem Kunstgenuß eine halbe Stunde. Doppelte nnd
dreifache Wagenreihen halteu vor dcn genannten Lokalen,
nnd wehe dem, der bcispielsweise heute nicht in der Abend-
gesellschaft weiß, daß die „lllii'Iitous", so heißt mit seincm
.Spitznamen der Lercle urtistigue im Schatten der Ven-
domesäule, iu diesem Jahre besonders durch Porträts
exzellieren, daß Carolus Durand, Benjamin Constant,
Cabanel den Vogel abgeschosscu haben nnd daß, wenn der
erste in dem Porträt eines älteren Militärs z. B. durch
feine, lebensvolle Fleischgebuug, durch kräftige und sorg-
fältige Modelliernng glänzt, der große Kolorist Constant
in seiuem Bilde einer Dame in splendider Wintertoilctte,
schwarzer Sanit mit Pelz, durch die Vergeistigung des
Kopfes überrascht.
Meissonier hatte hier seineu, ich glaube zehnten,
„Reisenden" ausgestellt, der i:ns uichts wciter sagt, als
daß der Mcister alt, sehr alt wird. Jch höre, daß der
Künstler augenblicklich an einem großen, bereits vor
längerer Zcit unternomiuenen Aquarell arbeitet: Napoleon I.
?tndic übcr dcn Natnralismns rc. von lr. kielfcrich — vor dcm „Salon". von G. Brand es
Nühmen und Jdealisieren, in tiefer Einfachheit. Liebermann
brachte den ganzen Sommer 1875 bei ihm in Barbison
zn, nnd die Marimen Millets wurden die seinen.
1876 stellte er im Pariser „Salon" zwei Bilder
ans: „Das Rnnkelrnbenaushebcn" — eine mächtige Arbeit,
— nnd „die ältere Schwester".
1877 hatte er „die Klatschstnbe", sowie den „Arbeits-
saal im Waisenhans zn Amsterdam".
Dann kehrte er zurück nnd hier in Deutschland, nach
absolvierten Lehrjahren, entstand in einer Stimmnng,
die ich mir nnr nls Nückfall in die Menzelperiode crklare,
der „Jesns im Tempel". Was soll man zu dem Bilde
sagen, man ist, wenn man dcm Maler wohl will, in
einiger Vcrlegcnheit. Es ist sicher kcin einfaches Gemälde
von Wahrheit, von einer Wahrheit, welche erhaben wirkte
— es zeigt eine Vergröberung sclbst Menzels, wclcher
über dasselbe Motiv viele Jahre znvor ein Transparent
nnd darnach eine Lithographie angefertigt hattc. Das
Liebcrmann'sche Bild wnrde sehr bemerkt bei seiner Ans-
stellnng in München; sogar die bayrischen Landtagsabgc-
ordneten, welche über Knnst nur sprechen, wenn sie auf-
gefordert werden, nnd cs sich darnm hnndclt jene Summen,
welche man dofür verlangt, nicht zn bewilligen, fühlten sich
veranlaßt, bei diescm Bilde zu verweilcn nnd über
sein Vorhandcnsein Redcn zu halten. Es brachte sie in
Harnisch nnd sie fandcns für ihr Tcil schaudervoll: nnr
vereinzelte Menschen gestatteten sich, das Werk, von rein
malerischen Gesichtspiiiikten, anrcgend zu sinden.
Später ist Liebermann nieines Wissens anf rcligiöse
Themen nie mehr znrückgekommen, was für Religion und
Kunst gleichermaßeu gnt war; alle seine Aspirationen be-
friedigt er im hentigen Holland. — Dieses Laud, seine
Sitten nnd Einwohner, seine Natnr nnd seine Landschaft
hat er liebgewvnnen und hält daran fest. 1879 hatte er
im „Salon" cin „holländisches Jnterieur" und eine
„klcine Straße iu Zandwovrt", 1880 eine „Kleinkindcr-
schule in Amsterdam" nnd die „Gemüsepflückerinnen",
1881 stellte er die „flickeude Frau" nnd den „Garten
der mnisoii cle retraite" aus, nnd fand Anerkcnnnug.
Nicht eben Anerkennuug bei dcn Masscu, sein Licht begann
bei dcn Fachgenosscn zu lenchtcn; ein wcnig leuchtet es
jekt schou über sie hinaus, mit lciscr Bervollkommnung
des Könneus — nicht rapide, doch sicher — steigt Licbcr-
mann im Ansehen; zn Müuchen und Bcrlin, auf dcu
letzten großeu Ausstellungen, war er mit wertvollen und
beachteten Schöpfuugcn vertreten.
Was man gangbar nennt, wird er wohl nie
wcrden. Er ist nicht gefällig. Ilnd da er wcder senti-
mental noch heiter ist, noch spannende Sachen vorträgt,
so langweilen sich die Tamen. Ja ich mnß rccht an Germ
denken, sie laugweilen sich, die Damen, und die eine Wort-
führendc sagt: in der That, es ist nichts Hübsches darau.
Man findet, daß es ctwas Düsteres habe an so etwas er-
innert zn wcrdcn: aber es ist in dem, was sich hier vor-
gczeichnet sindct, die Hoffnung dcr gegeuwärtigcn Kunst
und ihre Lebensfähigkeit sür die Zuknnft.
Die Ansführiingen des Herrn Verfassers sind so
geistvoll nnd anregend, daß unsere Leser es uns gewiß Dank
wissen werden, sie ihnen nicht vorenthalten zu haben, wcnn
anch sclbstverstündlich dcr Standpunkt dcr Nedaktion nicht
imnier und überall im Einklang mit dcm aller ihrer Bcit-
arbeiter sein kann, was hiermit ein für allemal be-
merkt sei.
Der Herausgeber
Wor: öern „Scrton"
pariser Aunstplauderei von Dtto Brandes
l^iie man in die Empfaiigsräume eines gut organisierten
Hanses nicht niimittelbar von der Straße aus ge-
langt, sondern mindestens eincn Toilettenraum zu durch-
schreiten hat, in welchem man noch die letzte Hand an-
legt, nm sich würdig nnd geschickt zu machen für das
Betreten der Festsäle, so wird der echte Pariser Kunst-
simplcr nicht leicht den Salon, den großen Festsaal der
Kunst betieten, dcr alljährlich am 1. Mai seine Pforten
im Jndnstriepalast zu eineni internationalen Empfange
öffnet, bevor er nicht durch ciue Reihe kleiner vorberei-
tender Ausstellungen sich gewissermaßen hierzu trainiert
hat. Der Zweck derselbeu seitens der Küustler ist, wenn
es uicht der ist, die dem Urteil des Pnblikums unterworfenen
Erzeugnisse vor einer Erdrücknng durch die immense An-
zahl von Kunstwerken im Salon zu retten, nicht recht zu
verstehen. Oder wollen die Künstler bci den das Kunst-
urteil Dirigierenden vorher Stimmnng zu ihren Gunstcn
inachen? Denn fast alle in dicse Sonderaiisstellungen ge-
schickten Kunstwerke erscheinen im Salon wieder. Das
ist allerdings bei der Bedentnug der Namen, dcnen wir
sowohl im Salon der Aquarellisten, wie in der Ansstellung
des Lercle Volnev und des Artisten-Klnbs an der Place
Vendome begegneu, kaum anziinehmen. Wie dem nun
anch scin mag, wer hier ein wenig auf sich hält uud Anspruch
darauf machen will, in Kiinstdingen mitzuredcu, muß die
gedachten Vorläufcr des Salous besncht haben. Ehe nian
ins Bois fährt, odcr wenn man aus diescm konimt, widmct
man dem Kunstgenuß eine halbe Stunde. Doppelte nnd
dreifache Wagenreihen halteu vor dcn genannten Lokalen,
nnd wehe dem, der bcispielsweise heute nicht in der Abend-
gesellschaft weiß, daß die „lllii'Iitous", so heißt mit seincm
.Spitznamen der Lercle urtistigue im Schatten der Ven-
domesäule, iu diesem Jahre besonders durch Porträts
exzellieren, daß Carolus Durand, Benjamin Constant,
Cabanel den Vogel abgeschosscu haben nnd daß, wenn der
erste in dem Porträt eines älteren Militärs z. B. durch
feine, lebensvolle Fleischgebuug, durch kräftige und sorg-
fältige Modelliernng glänzt, der große Kolorist Constant
in seiuem Bilde einer Dame in splendider Wintertoilctte,
schwarzer Sanit mit Pelz, durch die Vergeistigung des
Kopfes überrascht.
Meissonier hatte hier seineu, ich glaube zehnten,
„Reisenden" ausgestellt, der i:ns uichts wciter sagt, als
daß der Mcister alt, sehr alt wird. Jch höre, daß der
Künstler augenblicklich an einem großen, bereits vor
längerer Zcit unternomiuenen Aquarell arbeitet: Napoleon I.