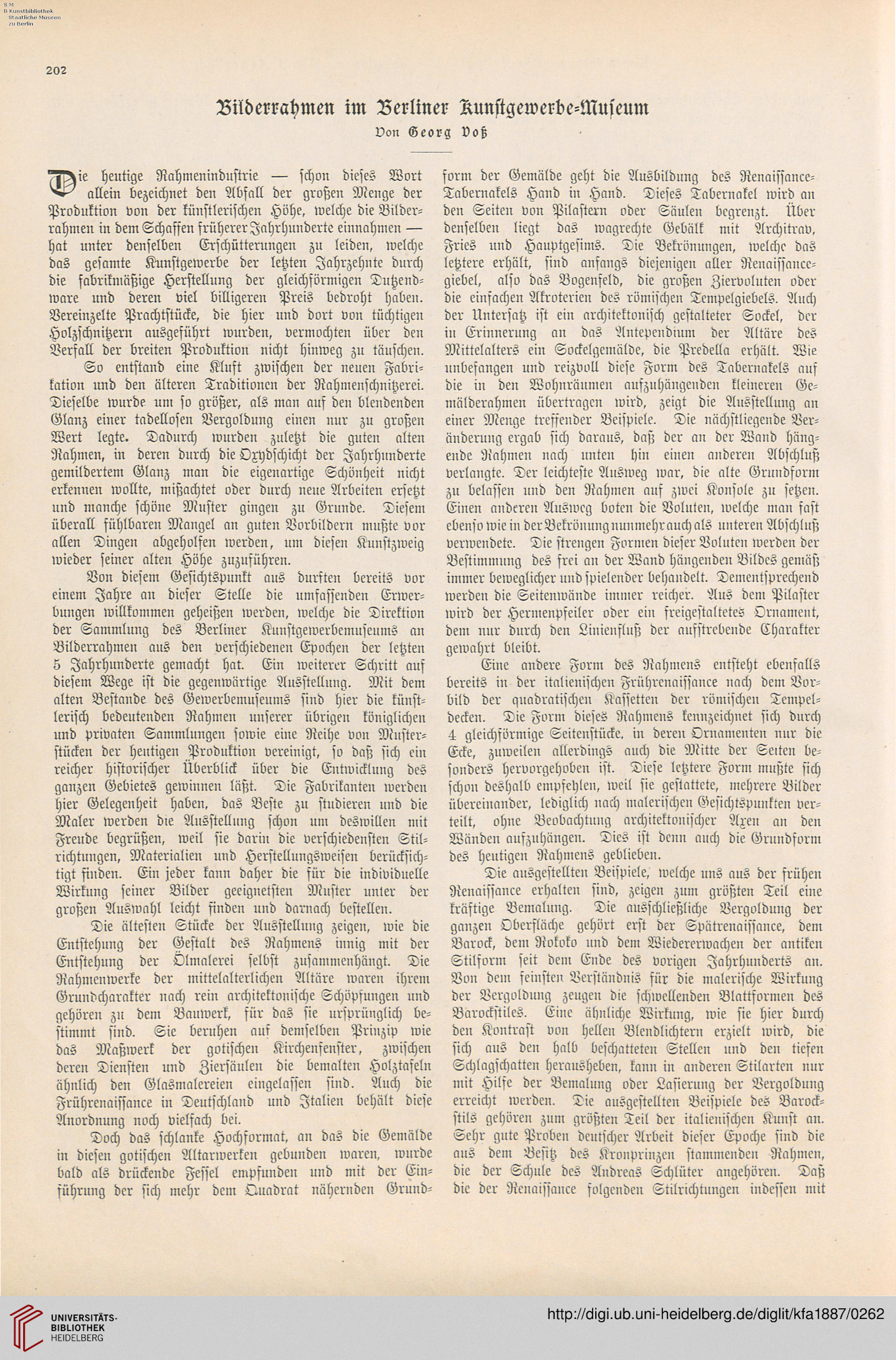202
Bilderrahrnen im Berliner Lunstgerverbe-Muieum
von Georg voß
77l>ie heutige Rahmenindustrie — schon dieses Wort
allein bezeichnet den Abfall der großen Menge der
Produktion von der künstlerischen Höhe, welche die Bilder-
rahmen in dem Schaffen frühererJahrhunderte einnahmen —
hat unter denselben Erschütterungen zu leiden, welche
das gesamte Kunstgewerbe der letzten Jahrzehnte durch
die fabrikmäßige Herstellung der gleichförmigen Tutzend-
ware und deren viel billigeren Preis bedroht haben.
Vereinzelte Prachtstücke, die hier und dort von tüchtigen
Holzschnitzern ausgeführt wurden, vermochten über den
Verfall der breiten Produktion nicht hinweg zu täuschen.
So entstand eine Kluft zwischen der neuen Fabri-
kation und den älteren Traditionen der Nahmenschnitzerei.
Dieselbe wurde um so größer, als man anf den blendenden
Glanz einer tadellosen Vergoldung einen nur zn großen
Wert legte. Dadurch wurden zuletzt die guten alten
Rahmen, in deren dnrch die Oxydschicht der Jahrhnnderte
gemildertem Glanz man die eigenartige Schönheit nicht
erkennen wollte, mißachtet oder durch nene Arbeiten ersetzt
und manche schöne Muster gingen zu Grunde. Diesem
überall fühlbaren Mangel an guten Vorbildern mußte vor
allen Dingen abgeholfen werden, um diesen Kunstzweig
wieder seiner alten Höhe znzuführen.
Von diesem Gesichtspunkt aus durften bereits vor
einem Jahre an dieser Stelle die umfassenden Erwer-
bungen willkommen geheißen werden, welche die Direktion
der Sammlung des Berliner Kunstgewerbemusenms an
Bilderrahmen aus den verschiedenen Epochen der letzten
5 Jahrhunderte gemacht hat. Ein weiterer Schritt auf
diesem Wege ist die gegenwärtige Ausstellnng. Mit dem
alten Bestande des Gewerbemusenms sind hier die künst-
lerisch bedeutenden Rahmen unserer übrigen königlichen
und privaten Sammlungen sowie eine Reihe von Mnster-
stücken der hentigen Produktion vereinigt, so daß sich ein
reicher historischer Überblick über die Entwickiung des
ganzen Gebietes gewinnen läßt. Die Fabrikanten werden
hier Gelegenheit haben, das Beste zu studieren und die
Maler werden die Ansstellnng schon um deswillen niit
Freude begrüßen, weil sie darin die verschiedensten Stil-
richtungen, Materialien und Herstellungsweisen berücksich-
tigt finden. Ein jeder kann daher die für die individnelle
Wirkung seiner Bilder geeignetsten Muster unler der
großen Auswahl leicht finden nnd darnach bestellen.
Die ältesten Stücke der Ausstellung zeigen, wie die
Entstehnng der Gestalt des Rahmens innig mit der
Entstehung der Ölmalerei selbst zusammenhängt. Die
Rahmenwerke der mittelalterlichen Altäre waren ihrem
Grundcharakter nach rein architektonische Schöpfungen und
gehören zn dem Banwerk, für das sie ursprünglich be-
stimmt sind. Sie beruhen auf demselben Prinzip wie
das Maßwerk der gotischen Kirchenfenster, zwischen
deren Diensten nnd Ziersäulen die bemalten Holztafeln
ähnlich den Glasmalereien eingelassen sind. Auch die
Frührenaissance in Deutschland und Jtalien behält diese
Anordnung noch vielfach bei.
Doch das schlanke Hochformat, an das die Gemälde
in diesen gotischen Altarwerken gebunden waren, wnrde
bald als drückende Fessel empfunden und mit der Ein-
führung der sich mehr dem Ouadrat nähernden Grund-
form der Gemälde geht die Ausbildung des Renaissance-
Tabernakels Hand in Hand. Dieses Tabernakel wird an
den Seiten von Pilastern oder Säulen begrenzt. Über
denselben liegt das wagrechte Gebälk mit Architrav,
Fries und Hauptgesims. Die Bekrönungen, welche das
letztere erhält, sind anfangs diejenigen aller Renaissancc-
giebel, also das Bogenfeld, die großen Ziervoluten oder
die einfachen Akroterien des römischen Tcmpelgiebels. Anch
der Untersatz ist ein architektonisch gestalteter Sockel, der
in Erinnerung an das Antependium der Altäre des
Mittelalters ein Sockelgemülde, die Predella erhält. Wie
nnbefangen und reizvoll diese Form des Tabernakels auf
die in den Wohnränmen aufznhängenden kieineren Ge-
mälderahmen übertragcn wird, zeigt die Ansstellung an
einer Menge treffender Beispiele. Die nächstliegende Ver-
änderung ergab sich darans, daß der an dcr Wand häng-
ende giahmen nach unten hin einen anderen Abschluß
verlangte. Der leichteste Answeg war, die alte Grnndform
zu belassen nnd den Rahmen auf zwci Konsole zu setzen.
Einen andcren Auswcg boten die Voluten, welche man fast
ebenso wie in derBekrönungnunmehranch als nnteren Abschlnß
verwendetc. Die strengen Formen dieser Volnten werden der
Bestimmnng des frci an der Wand hängenden Bildes geniäs;
immer beweglicher und spielender behandelt. Dementsprechend
werden die Seitenwände immer reicher. Aus dem Pilaster
wird der Hermenpfeiler oder ein freigestaltetes Ornameiit,
dem nur dnrch den Linienflnß der aufstrebende Charakter
gewahrt bleibt.
Eine andere Form des Nahmens entsteht ebenfalls
bereits in der italienischen Frührenaissance nach dem Vor-
bild der quadratischen Kassetten der römischen Tempel-
decken. Die Form dieses Rahmens kennzeichnet sich dnrch
4 gleichförmige Seitenstücke, in deren Ornamenten nnr die
Ecke, zuweilen allerdings auch die Mitte der Seiten be-
sonders hervorgehoben ist. Diese letztere Form mnßte sich
schon deshalb empfchlen, weil sie gestattcte, mehrere Bilder
übereinander, lediglich nach malerischen Gesichtspnnkten ver-
teilt, ohne Beobachtnng architektonischer Axen an den
Wänden aufzuhängen. Dies ist dcnn anch die Grnndform
des hentigen Rahmens geblieben.
Die ansgestellten Beispiele, ivelche nns aus der frühen
Renaissance erhalten sind, zeigen zum größten Teil eine
kräftige Bemalnng. Die ansschließliche Vergoldung der
ganzen Oberfläche gehört erst der Spätrenaissance, dem
Barock, dem Rokoko und dem Wiedererwachen der antiken
Stilform seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts an.
Von dem feinsten Verständnis für die malerische Wirkung
der Vergoldnng zeugen die schwellenden Blattformen des
Barockstiles. Eine ähnliche Wirküng, wie sie hier dnrch
den Kontrast von hellen Blendlichtern erzielt wird, die
sich aus den halb beschatteten Stellen und den tiefen
Schlagschatten heransheben, kann in anderen Stilarten nur
mit Hilfe der Bemalung oder Lasierung der Vergoldung
erreicht werden. Die ausgestellten Beispiele des Barock-
stils gehören zum größten Teil der italienischen Kunst an.
Sehr gute Proben deutscher Arbeit dieser Epoche sind die
ans dem Besitz des Kronprinzen stammenden Rahmen,
die der Schnle des Andreas Schlüter angehören. Daß
dic der Renaissance folgcnden Stilrichtnngen indessen mit
Bilderrahrnen im Berliner Lunstgerverbe-Muieum
von Georg voß
77l>ie heutige Rahmenindustrie — schon dieses Wort
allein bezeichnet den Abfall der großen Menge der
Produktion von der künstlerischen Höhe, welche die Bilder-
rahmen in dem Schaffen frühererJahrhunderte einnahmen —
hat unter denselben Erschütterungen zu leiden, welche
das gesamte Kunstgewerbe der letzten Jahrzehnte durch
die fabrikmäßige Herstellung der gleichförmigen Tutzend-
ware und deren viel billigeren Preis bedroht haben.
Vereinzelte Prachtstücke, die hier und dort von tüchtigen
Holzschnitzern ausgeführt wurden, vermochten über den
Verfall der breiten Produktion nicht hinweg zu täuschen.
So entstand eine Kluft zwischen der neuen Fabri-
kation und den älteren Traditionen der Nahmenschnitzerei.
Dieselbe wurde um so größer, als man anf den blendenden
Glanz einer tadellosen Vergoldung einen nur zn großen
Wert legte. Dadurch wurden zuletzt die guten alten
Rahmen, in deren dnrch die Oxydschicht der Jahrhnnderte
gemildertem Glanz man die eigenartige Schönheit nicht
erkennen wollte, mißachtet oder durch nene Arbeiten ersetzt
und manche schöne Muster gingen zu Grunde. Diesem
überall fühlbaren Mangel an guten Vorbildern mußte vor
allen Dingen abgeholfen werden, um diesen Kunstzweig
wieder seiner alten Höhe znzuführen.
Von diesem Gesichtspunkt aus durften bereits vor
einem Jahre an dieser Stelle die umfassenden Erwer-
bungen willkommen geheißen werden, welche die Direktion
der Sammlung des Berliner Kunstgewerbemusenms an
Bilderrahmen aus den verschiedenen Epochen der letzten
5 Jahrhunderte gemacht hat. Ein weiterer Schritt auf
diesem Wege ist die gegenwärtige Ausstellnng. Mit dem
alten Bestande des Gewerbemusenms sind hier die künst-
lerisch bedeutenden Rahmen unserer übrigen königlichen
und privaten Sammlungen sowie eine Reihe von Mnster-
stücken der hentigen Produktion vereinigt, so daß sich ein
reicher historischer Überblick über die Entwickiung des
ganzen Gebietes gewinnen läßt. Die Fabrikanten werden
hier Gelegenheit haben, das Beste zu studieren und die
Maler werden die Ansstellnng schon um deswillen niit
Freude begrüßen, weil sie darin die verschiedensten Stil-
richtungen, Materialien und Herstellungsweisen berücksich-
tigt finden. Ein jeder kann daher die für die individnelle
Wirkung seiner Bilder geeignetsten Muster unler der
großen Auswahl leicht finden nnd darnach bestellen.
Die ältesten Stücke der Ausstellung zeigen, wie die
Entstehnng der Gestalt des Rahmens innig mit der
Entstehung der Ölmalerei selbst zusammenhängt. Die
Rahmenwerke der mittelalterlichen Altäre waren ihrem
Grundcharakter nach rein architektonische Schöpfungen und
gehören zn dem Banwerk, für das sie ursprünglich be-
stimmt sind. Sie beruhen auf demselben Prinzip wie
das Maßwerk der gotischen Kirchenfenster, zwischen
deren Diensten nnd Ziersäulen die bemalten Holztafeln
ähnlich den Glasmalereien eingelassen sind. Auch die
Frührenaissance in Deutschland und Jtalien behält diese
Anordnung noch vielfach bei.
Doch das schlanke Hochformat, an das die Gemälde
in diesen gotischen Altarwerken gebunden waren, wnrde
bald als drückende Fessel empfunden und mit der Ein-
führung der sich mehr dem Ouadrat nähernden Grund-
form der Gemälde geht die Ausbildung des Renaissance-
Tabernakels Hand in Hand. Dieses Tabernakel wird an
den Seiten von Pilastern oder Säulen begrenzt. Über
denselben liegt das wagrechte Gebälk mit Architrav,
Fries und Hauptgesims. Die Bekrönungen, welche das
letztere erhält, sind anfangs diejenigen aller Renaissancc-
giebel, also das Bogenfeld, die großen Ziervoluten oder
die einfachen Akroterien des römischen Tcmpelgiebels. Anch
der Untersatz ist ein architektonisch gestalteter Sockel, der
in Erinnerung an das Antependium der Altäre des
Mittelalters ein Sockelgemülde, die Predella erhält. Wie
nnbefangen und reizvoll diese Form des Tabernakels auf
die in den Wohnränmen aufznhängenden kieineren Ge-
mälderahmen übertragcn wird, zeigt die Ansstellung an
einer Menge treffender Beispiele. Die nächstliegende Ver-
änderung ergab sich darans, daß der an dcr Wand häng-
ende giahmen nach unten hin einen anderen Abschluß
verlangte. Der leichteste Answeg war, die alte Grnndform
zu belassen nnd den Rahmen auf zwci Konsole zu setzen.
Einen andcren Auswcg boten die Voluten, welche man fast
ebenso wie in derBekrönungnunmehranch als nnteren Abschlnß
verwendetc. Die strengen Formen dieser Volnten werden der
Bestimmnng des frci an der Wand hängenden Bildes geniäs;
immer beweglicher und spielender behandelt. Dementsprechend
werden die Seitenwände immer reicher. Aus dem Pilaster
wird der Hermenpfeiler oder ein freigestaltetes Ornameiit,
dem nur dnrch den Linienflnß der aufstrebende Charakter
gewahrt bleibt.
Eine andere Form des Nahmens entsteht ebenfalls
bereits in der italienischen Frührenaissance nach dem Vor-
bild der quadratischen Kassetten der römischen Tempel-
decken. Die Form dieses Rahmens kennzeichnet sich dnrch
4 gleichförmige Seitenstücke, in deren Ornamenten nnr die
Ecke, zuweilen allerdings auch die Mitte der Seiten be-
sonders hervorgehoben ist. Diese letztere Form mnßte sich
schon deshalb empfchlen, weil sie gestattcte, mehrere Bilder
übereinander, lediglich nach malerischen Gesichtspnnkten ver-
teilt, ohne Beobachtnng architektonischer Axen an den
Wänden aufzuhängen. Dies ist dcnn anch die Grnndform
des hentigen Rahmens geblieben.
Die ansgestellten Beispiele, ivelche nns aus der frühen
Renaissance erhalten sind, zeigen zum größten Teil eine
kräftige Bemalnng. Die ansschließliche Vergoldung der
ganzen Oberfläche gehört erst der Spätrenaissance, dem
Barock, dem Rokoko und dem Wiedererwachen der antiken
Stilform seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts an.
Von dem feinsten Verständnis für die malerische Wirkung
der Vergoldnng zeugen die schwellenden Blattformen des
Barockstiles. Eine ähnliche Wirküng, wie sie hier dnrch
den Kontrast von hellen Blendlichtern erzielt wird, die
sich aus den halb beschatteten Stellen und den tiefen
Schlagschatten heransheben, kann in anderen Stilarten nur
mit Hilfe der Bemalung oder Lasierung der Vergoldung
erreicht werden. Die ausgestellten Beispiele des Barock-
stils gehören zum größten Teil der italienischen Kunst an.
Sehr gute Proben deutscher Arbeit dieser Epoche sind die
ans dem Besitz des Kronprinzen stammenden Rahmen,
die der Schnle des Andreas Schlüter angehören. Daß
dic der Renaissance folgcnden Stilrichtnngen indessen mit