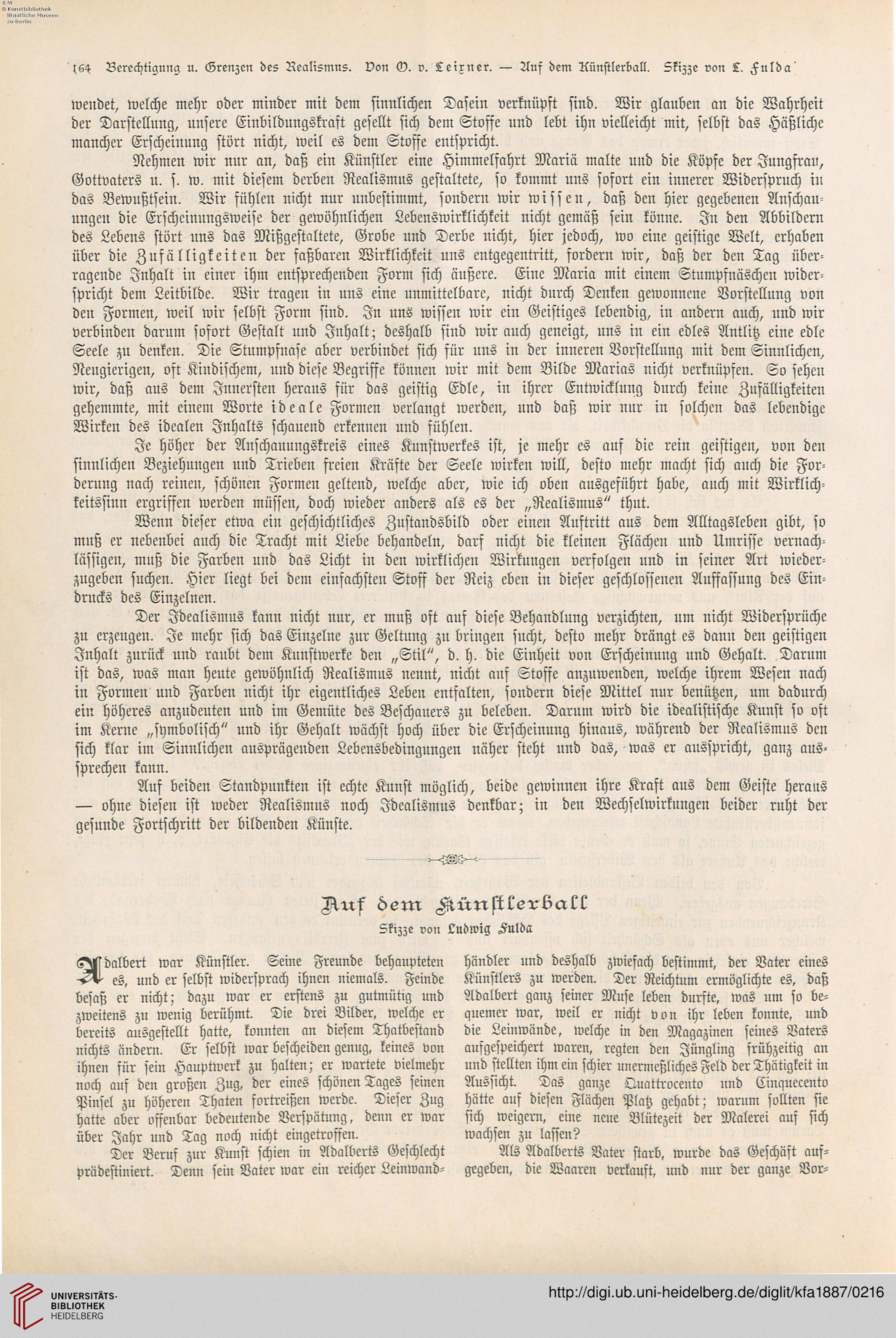(SH Berechtignnq u. Grenzen des Realismns. von V. v. Leixner. — Auf dem Aünstlerball. 5kizze von 5. Fulda'
wendet, welche mehr oder minder mit dem sinnlichen Dasein verknüpft sind. Wir glauben an die Wahrheit
der Darstellung, unsere Einbildungskraft gesellt sich dem Stoffe und lebt ihn vielleicht mit, selbst das Häßliche
mancher Erscheinung stört nicht, weil es dem Stoffe entspricht.
Nehmen wir nnr an, daß ein Künstler eine Himmelfahrt Mariä malte und die Köpfe der Jungfrau,
Gottvaters u. s. w. mit diesem derben Realismus gestaltete, so kommt uns sofort ein innerer Widerspruch iu
das Bewußtsein. Wir fühlen nicht nur unbestimmt, sondern wir wissen, daß den hier gegebenen Anschau-
ungen die Erschcinungsweise der gewöhnlichen Lebenswirklichkeit nicht gemäß sein könne. Jn den Abbildern
des Lebens stört uns das Mißgestaltete, Grobe und Derbe nicht, hier jedoch, wo eine geistigc Welt, crhaben
über die Zufälligkeiten der faßbaren Wirklichkeit uns entgegentritt, fordern wir, daß der den Tag über-
ragende Jnhalt in einer ihm entsprechenden Form sich äußere. Eine Maria mit einem Stumpfnäschen wider-
spricht dem Leitbilde. Wir tragen in uns eine unmittelbare, nicht durch Denken gewonnene Vorstellung von
den Formen, weil wir selbst Form sind. Jn uns wissen wir ein Geistiges lebendig, in andern auch, und wir
verbinden darum sofort Gestalt und Jnhalt; deshalb sind wir auch geneigt, uns in ein edles Antlitz eine edle
Seele zu denken. Die Stumpfnase aber verbindet sich für uns in der inneren Vorstellung mit dem Sinnlichen,
Neugierigen, oft Kindischem, nnd diese Begriffe können wir mit dem Bilde Marias nicht verknüpfen. So sehen
wir, daß aus dem Jnnersten herans für das geistig Edle, in ihrer Entwicklung durch keiue Zufälligkeiten
gehemmte, mit einem Worte ideale Formen verlangt werden, nnd daß wir nur in solchen das lebendigc
Wirken des idealen Jnhalts schauend erkennen und fühlen.
Je höher der Anschauungskreis eines Kunstwerkes ist, je mehr es auf die rein geistigeu, von den
sinnlichen Beziehungen und Trieben freien Kräfte der Seele wirken will, desto mehr macht sich auch die For-
derung nach reinen, schönen Formen geltend, welche aber, wie ich oben ausgeführt habe, auch mit Wirklich-
keitssinn ergriffen werden müssen, doch wieder anders als es der „Realismus" thut.
Wenn dieser etwa ein geschichtliches Zustandsbild oder einen Auftritt aus dem Alltagsleben gibt, so
muß er nebenbei auch die Tracht mit Liebe behandeln, darf nicht die kleinen Flächen und Umriffe vernach-
lässigen, muß die Farben und das Licht in den wirklichen Wirknngen verfolgen und in seiner Art wieder-
zugeben suchen. Hier liegt bei dem einfachsten Stoff der Reiz eben in dieser geschlossenen Auffassung des Ein-
drucks des Einzelnen.
Der Jdealismus kann nicht nur, er muß oft auf diese Behandlung verzichten, um nicht Widersprüche
zn erzengen. Je mehr sich das Einzelne zur Geltung zu bringen sucht, desto mehr drängt es dann den geistigen
Jnhalt zurück uud raubt dem Knnstwerke den „Stil", d. h. die Einheit von Erscheinung und Gehalt. Darum
ist das, was man heute gewöhnlich Realismus nennt, nicht anf Stoffe anzuwenden, welche ihrem Wesen nach
in Formen und Farben nicht ihr eigentliches Leben entfalten, sondern diese Mittel nur benützen, um dadurch
ein höheres anzudeuten und im Gemüte des Beschauers zu beleben. Darum wird die idealistische Kunst so oft
im Kerne „symbolisch" und ihr Gehalt wächst hoch über die Erscheinung hinaus, während der Realismus den
sich klar im Sinnlichen ausprägenden Lebensbedingungen näher steht und das, was er ausspricht, ganz aus-
sprechen kann.
Auf beiden Standpunkten ist echte Kunst möglich, beide gewinnen ihre Kraft aus dem Geiste heraus
— ohne diesen ist weder Realismus noch Jdealismus denkbar; in den Wechselwirkungen beider ruht der
gesunde Fortschritt der bildenden Künste.
Auf öern KünftLevbcrLc
Skizze von Ludwig Fulda
dalbert war Künstler. Seine Freunde behaupteten
es, und er selbst widersprach ihnen niemals. Feinde
besaß er nicht; dazu war er erstens zu gutmütig und
zweitens zu wenig berühmt. Die drei Bilder, welche er
bereits ausgestellt hatte, konnten an diesem Thatbestand
nichts ändern. Er selbst war bescheiden genug, keines von
ihnen für sein Hauptwerk zu halten; er wartete vielmehr
noch auf den großen Zug, der eines schönen Tages seinen
Pinsel zu höheren Thaten fortreißen werde. Dieser Zug
hatte aber offenbar bedentende Verspätung, denn er war
über Jahr und Tag noch nicht eingetroffen.
Der Beruf zur Kunst schien in Adalberts Geschlecht
prüdestiniert. Denn sein Vater war ein reicher Leinwand-
händler und deshalb zwiefach bestimmt, der Vater eines
Künstlers zu werden. Der Reichtum ermöglichte es, daß
Adalbert ganz seiner Muse leben durfte, was um so be-
quemer war, weil er nicht von ihr leben konnte, und
die Leinwände, welche in den Magazinen seines Vaters
aufgespeichert waren, regten den Jüngling srühzeitig an
und stellten ihm ein schier unermeßliches Feld der Thätigkeit in
Aussicht. Das ganze Quattrocento und Cinquecento
hätte auf diesen Flächen Platz gehabt; warum sollten sie
sich weigern, eine neue Blütezeit der Malerei auf sich
wachsen zu lassen?
Als Adalberts Vater starb, wurde das Geschäft auf-
gegeben, die Waaren verkauft, und nur der ganze Vor-