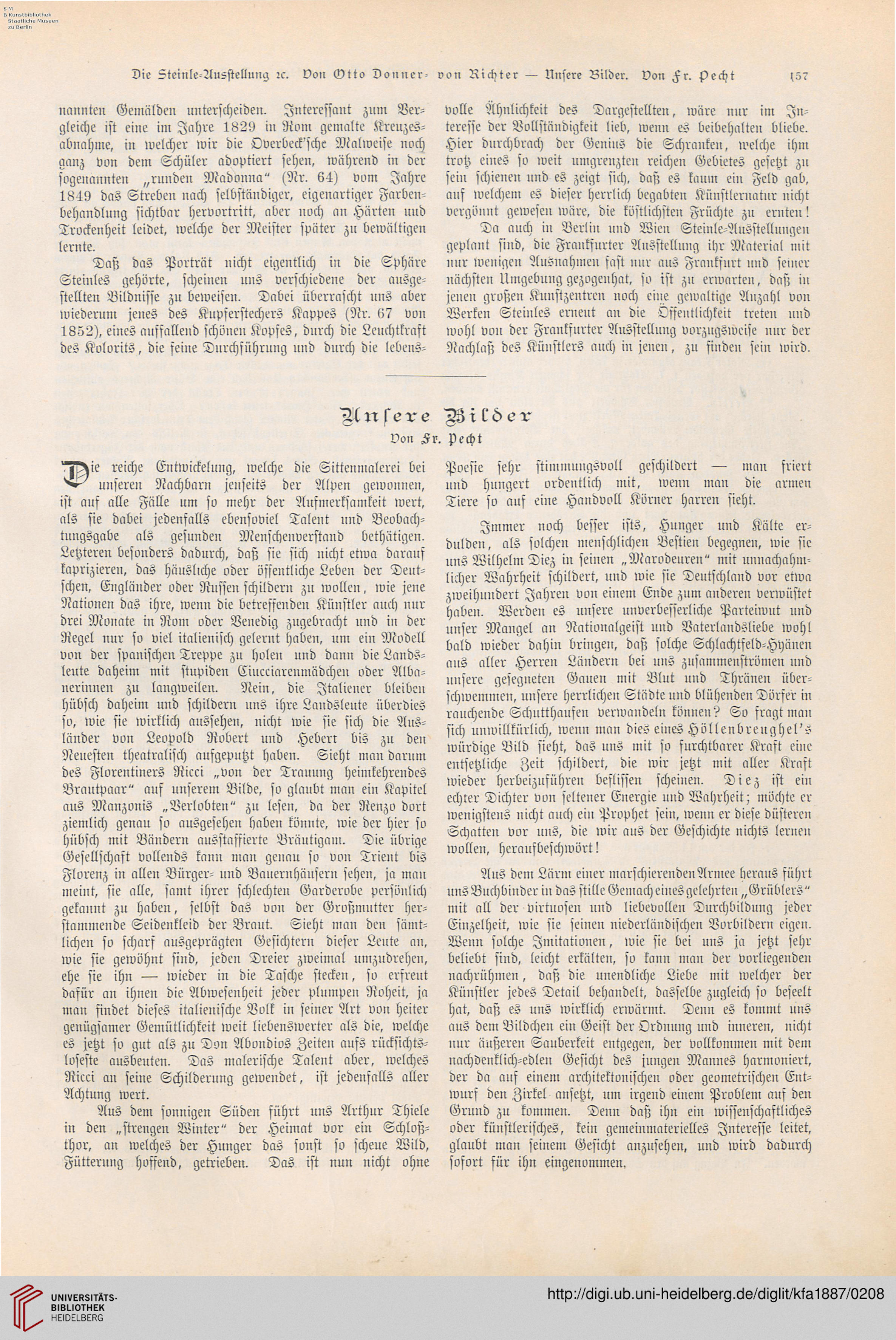Die Zteinle-Ausstellung rc. vou Gtto Douuer- vou Richter — Uusere Bilder. von Fr. pecht
löt
nannten Geniälden unterscheiden. Jnteressant zuni Ver-
gleiche ist eine im Jahre 1829 in Rvm geinalte Kreuzes-
abnahme, in welcher wir die Overbeck'sche Malweise iwch
ganz von dem Schüler adoptiert sehen, während in der
sogenannten „rnnden Madonna" (Nr. 64) vom Jahre
1849 das Streben nach selbständiger, eigenartiger Farben-
behandlnng sichtbar hervortritt, aber noch an Härten nnd
Trockenheit leidet, welche der Meister später zn bewältigen
lernte.
Daß das Porträt nicht eigentlich in die Sphäre
Steinles gehörte, scheinen nns verschiedene der ausge-
stellten Bildnisse zu beweisen. Dabei überrascht nns aber
wiederum jenes des Knpferstechers Kappes (Nr. 67 von
1852), eines anffallend schönen Kopfes, dnrch die Lenchtkraft
des Kolorits, die feine Dnrchführnng nnd dnrch die lebens-
volle Ähnlichkeit des Dargestellten, wäre nnr im Jn-
teresse der Vollständigkeit lieb, wenn es beibehalten bliebe.
Hier dnrchbrach der Genins die Schranken, welche ihm
trotz eines so weit umgrenztcn reichen Gebietes gesel.it zn
sein schienen nnd es zeigt sich, das; es kanm ein Feld gab,
anf welchem es dieser herrlich begabten Künstlernatnr nicht
vcrgönnt gewesen wäre, die köstlichsten Früchte zn ernten!
Da auch in Berlin und Wien Steinle-Ausstellungen
geplant sind, die Franksurter Zlnsstellnng ihr Material mit
nnr wenigcn Ausnahinen fast nnr ans Frankfnrt nnd semer
nächsten Umgebung gezogenhat, so ist zn erwarten, daß in
jenen großen Kunstzentrcn noch cine gewaltige Anzahl von
Werken Steinles ernent an die Osfentlichkeit treten nnd
wohl von der Franksnrter Ansstellnng vorzngswcise nur der
Nachlaß des Künstlers anch in jencn, zu finden sein wird.
Mrrserre Wilsöev
von Lr. pecht
ie reiche Entwickelnng, welche die Sittenmalerei bei
unseren Nachbarn jenseits der Alpen gewonnen,
ist anf alle Fälle nm so mehr der Anfmerksamkeit wert,
als sie dabei jedenfalls ebensoviel Talent nnd Beobach-
tnngsgabe als gesunden Menschenverstand bethätigen.
Letzteren besonders dadurch, daß sie sich nicht etwa daranf
kaprizieren, das hänsliche oder öffentliche Leben der Dent-
schen, Engländer oder Rnssen schildern zn wollen, wie jene
Nativnen das ihre, wenn die betreffenden Künstler anch nnr
drei Monate in Nom oder Venedig zugebracht und in der
Regel nur so viel italienisch gelernt haben, uin ein Modell
von der spanischen Treppe zn holen nnd dann die Lands-
leute daheim mit stupiden Cincciarenmädchen oder Alba-
nerinnen zu langweilen. Nein, die Jtaliener bleiben
hübsch daheim und schildern nns ihre Landsleute überdies
so, wie sie wirklich anssehen, nicht wie sie sich die Ans-
länder von Leopold Robert nnd Heberi bis zu den
Nenesten theatralisch aufgepntzt haben. Sieht nian darnm
des Florentiners Ricci „von der Trauung heimkehrendes
Brautpaar" auf unserem Bilde, so glanbt man ein Kapitel
aus Manzonis „Berlobten" zn lesen, da der Renzo dort
ziemlich genau so ausgesehen haben könnte, wie der hier so
hübsch mit Bändern ausstaffierte Bräutigam. Die übrige
Gesellschaft vollends kann nian genan so von Trient bis
Florenz in allen Bürger- nnd Banernhänsern sehen, ja ninn
nieint, sie alle, samt ihrer schlechten Garderobe pcrsönlich
gekannt zu haben, selbst das von der Großmntter her-
stammeiide Seidenkleid der Braut. Sieht nian dcn sämt-
lichen so scharf ausgeprägten Gesichtern dieser Leute an,
wie fie gewöhnt sind, jeden Dreier zweimal nmzudrehen,
ehe sie ihn — wieder in die Tasche ftecken, so erfrent
dafür an ihnen die Abwesenheit jeder plumpen Roheit, ja
inan stndet dieses italienische Volk in seiner Art von heiter
genügsamer Gemütlichkeit weit liebenswerter als die, welche
es jetzt so gut als zu Don Abondios Zeiten aufs rücksichts-
loseste ausbeuten. Das malerische Talent aber, welches
Ricci an seine Schilderung gewendet, ist jedenfalls aller
Achtung wert.
Aus dem sonnigen Süden führt uns Arthur Thiele
in den „strengen Winter" der Heimat vor ein Schloß-
thor, an welches der Hunger das sonst so scheue Wild,
Fütterung hvffend, getrieben. Das ist nun nicht ohne
Poesie sehr stimmnngsvoll gcschildert — man sriert
nnd hungert ordentlich mit, wenn man die armen
Tiere so anf eine Handvoll Körner harren sieht.
Jmmer noch besser ists, Hunger nnd Kälte er-
dnlden, als solchen menschlichen Bestien begegnen, wie sic
uns Wilhelm Diez in seinen „Marodenren" mit unnachahm-
licher Wahrheit schildert, nnd wie sie Dentschlnnd vor etwa
zweihnndert Jahren von einem Ende znm anderen verwüstet
haben. Werden es unsere nnverbesserliche Parteiwnt und
unser Mangel an Nationalgeist nnd Vaterlandsliebe wohl
bald wieder dahin bringen, daß solche Schlachtfeld-Hyünen
ans aller Herren Lündern bei nns zusammenströmen nnd
nnsere gesegneten Ganen mit Blut nnd Thränen über-
schwemmen, nnsere herrlichen Städtc und blühenden Dörfer in
ranchende Schntthaufen verwandeln können? So fragt man
sich unwillkürlich, wcnn nian dies eines Höllenbrenghel's
würdige Bild sieht, das nns mit so fnrchtbarer Kraft einc
entsetzliche Zeit schildert, die wir jetzt mit aller Krnft
wieder herbeiznführen beflissen scheinen. Diez ist ein
echrer Dichter von seltener Energie und Wahrheit; möchte cr
wenigstens nicht anch ein Prophet sein, wenn er diese düsteren
Schatten vor nns, die wir aus der Geschichte nichts lernen
wollen, heranfbeschwört!
Ans dcm Lärm einer niarschierendenArmee herans führt
iinsBuchbinderindasstilleGcmacheinesgelehrten „Grüblers"
mit all der virtnosen und liebevvllen Durchbildnng jeder
Einzelheit, wie sie seinen iiiederländischen Vorbildern eigen.
Weiin solche Jmitationen, wie sie bei uns ja jetzt sehr
beliebt sind, leicht erkälten, so kann man der vorliegenden
nachrühmen, daß die unendliche Liebe mit welcher der
Künstler jedes Detail behandelt, dasselbe zugleich so beseelt
hat, daß es uns wirklich erwärmt. Denn es kommt nns
aus dem Bildchen ein Geist der Ordnung nnd inneren, nicht
nur ünßeren Sauberkeit entgegen, der vollkomnien mit dem
nachdcnklich-edlen Gesicht des iungen Mannes harmoniert,
der da anf eineni architektonischen oder geometrischen Ent-
wurs den Zirkel ansetzt, nm irgend einem Problem auf den
Grund zu kominen. Denn daß ihn ein wissenschaftliches
oder künstlerisches, kein gemeinniaterielles Jnteresse leitet,
glaubt man seinem Gesicht anznsehen, nnd wird dadurch
sofort für ihn eingenommen,
löt
nannten Geniälden unterscheiden. Jnteressant zuni Ver-
gleiche ist eine im Jahre 1829 in Rvm geinalte Kreuzes-
abnahme, in welcher wir die Overbeck'sche Malweise iwch
ganz von dem Schüler adoptiert sehen, während in der
sogenannten „rnnden Madonna" (Nr. 64) vom Jahre
1849 das Streben nach selbständiger, eigenartiger Farben-
behandlnng sichtbar hervortritt, aber noch an Härten nnd
Trockenheit leidet, welche der Meister später zn bewältigen
lernte.
Daß das Porträt nicht eigentlich in die Sphäre
Steinles gehörte, scheinen nns verschiedene der ausge-
stellten Bildnisse zu beweisen. Dabei überrascht nns aber
wiederum jenes des Knpferstechers Kappes (Nr. 67 von
1852), eines anffallend schönen Kopfes, dnrch die Lenchtkraft
des Kolorits, die feine Dnrchführnng nnd dnrch die lebens-
volle Ähnlichkeit des Dargestellten, wäre nnr im Jn-
teresse der Vollständigkeit lieb, wenn es beibehalten bliebe.
Hier dnrchbrach der Genins die Schranken, welche ihm
trotz eines so weit umgrenztcn reichen Gebietes gesel.it zn
sein schienen nnd es zeigt sich, das; es kanm ein Feld gab,
anf welchem es dieser herrlich begabten Künstlernatnr nicht
vcrgönnt gewesen wäre, die köstlichsten Früchte zn ernten!
Da auch in Berlin und Wien Steinle-Ausstellungen
geplant sind, die Franksurter Zlnsstellnng ihr Material mit
nnr wenigcn Ausnahinen fast nnr ans Frankfnrt nnd semer
nächsten Umgebung gezogenhat, so ist zn erwarten, daß in
jenen großen Kunstzentrcn noch cine gewaltige Anzahl von
Werken Steinles ernent an die Osfentlichkeit treten nnd
wohl von der Franksnrter Ansstellnng vorzngswcise nur der
Nachlaß des Künstlers anch in jencn, zu finden sein wird.
Mrrserre Wilsöev
von Lr. pecht
ie reiche Entwickelnng, welche die Sittenmalerei bei
unseren Nachbarn jenseits der Alpen gewonnen,
ist anf alle Fälle nm so mehr der Anfmerksamkeit wert,
als sie dabei jedenfalls ebensoviel Talent nnd Beobach-
tnngsgabe als gesunden Menschenverstand bethätigen.
Letzteren besonders dadurch, daß sie sich nicht etwa daranf
kaprizieren, das hänsliche oder öffentliche Leben der Dent-
schen, Engländer oder Rnssen schildern zn wollen, wie jene
Nativnen das ihre, wenn die betreffenden Künstler anch nnr
drei Monate in Nom oder Venedig zugebracht und in der
Regel nur so viel italienisch gelernt haben, uin ein Modell
von der spanischen Treppe zn holen nnd dann die Lands-
leute daheim mit stupiden Cincciarenmädchen oder Alba-
nerinnen zu langweilen. Nein, die Jtaliener bleiben
hübsch daheim und schildern nns ihre Landsleute überdies
so, wie sie wirklich anssehen, nicht wie sie sich die Ans-
länder von Leopold Robert nnd Heberi bis zu den
Nenesten theatralisch aufgepntzt haben. Sieht nian darnm
des Florentiners Ricci „von der Trauung heimkehrendes
Brautpaar" auf unserem Bilde, so glanbt man ein Kapitel
aus Manzonis „Berlobten" zn lesen, da der Renzo dort
ziemlich genau so ausgesehen haben könnte, wie der hier so
hübsch mit Bändern ausstaffierte Bräutigam. Die übrige
Gesellschaft vollends kann nian genan so von Trient bis
Florenz in allen Bürger- nnd Banernhänsern sehen, ja ninn
nieint, sie alle, samt ihrer schlechten Garderobe pcrsönlich
gekannt zu haben, selbst das von der Großmntter her-
stammeiide Seidenkleid der Braut. Sieht nian dcn sämt-
lichen so scharf ausgeprägten Gesichtern dieser Leute an,
wie fie gewöhnt sind, jeden Dreier zweimal nmzudrehen,
ehe sie ihn — wieder in die Tasche ftecken, so erfrent
dafür an ihnen die Abwesenheit jeder plumpen Roheit, ja
inan stndet dieses italienische Volk in seiner Art von heiter
genügsamer Gemütlichkeit weit liebenswerter als die, welche
es jetzt so gut als zu Don Abondios Zeiten aufs rücksichts-
loseste ausbeuten. Das malerische Talent aber, welches
Ricci an seine Schilderung gewendet, ist jedenfalls aller
Achtung wert.
Aus dem sonnigen Süden führt uns Arthur Thiele
in den „strengen Winter" der Heimat vor ein Schloß-
thor, an welches der Hunger das sonst so scheue Wild,
Fütterung hvffend, getrieben. Das ist nun nicht ohne
Poesie sehr stimmnngsvoll gcschildert — man sriert
nnd hungert ordentlich mit, wenn man die armen
Tiere so anf eine Handvoll Körner harren sieht.
Jmmer noch besser ists, Hunger nnd Kälte er-
dnlden, als solchen menschlichen Bestien begegnen, wie sic
uns Wilhelm Diez in seinen „Marodenren" mit unnachahm-
licher Wahrheit schildert, nnd wie sie Dentschlnnd vor etwa
zweihnndert Jahren von einem Ende znm anderen verwüstet
haben. Werden es unsere nnverbesserliche Parteiwnt und
unser Mangel an Nationalgeist nnd Vaterlandsliebe wohl
bald wieder dahin bringen, daß solche Schlachtfeld-Hyünen
ans aller Herren Lündern bei nns zusammenströmen nnd
nnsere gesegneten Ganen mit Blut nnd Thränen über-
schwemmen, nnsere herrlichen Städtc und blühenden Dörfer in
ranchende Schntthaufen verwandeln können? So fragt man
sich unwillkürlich, wcnn nian dies eines Höllenbrenghel's
würdige Bild sieht, das nns mit so fnrchtbarer Kraft einc
entsetzliche Zeit schildert, die wir jetzt mit aller Krnft
wieder herbeiznführen beflissen scheinen. Diez ist ein
echrer Dichter von seltener Energie und Wahrheit; möchte cr
wenigstens nicht anch ein Prophet sein, wenn er diese düsteren
Schatten vor nns, die wir aus der Geschichte nichts lernen
wollen, heranfbeschwört!
Ans dcm Lärm einer niarschierendenArmee herans führt
iinsBuchbinderindasstilleGcmacheinesgelehrten „Grüblers"
mit all der virtnosen und liebevvllen Durchbildnng jeder
Einzelheit, wie sie seinen iiiederländischen Vorbildern eigen.
Weiin solche Jmitationen, wie sie bei uns ja jetzt sehr
beliebt sind, leicht erkälten, so kann man der vorliegenden
nachrühmen, daß die unendliche Liebe mit welcher der
Künstler jedes Detail behandelt, dasselbe zugleich so beseelt
hat, daß es uns wirklich erwärmt. Denn es kommt nns
aus dem Bildchen ein Geist der Ordnung nnd inneren, nicht
nur ünßeren Sauberkeit entgegen, der vollkomnien mit dem
nachdcnklich-edlen Gesicht des iungen Mannes harmoniert,
der da anf eineni architektonischen oder geometrischen Ent-
wurs den Zirkel ansetzt, nm irgend einem Problem auf den
Grund zu kominen. Denn daß ihn ein wissenschaftliches
oder künstlerisches, kein gemeinniaterielles Jnteresse leitet,
glaubt man seinem Gesicht anznsehen, nnd wird dadurch
sofort für ihn eingenommen,