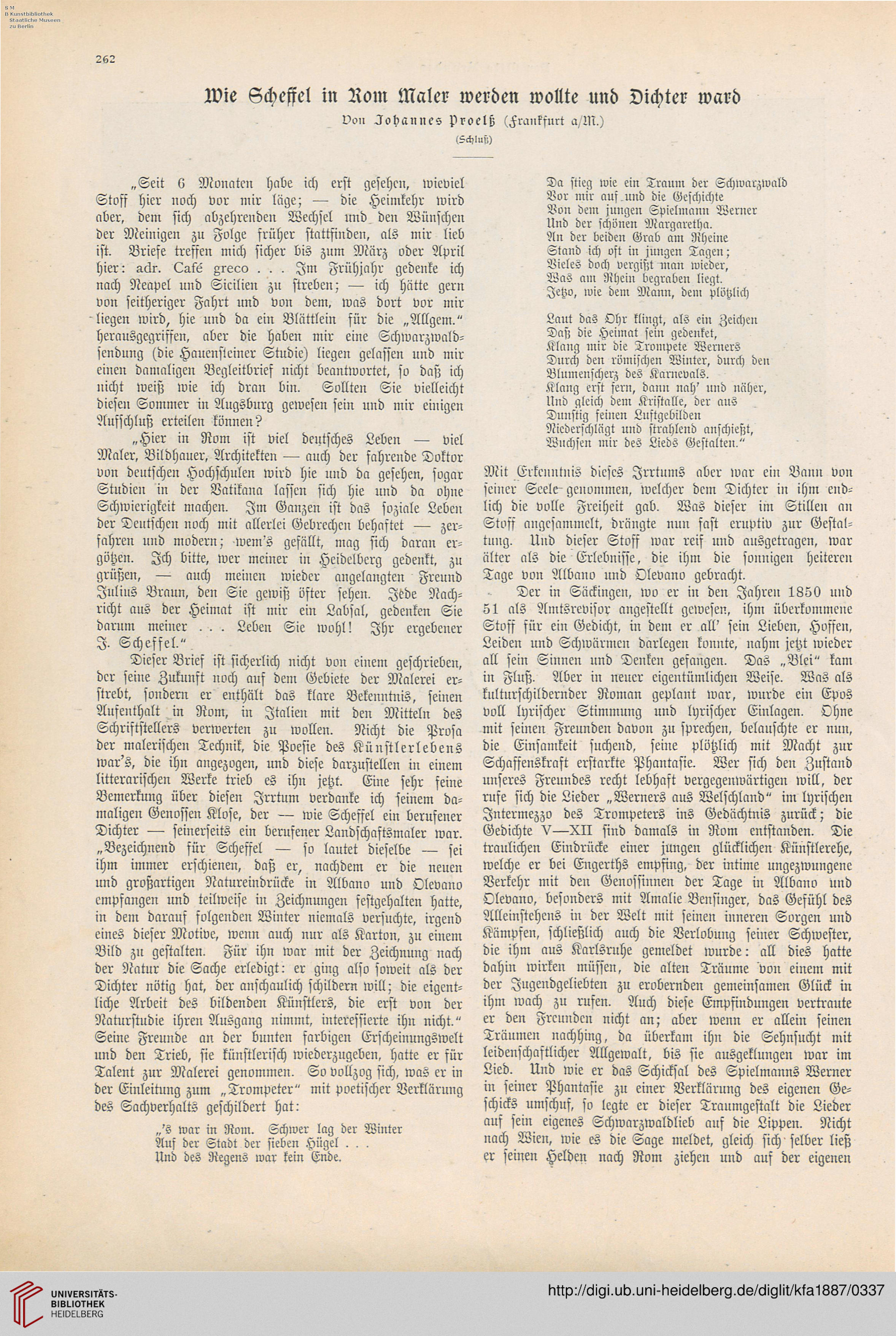262
wie Scheffel in Rom Maler werden wollte nnd Dichter ward
voii Iobamics proclb (Frankfurt a/m.)
ISchlus!)
„Seit 6 Monciten hnbe ich erst gesehcn, wieviel
Stoff hier noch vor mir läge; — die Heimkehr wird
ciber, dem sich obzehrenden Wechscl nnd den Wünschen
der Bkeinigen zu Folge srüher stattfinden, als mir lieb
ist. Briefe treffen mich sicher bis znm März oder April
hier: aclr. Lufe greco . . . Jm Frühjahr gedenke ich
nach Neapel und Sicilien zu streben; — ich hätte gern
von seitheriger Fahrt und von dem, was dort vor mir
liegen wird, hie und da ein Blättlein für die „Allgcm."
herausgegriffen, aber die haben mir eine Schwarzwald-
scndung (die Haucnsteiner Studie) licgen gelassen und mir
einen damaligen Begleitbrief nicht beantwortet, so daß ich
nicht weiß wie ich dran bin. Sollten Sie vielleicht
diesen Somnier in Augsburg gewesen sein und mir einigen
Aufschluß erteilen können?
„Hier in Rom ist viel dentsches Leben — viel
Maler, Bildhauer, Architekten — anch dcr fahrcnde Doktor
von deutschen Hochschulen wird hie und da gesehen, svgar
Studien in der Vatikana lassen sich hie und da ohne
Schwicrigkeit niachen. Jm Ganzen ist das soziale Leben
der Dentschen noch mit allerlei Gebrechcn behaftet — zer-
fahren und modern; wenrs gefällt, mag sich daran er-
götzen. Jch bitte, wcr meiner in Hcidelberg gedenkt, zu
grüßen, — auch meinen wiedcr angelangten Freund
Julins Braun, den Sie gewiß öfter sehen. Jede Nach-
richt aus der Heimat ist mir ein Labsal, gedenken Sie
darnm meiner . . . Leben Sie wohl! Jhr ergebener
I. Scheffel."
Dieser Brief ist sicherlich nicht von einem geschrieben,
dcr seine Zukunft noch auf dem Gebiete der Malerei er-
strebt, sondern er enthält das klare Bekenntnis, seinen
Aufenthalt in Roni, in Jtalien mit den Mitteln des
Schriftstellers verwerten zu wollen. Nicht die Prosa
der malerischen Technik, die Poesie des Künstlerlebens
war's, die ihn angezogen, und diese darzustellen in einem
litterarischen Werke trieb es ihn jetzt. Eine sehr feine
Bemerkung über diesen Jrrtuni verdanke ich seinem da-
maligen Genossen Klose, der — wie Scheffel ein berufener
Dichter — seinerseits ein berufener Landschaftsmaler war.
„Bezeichnend für Scheffel — so lautet dieselbe — sei
ihm immer erschienen, daß er, nachdem er die neuen
und großartigen Natureindrücke in Albano und Olevano
empfangen nnd teilweise in Zeichnungen festgehalten hatte,
in dem daranf folgenden Winter niemals versuchte, irgend
eines dieser Motive, wenn auch nur als Karton, zu einem
Bild zu gestalten. Für ihn war mit der Zeichnung nach
der Natur die Sache erledigt: er ging also soweit als der
Dichter nötig hat, der anschaulich schildern will; die eigent-
liche Arbeit des bildenden Künstlers, die erst von der
Naturstudie ihren Ausgang nimmt, interessierte ihn nicht."
Seine Freunde an der bunten farbigen Erscheinungswelt
und den Trieb, sie künstlerisch wiederzugeben, hatte er für
Talent zur Malerei genommen. So vollzog sich, was er in
der Einleitung zum „Trompeter" mit poetischer Verklärung
des Sachverhalts geschildert hat:
„'s war in Rom. Schwer lag der Winter
Auf der Stadt der sieben Hügel . . .
lknd des Regens war kein Ende.
Da stieg wie ein Traimi der Schwarzwald
Vor mir aufmnd die Geschichte
Von dem jungen Spielinann Werner
Und der schönen Margaretha.
?ln der beiden Grab am Rheine
Stand ich oft in jungen Tagen;
Bieles doch vergisst inan wieder,
Was am Rhein begraben liegt.
Jetzo, wie dem Mann, dem plötzlich
Laui das Ohr klingt, als ein Zeichen
Daß die Heünat sein gedenket,
Klang inir die Trompete Werners
Durch den röinischen Winter, durch den
Bluinenscherz des Karncvals.
Klang erst sern, dann nah' nnd näher,
Und gleich dem Kristalle, der aus
Dnnstig feinen Luftgebilden
Niederschlägt und strahlend anschießt,
Wnchsen inir des Lieds Gestalten."
Mit Erkcnntnis dicscs Jrrtums aber war ein Baiin Vvn
seiner Seele-gcnvmmen, welcher dcm Dichter in ihm end-
lich die vvlle Freiheit gab. Was dieser im Stillen an
Stvff angcsammelt, drängte nun fast eruptiv zur Gestal-
tung. Und dieser Stoff war reif nnd ausgetragen, war
älter als die Erlebnisse, die ihm die sonnigen heiteren
Tage von Albano und Olevano gebracht.
Der in Säckingen, wo er in den Jahren 1850 nnd
51 als Amtsrevisor angestellt gewesen, ihm überkommene
Stoff für ein Gedicht, in dem er all' sein Lieben, Hoffen,
Leiden und Schwärmcn darlegen konnte, nahm jetzt wieder
all sein Siniien nnd Denken gefangen. Das „Blei" kam
in Fluß. Aber in neuer eigentümlichen Weise. Was als
kulturschildernder Roman geplant war, wurde ein Epos
voll lyrischer Stimmung und lyrischer Einlagen. Ohne
mit seinen Freunden davon zu sprechen, belauschte er nun,
die Einsamkeit suchend, seine plötzlich mit Macht zur
Schaffenskraft erstarkte Phantasie. Wer sich den Zustand
unseres Freundes recht lebhaft vergegenwärtigen will, der
rufe sich die Lieder „Werners aus Welschland" im lyrischen
Jntermezzo des Trompeters ins Gedüchtnis zurück; die
Gedichte V—XII sind damals in Rom entstanden. Die
traulichen Eindrücke einer jnngen glücklichen Künstlerehe,
welche er bei Engerths empfing, der intime ungezwungene
Verkehr mit den Genossinnen der Tage in Albano nnd
Olevano, besonders mit Amalie Bensinger, das Gefühl des
Alleinstchens in der Welt mit seinen inneren Sorgen und
Kämpfen, schließlich auch die Verlobung seiner Schwester,
die ihm aus Karlsruhe gemeldet wurde: all dies hatte
dahin wirken niüssen, die alten Träume von einem mit
der Jugendgeliebten zu erobernden gemeinsamen Glück in
ihm wach zn rufen. Auch diese Empfindungen vertraute
er den Frcundcn nicht an; aber wenn er allein seinen
Träumen nachhing, da überkam ihn die Sehnsucht mit
leidenschaftlicher Allgewalt, bis sie ausgeklungen war im
Lied. Und wie er das Schicksal des Spielmanns Werner
in seiner Phantcrsie zu einer Verklärung des eigenen Ge-
schicks umschuf, so lcgte er dieser Traumgestalt die Lieder
auf sein eigenes Schwarzwaldlieb auf die Lippen. Nicht
nach Wien, wie es die Sage meldet, gleich sich selber ließ
er seinen Helden nach Rom ziehen und auf der eigenen