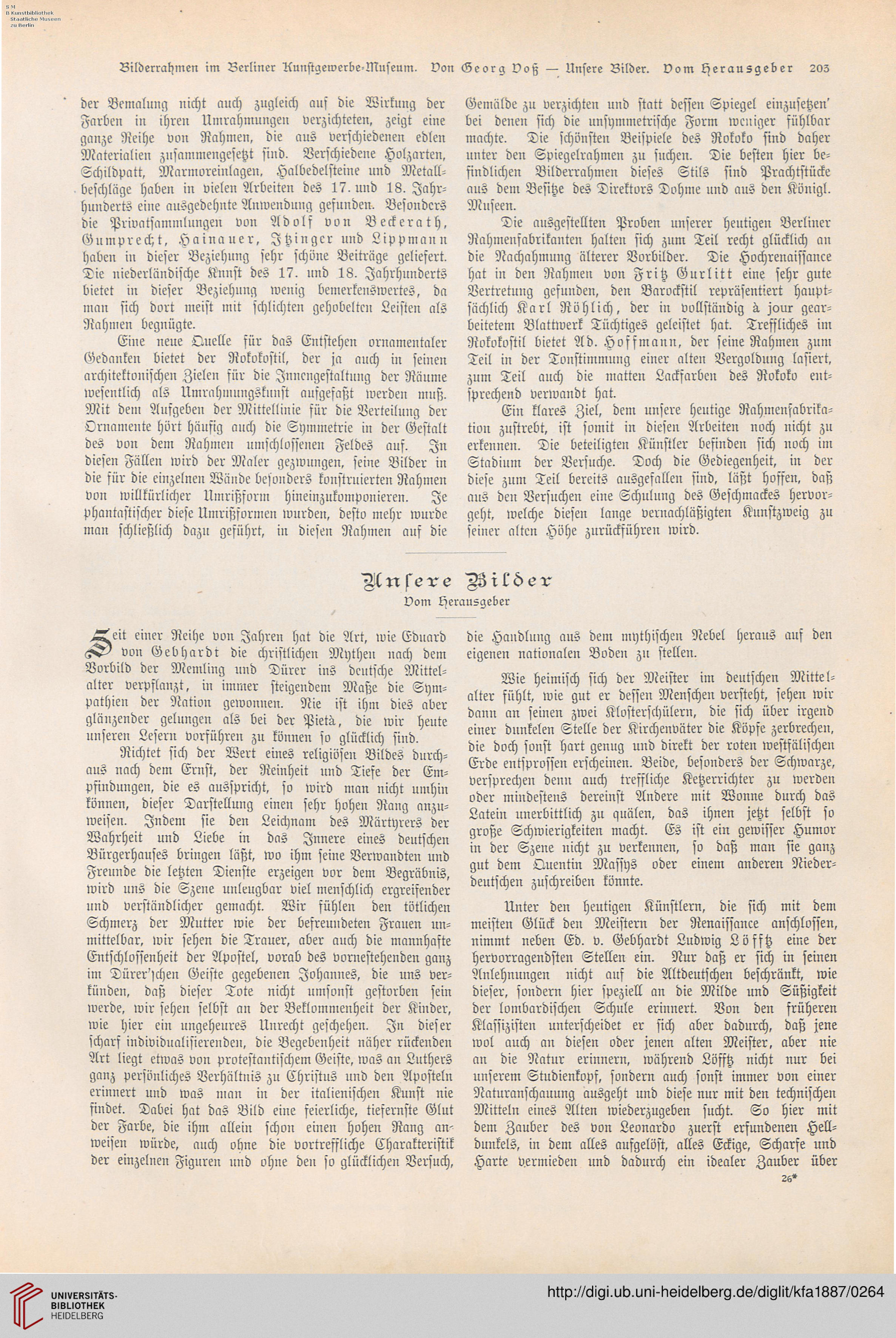Bilderrahmen im Berliner Amistgewerbe-Nuseum. von Georg voß — Unsere Bilder. vom Lserausgeber 20s
der Bemalung nicht auch zugleich aus die Wirkung der
Farben iu ihren Umrahmungeu verzichteten, zeigt eine
ganze Reihe von Rahmen, die aus verschiedenen edlen
Materialien zusanimengesetzt sind. Verschiedene Holzarten,
Schildpatt, Marmoreinlagen, Halbedelsteine und Metall-
beschläge haben in vielen Arbeiten des 17.und 18. Jahr-
hunderts eine ausgedehnte illnwendung gefunden. Besondcrs
die Privatsammlungen von Adolf von Beckerath,
Gumprecht, Hainauer, Jtzinger und Lippmaun
haben in dieser Beziehung sehr schiine Beiträge geliefert.
Die niederländische Knnst des 17. und 18. Jahrhunderts
bietet iu dieser Beziehung wenig bemerkenswertes, da
man sich dort meist mit schlichten gehobeltcn Leisten als
Rahmen begnügte.
Eine neue Quelle für das Entstehen ornamentaler
Gedanken bietet der Rokokostil, der ja auch in seinen
architektonischen Zielen für die Jnneugestaltung der Räume
wesentlich als Unirahmungskuust aufgefaßt werdeu muß.
Mit dem Aufgebeu der Mittelliuie sür die Verteilung der
Ornamente hört häufig auch die Symmetrie iu der Gestalt
des von dem Rahnien iimschlosseneii Feldes auf. Jn
diesen Fällen wird der Maler gezwungen, seine Bilder in
die für die einzelnen Wände besouders konstruierteu Rahmen
von willkürlicher Umrißform hineinzukvmponieren. Je
phantastischer diese Umrißformen wurden, desto mehr wurde
man schließlich dazu geführt, iu diesen Rahmen auf die
Gemütde zu verzichten und statt dessen Spiegel einzusetzen'
bei deuen sich die unsymmetrische Form wcuiger sühlbar
machte. Die schönsten Beispiele des Rokoko sind daher
unter den Spiegelrahmen zu suchen. Die besten hier be-
findlichen Bilderrahmen dieses Stils sind Prachtstücke
aus dem Besitze des Direktors Dohme und aus den Königl.
Museen.
Die ausgestellten Proben unserer heutigen Berliner
Rahmenfabrikanten halten sich zum Teil recht glücklich an
die Nachahmung älterer Vorbilder. Die Hochrenaissance
hat in den Rahmen von Fritz Gurlitt eine sehr gute
Vertretuug gefunden, den Barockstil repräsentiert haupt-
sächlich Karl Röhlich, der in vollständig ä. jour gear-
beitetem Blattwerk Tüchtiges geleistet hat. Treffliches im
Rokokostil bietet Ad. Hoffmann, der seine Rahmen zum
Teil in der Toustiinmung einer alten Vergoldung lasiert,
zum Teil auch die matten Lackfarbcn des Rokoko ent-
sprechend verwandt hat.
Ein klares Ziel, dem unsere heutige Rahmensabrika-
tion zustrebt, ist somit in diesen Arbeiten noch nicht zu
erkennen. Die beteiligten Künstler befinden sich noch im
Stadium der Versuche. Doch die Gediegenheit, in der
diese zum Teil bereits ausgefallen sind, läßt hoffen, daß
aus deu Versucheu eiue Schulung des Geschmackes hervor-
geht, welche diesen lange vernachläßigten Kunstzweig zu
seiuer altcn Höhe zurückführen wird.
WnseTte WiLöerr
vom kserausgeber
^eit eiuer Reihe von Jahren hat die Art, wie Eduard
vou Gebhardt die christlicheu Mytheu nach dem
Vorbild der Memling und Dürer ins dcutsche Mittel-
alter verpflauzt, in immer steigendem Maße die Sym-
pathien der Nation gewonnen. Nie ist ihm dies aber
glänzender gelungen als bei der Pieta, die wir heute
unseren Lesern vorführen zu können so glücklich sind.
Richtet sich der Wert eines religiösen Bildes durch-
aus nach dem Ernst, der Reinheit und Tiefe der Em-
pfindungen, die es ausspricht, so wird man nicht unihin
können, dieser Darstellung einen sehr hohen Rang anzu-
weisen. Jndem sie den Leichnam des Märtyrers der
Wahrheit und Liebe in das Jnnere eines deutschen
Bürgerhauses briugen läßt, wo ihm seine Verwandten und
Freunde die letzten Dienste erzeigen vor dem Begräbnis,
wird uns die Szene unleugbar viel menschlich ergreifender
und verständlicher gemacht. Wir fühlen den tötlichen
Schmerz der Mutter wie der befreuudeten Frauen un-
mittelbar, wir sehen die Trauer, aber auch die mannhaste
Entschlossenheit der Apostel, vorab des vornestehenden ganz
im Dürer'ichen Geiste gegebenen Johannes, die uns ver-
künden, daß dieser Tote nicht nmsonst gestorben sein
werde, wir sehen selbst an der Beklommenheit der Kinder,
wie hier ein ungeheures Unrecht geschehen. Jn dieser
scharf individualisierenden, die Begebenheit nüher rückenden
Art liegt etwas von protestantischem Geiste, was an Luthers
ganz persönliches Verhältnis zu Christus und den Aposteln
erinnert und was man in der italienischen Kunst nie
findet. Dabei hat das Bild eine feierliche, tiefernste Glut
der Farbe, die ihm allein schon einen hohen Rang an-
weisen würde, auch obne die vortreffliche Charakteristik
der einzelnen Figuren nnd ohne den so glücklichen Versuch,
die Handluug aus dem mythischen Nebel heraus auf den
eigenen nationalen Boden zn stellen.
Wie heimisch sich der Meister im deutschen Mittel-
alter fühlt, wie gut er dessen Menschen versteht, sehen wir
dann an seinen zwei Klosterschülern, die sich über irgend
einer dunkelen Stelle der Kirchenväter die Köpfe zerbrechen,
die doch sonst hart genug und direkt der roten westfälischen
Erde entsprossen erscheinen. Beide, besonders der Schwarze,
versprechen denn auch treffliche Ketzerrichter zu werden
oder mindestens dereinst Andere mit Wonne durch das
Latein unerbittlich zu quälen, das ihnen jetzt selbst so
große Schwierigkeiten macht. Es ist ein gewisser Humor
in der Szene nicht zu verkennen, so daß man sie ganz
gut dem Quentin Massys oder einem anderen Nieder-
deutschen zuschreiben könnte.
Unter den heutigen Künstlern, die sich mit dem
meisten Glück den Meistern der Renaissance anschlossen,
nimmt neben Ed. v. Gebhardt Ludwig Lö fftz eine der
hervorragendsten Stellen ein. Nur daß er sich in seinen
Anlehnungen nicht auf die Altdeutschen beschränkt, wie
dieser, sondern hier speziell an die Milde und Süßigkeit
der lombardischen Schule erinnert. Von den früheren
Klassizisten unterscheidel er sich aber dadurch, daß jene
wol auch an diesen oder jenen alten Meister, aber nie
an die Natur erinnern, während Löfftz nicht nur bei
unserem Studienkopf, sondern auch sonst immer von einer
Naturanschauung ausgeht und diese nur mit den technischen
Mitteln eines Alten wiederzugeben sucht. So hier mit
dem Zauber des von Leonardo zuerst erfundenen Hell-
dunkels, in dem alles aufgelöst, alles Eckige, Scharfe und
Harte vermieden und dadurch ein idealer Zauber über
der Bemalung nicht auch zugleich aus die Wirkung der
Farben iu ihren Umrahmungeu verzichteten, zeigt eine
ganze Reihe von Rahmen, die aus verschiedenen edlen
Materialien zusanimengesetzt sind. Verschiedene Holzarten,
Schildpatt, Marmoreinlagen, Halbedelsteine und Metall-
beschläge haben in vielen Arbeiten des 17.und 18. Jahr-
hunderts eine ausgedehnte illnwendung gefunden. Besondcrs
die Privatsammlungen von Adolf von Beckerath,
Gumprecht, Hainauer, Jtzinger und Lippmaun
haben in dieser Beziehung sehr schiine Beiträge geliefert.
Die niederländische Knnst des 17. und 18. Jahrhunderts
bietet iu dieser Beziehung wenig bemerkenswertes, da
man sich dort meist mit schlichten gehobeltcn Leisten als
Rahmen begnügte.
Eine neue Quelle für das Entstehen ornamentaler
Gedanken bietet der Rokokostil, der ja auch in seinen
architektonischen Zielen für die Jnneugestaltung der Räume
wesentlich als Unirahmungskuust aufgefaßt werdeu muß.
Mit dem Aufgebeu der Mittelliuie sür die Verteilung der
Ornamente hört häufig auch die Symmetrie iu der Gestalt
des von dem Rahnien iimschlosseneii Feldes auf. Jn
diesen Fällen wird der Maler gezwungen, seine Bilder in
die für die einzelnen Wände besouders konstruierteu Rahmen
von willkürlicher Umrißform hineinzukvmponieren. Je
phantastischer diese Umrißformen wurden, desto mehr wurde
man schließlich dazu geführt, iu diesen Rahmen auf die
Gemütde zu verzichten und statt dessen Spiegel einzusetzen'
bei deuen sich die unsymmetrische Form wcuiger sühlbar
machte. Die schönsten Beispiele des Rokoko sind daher
unter den Spiegelrahmen zu suchen. Die besten hier be-
findlichen Bilderrahmen dieses Stils sind Prachtstücke
aus dem Besitze des Direktors Dohme und aus den Königl.
Museen.
Die ausgestellten Proben unserer heutigen Berliner
Rahmenfabrikanten halten sich zum Teil recht glücklich an
die Nachahmung älterer Vorbilder. Die Hochrenaissance
hat in den Rahmen von Fritz Gurlitt eine sehr gute
Vertretuug gefunden, den Barockstil repräsentiert haupt-
sächlich Karl Röhlich, der in vollständig ä. jour gear-
beitetem Blattwerk Tüchtiges geleistet hat. Treffliches im
Rokokostil bietet Ad. Hoffmann, der seine Rahmen zum
Teil in der Toustiinmung einer alten Vergoldung lasiert,
zum Teil auch die matten Lackfarbcn des Rokoko ent-
sprechend verwandt hat.
Ein klares Ziel, dem unsere heutige Rahmensabrika-
tion zustrebt, ist somit in diesen Arbeiten noch nicht zu
erkennen. Die beteiligten Künstler befinden sich noch im
Stadium der Versuche. Doch die Gediegenheit, in der
diese zum Teil bereits ausgefallen sind, läßt hoffen, daß
aus deu Versucheu eiue Schulung des Geschmackes hervor-
geht, welche diesen lange vernachläßigten Kunstzweig zu
seiuer altcn Höhe zurückführen wird.
WnseTte WiLöerr
vom kserausgeber
^eit eiuer Reihe von Jahren hat die Art, wie Eduard
vou Gebhardt die christlicheu Mytheu nach dem
Vorbild der Memling und Dürer ins dcutsche Mittel-
alter verpflauzt, in immer steigendem Maße die Sym-
pathien der Nation gewonnen. Nie ist ihm dies aber
glänzender gelungen als bei der Pieta, die wir heute
unseren Lesern vorführen zu können so glücklich sind.
Richtet sich der Wert eines religiösen Bildes durch-
aus nach dem Ernst, der Reinheit und Tiefe der Em-
pfindungen, die es ausspricht, so wird man nicht unihin
können, dieser Darstellung einen sehr hohen Rang anzu-
weisen. Jndem sie den Leichnam des Märtyrers der
Wahrheit und Liebe in das Jnnere eines deutschen
Bürgerhauses briugen läßt, wo ihm seine Verwandten und
Freunde die letzten Dienste erzeigen vor dem Begräbnis,
wird uns die Szene unleugbar viel menschlich ergreifender
und verständlicher gemacht. Wir fühlen den tötlichen
Schmerz der Mutter wie der befreuudeten Frauen un-
mittelbar, wir sehen die Trauer, aber auch die mannhaste
Entschlossenheit der Apostel, vorab des vornestehenden ganz
im Dürer'ichen Geiste gegebenen Johannes, die uns ver-
künden, daß dieser Tote nicht nmsonst gestorben sein
werde, wir sehen selbst an der Beklommenheit der Kinder,
wie hier ein ungeheures Unrecht geschehen. Jn dieser
scharf individualisierenden, die Begebenheit nüher rückenden
Art liegt etwas von protestantischem Geiste, was an Luthers
ganz persönliches Verhältnis zu Christus und den Aposteln
erinnert und was man in der italienischen Kunst nie
findet. Dabei hat das Bild eine feierliche, tiefernste Glut
der Farbe, die ihm allein schon einen hohen Rang an-
weisen würde, auch obne die vortreffliche Charakteristik
der einzelnen Figuren nnd ohne den so glücklichen Versuch,
die Handluug aus dem mythischen Nebel heraus auf den
eigenen nationalen Boden zn stellen.
Wie heimisch sich der Meister im deutschen Mittel-
alter fühlt, wie gut er dessen Menschen versteht, sehen wir
dann an seinen zwei Klosterschülern, die sich über irgend
einer dunkelen Stelle der Kirchenväter die Köpfe zerbrechen,
die doch sonst hart genug und direkt der roten westfälischen
Erde entsprossen erscheinen. Beide, besonders der Schwarze,
versprechen denn auch treffliche Ketzerrichter zu werden
oder mindestens dereinst Andere mit Wonne durch das
Latein unerbittlich zu quälen, das ihnen jetzt selbst so
große Schwierigkeiten macht. Es ist ein gewisser Humor
in der Szene nicht zu verkennen, so daß man sie ganz
gut dem Quentin Massys oder einem anderen Nieder-
deutschen zuschreiben könnte.
Unter den heutigen Künstlern, die sich mit dem
meisten Glück den Meistern der Renaissance anschlossen,
nimmt neben Ed. v. Gebhardt Ludwig Lö fftz eine der
hervorragendsten Stellen ein. Nur daß er sich in seinen
Anlehnungen nicht auf die Altdeutschen beschränkt, wie
dieser, sondern hier speziell an die Milde und Süßigkeit
der lombardischen Schule erinnert. Von den früheren
Klassizisten unterscheidel er sich aber dadurch, daß jene
wol auch an diesen oder jenen alten Meister, aber nie
an die Natur erinnern, während Löfftz nicht nur bei
unserem Studienkopf, sondern auch sonst immer von einer
Naturanschauung ausgeht und diese nur mit den technischen
Mitteln eines Alten wiederzugeben sucht. So hier mit
dem Zauber des von Leonardo zuerst erfundenen Hell-
dunkels, in dem alles aufgelöst, alles Eckige, Scharfe und
Harte vermieden und dadurch ein idealer Zauber über