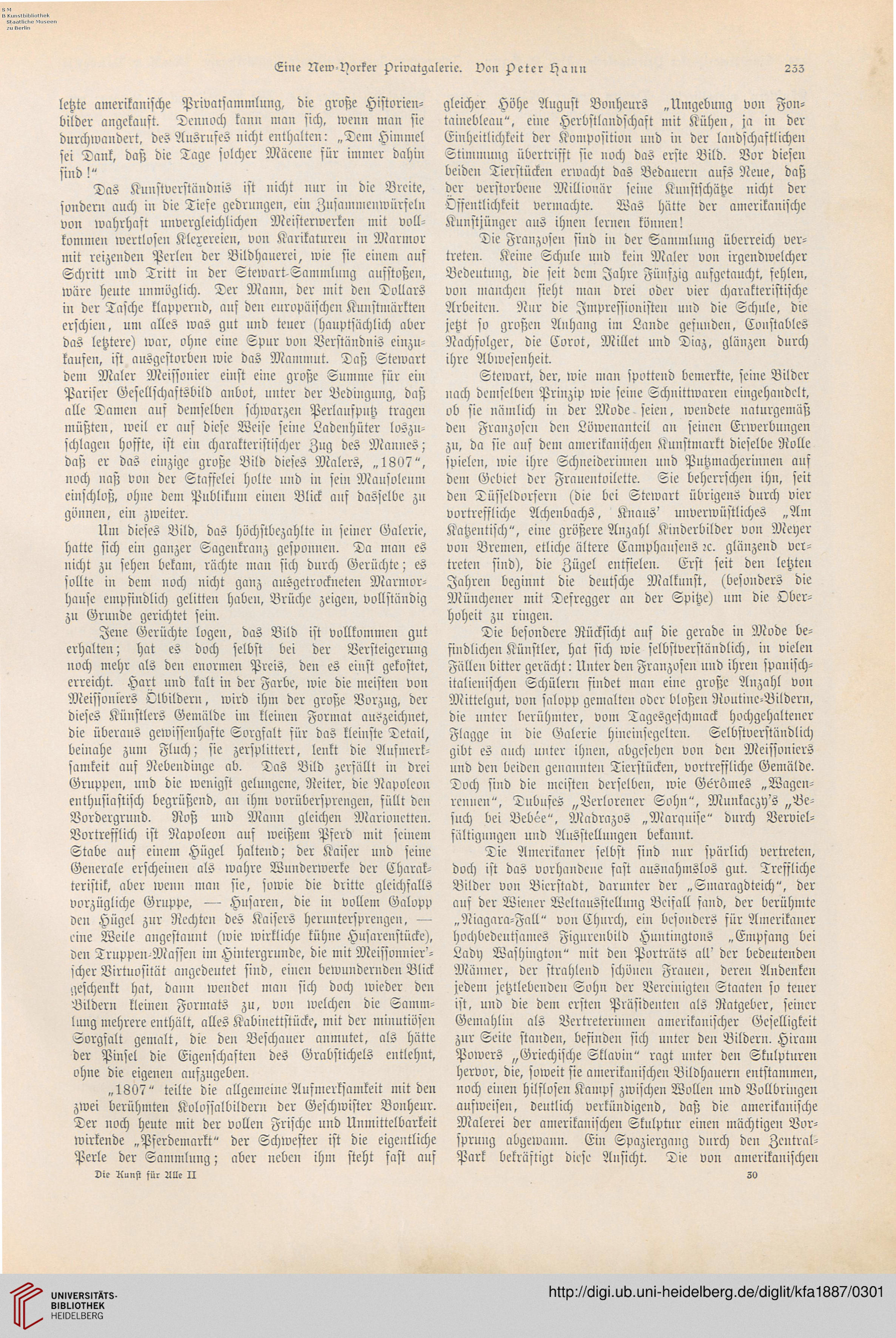Line NewMorker Privatgalerie. Oon j)eter Hann
25Z
letzte amerikanische Privatsammlung, die große Historien-
bilder angekauft. Dennoch kann man sich, wenn man sie
durchwandert, des Ausrufes nicht enthalten: „Dcm Himmel
sei Dank, daß die Tage solcher Mäcene für immer dahin
sind!"
Das Kunstverständnis ist nicht nur in die Breite,
sondern auch in die Tiefe gedrnngen, ein Zusammcnwnrfeln
von wahrhaft unvergleichlichen Meisterwerken mit voll-
kommen wertlosen Klexereien, von Karikaturen in Marmor
mit reizenden Perlen der Bildhauerei, wie sie einem auf
Schritt und Tritt in der Stewart.Sammlnng aufstoßen,
wäre heute unmvglich. Der Mann, der mit den Tollars
in der Tasche klappernd, anf den enropäischen Kunstmärkten
erschien, uni alles was gut und teuer (hauptsüchlich aber
das letztere) war, ohne eine Spur vou Verständnis einzu-
kaufen, ist ausgcstorben wie das Mammut. Daß Stewart
deni Maler Meissonier einst eine große Summe sür ein
Pariser Gesellschastsbild anbot, unter der Bedingnng, daß
alle Damen auf demselbcn schwarzen Perlaufpntz tragen
müßten, weil er auf dicse Weise seine Ladcnhüter loszu-
schlagen hoffte, ist eiu charakteristischer Zug des Maunes;
daß er das einzigc große Bild dieses Malers, „1807",
noch naß von der Staffelei holte und in sein Mausoleum
einschloß, ohne dem Publikum eineu Blick auf dasselbe zu
gvnnen, ein zweiter.
Um dieses Bild, das hvchstbezahlte in seiner Galerie,
hatte sich ein ganzer Sagenkranz gesponnen. Da man es
nicht zu sehen bekam, rächte man sich durch Gerüchte; es
sollte in dem noch nicht ganz ausgetrockneten Marnior-
hanse empfindlich gelitten haben, Brüche zeigen, vollständig
zu Grunde gerichtet sein.
Jene Gerüchte logen, das Bild ist vollkommen gut
erhalten; hat es doch selbst bei der Versteigerung
noch mehr als den enormen Preis, den es einst gekostet,
erreicht. Hart und kalt in der Farbe, wie die nieisten von
Meissoniers Olbildern, wird ihm der große Vorzug, der
dieses Künstlers Gemälde im kleinen Format auszeichnet,
die überans gewissenhafte Sorgfalt für das kleinste Tetail,
beinahe zum Fluch; sie zersplittert, lenkt die Aufmerk-
samkeit auf Nebendinge ab. Das Bild zerfüllt in drei
Gruppen, und die wenigst gelungcne, Reiter, die Napoleon
enthusiastisch begrüßcnd, an ihm vorübersprengen, füllt den
Vordergrund. Roß und Mann gleichen Marionetten.
Vortrefflich ist Stapoleon auf weißem Pferd mit seineni
Stabe auf einem Hügel haltend; der Kaiser und seine
Generale erscheinen als wahre Wnnderwerke der Charak-
teristik, aber wenn man sie, sowie die dritte gleichfalls
vorzügliche Gruppe, — Husaren, die in vollem Galopp
den Hügel zur Rechten des Kaisers heruntersprengen, —
eine Weile angestaunt (wie wirkliche kühne Husarenstücke),
den Truppeu-Massen im Hintergrunde, die mit Meissonnier'-
scher Virtuosität angcdeutet sind, eincn bewundernden Blick
geschenkt hat, dann wendet man sich doch wieder dcn
Bildern kleinen Formats zu, von welchen die Samin-
lung mehrere enthält, alles Kabinettstücke, mit der minutiösen
Sorgfalt gemalt, die den Beschauer anmutet, als hätte
der Pinsel die Eigenschaften des Grabstichels entlehnt,
ohne die eigenen aufzugeben.
„1807" teilte die allgemeine Aufmerksamkeit mit den
zwei berühmten Kolossalbilderu der Geschwister Bouheur.
Der noch heute mit der vollen Frische und klnmittelbarkeit
wirkende „Pferdemarkt" der Schwester ist die eigentliche
Perle der Sammlung; abcr nebcn ihm steht fast auf
Die Runst für Alle II
gleicher Höhe August Bonheurs „klmgebung von Fon-
tainebleau", eine Herbstlandschaft mit Kühen, ja in der
Einheitlichkeit der Komposition nnd in der landschaftlichen
Stinimuiig übertrifft sie noch das erste Bild. Vor diesen
beiden Tierstücken erwacht das Bedauern aufs Neue, daß
dcr verstorbene Millionär scine Kunstschätze nicht der
Offentlichkeit vermachte. Was hätte dcr amerikanischc
Kunstjünger aus ihnen lernen können!
Die Franzosen sind in der Sammlnng überreich ver-
treten. Keine Schule und kein Maler von irgendwelcher
Bedeutung, die seit dcm Jahre Fünfzig aufgetaucht, fehlen,
von manchcn sieht man drei oder vier charakteristische
Arbeiten. Nnr die Jmpressionisten und die Schule, die
jetzt so großen Anhang im Lande gefnnden, Constables
Nachfolger, die Corot, Millet und Diaz, glänzen durch
ihre Abwcsenheit.
Stewart, der, wie man spottend bemerkte, seine Bildcr
nach demselben Prinzip wie seine Schnittwaren eingehandelt,
ob sie nämlich in der Mode seien, wendete uaturgeniäß
den Franzoscn den Löwenantcil an seinen Erwerbungen
zu, da sie auf dcm amerikanischen .stunstniarkt dieselbe Rolle
spielen, wie ihre Schneiderinnen und Putzmacherinnen auf
dem Gcbict dcr Frauentoilette. Sie behcrrschen ihn, seit
den Tüsseldorfern (die bci Stewart übrigenS durch vier
vortreffliche Achenbachs, Knaus' unverwüstliches „Am
Katzentisch", eine größere Anzahl Kinderbilder von Meyer
von Bremen, etliche ültere Cainphansens rc. glänzend vcr-
treten sind), die Zügel entfielen. Erst seit den letzten
Jahren beginnt die deutsche Malkunst, (besonders die
Münchener mit Defregger an der Spitze) nm die Ober-
hoheit zu riugen.
Die besondere Rücksicht anf die gerade in Mode be-
findlichen Künstler, hat sich wie selbstverständlich, in vielen
Fällen bitter gerächt: Unter den Franzosen und ihren spanisch-
italienischen Schülern findet man eine große Anzahl von
Mittelgut, von salopp gemalten odcr bloßen Yioutinc-Bildern,
die nnter berühmter, vom Tagesgescymack hochgehaltener
Flagge in die Galerie hincinsegcltcn. Selbstverständlich
gibt es auch unter ihnen, abgcschen von den Meissoniers
nnd den beiden genannten Tierstücken, vortreffliche Gemälde.
Doch sind die mcisten dersclben, wie Geromes „Wagcn-
rcnncn", Tnbufes „Verlorener Sohn", Munkaczy's „Be-
such bei Bebse", Madrazos „Viarguise" durch Verviel-
sältigungen und Ausstellungen bekannt.
Die Amerikaner selbst sind nur spärlich vertreten,
doch ist das vorhandene fast ausnahmslos gut. Treffliche
Bilder von Bicrstadt, darunter der „Smaragdteich", der
auf der Wiener Weltausstellung Beifall fand, der berühmte
„Niagara-Fall" von Chnrch, ein besondcrs für Amcrikaner
hochbedentsames Figurcnbild Huntingtons „Empsang bei
Lady Washington" niit den Porträts all' dcr bedeutenden
Münner, der strahlend schönen Fraueu, deren Andenken
jedem jetztlebenden Svhn der Vereinigten Staaten so teuer
ist, und die dem ersten Präsidenten als Ratgeber, seincr
Gemahlin als Vertreterinnen amerikanischer Gcselligkeit
zur Seitc standen, befinden sich unter den Bildern. Hiram
Powers „Griechische Sklavin" ragt unter den Skulptnren
hervor, die, soweit sie amerikanischen Bildhauern entstammen,
noch einen hilflosen Kamps zwischen Wollen und Vollbringen
aufwcisen, deutlich verkündigend, daß die amerikanische
Malerei der anierikanischen Sknlptur einen mächtigen Vor-
sprung abgewann. Ein Spaziergang dnrch dcn Zcntral-
Park bckrüftigt diese Ansicht. Tie von amerikanischen
30
25Z
letzte amerikanische Privatsammlung, die große Historien-
bilder angekauft. Dennoch kann man sich, wenn man sie
durchwandert, des Ausrufes nicht enthalten: „Dcm Himmel
sei Dank, daß die Tage solcher Mäcene für immer dahin
sind!"
Das Kunstverständnis ist nicht nur in die Breite,
sondern auch in die Tiefe gedrnngen, ein Zusammcnwnrfeln
von wahrhaft unvergleichlichen Meisterwerken mit voll-
kommen wertlosen Klexereien, von Karikaturen in Marmor
mit reizenden Perlen der Bildhauerei, wie sie einem auf
Schritt und Tritt in der Stewart.Sammlnng aufstoßen,
wäre heute unmvglich. Der Mann, der mit den Tollars
in der Tasche klappernd, anf den enropäischen Kunstmärkten
erschien, uni alles was gut und teuer (hauptsüchlich aber
das letztere) war, ohne eine Spur vou Verständnis einzu-
kaufen, ist ausgcstorben wie das Mammut. Daß Stewart
deni Maler Meissonier einst eine große Summe sür ein
Pariser Gesellschastsbild anbot, unter der Bedingnng, daß
alle Damen auf demselbcn schwarzen Perlaufpntz tragen
müßten, weil er auf dicse Weise seine Ladcnhüter loszu-
schlagen hoffte, ist eiu charakteristischer Zug des Maunes;
daß er das einzigc große Bild dieses Malers, „1807",
noch naß von der Staffelei holte und in sein Mausoleum
einschloß, ohne dem Publikum eineu Blick auf dasselbe zu
gvnnen, ein zweiter.
Um dieses Bild, das hvchstbezahlte in seiner Galerie,
hatte sich ein ganzer Sagenkranz gesponnen. Da man es
nicht zu sehen bekam, rächte man sich durch Gerüchte; es
sollte in dem noch nicht ganz ausgetrockneten Marnior-
hanse empfindlich gelitten haben, Brüche zeigen, vollständig
zu Grunde gerichtet sein.
Jene Gerüchte logen, das Bild ist vollkommen gut
erhalten; hat es doch selbst bei der Versteigerung
noch mehr als den enormen Preis, den es einst gekostet,
erreicht. Hart und kalt in der Farbe, wie die nieisten von
Meissoniers Olbildern, wird ihm der große Vorzug, der
dieses Künstlers Gemälde im kleinen Format auszeichnet,
die überans gewissenhafte Sorgfalt für das kleinste Tetail,
beinahe zum Fluch; sie zersplittert, lenkt die Aufmerk-
samkeit auf Nebendinge ab. Das Bild zerfüllt in drei
Gruppen, und die wenigst gelungcne, Reiter, die Napoleon
enthusiastisch begrüßcnd, an ihm vorübersprengen, füllt den
Vordergrund. Roß und Mann gleichen Marionetten.
Vortrefflich ist Stapoleon auf weißem Pferd mit seineni
Stabe auf einem Hügel haltend; der Kaiser und seine
Generale erscheinen als wahre Wnnderwerke der Charak-
teristik, aber wenn man sie, sowie die dritte gleichfalls
vorzügliche Gruppe, — Husaren, die in vollem Galopp
den Hügel zur Rechten des Kaisers heruntersprengen, —
eine Weile angestaunt (wie wirkliche kühne Husarenstücke),
den Truppeu-Massen im Hintergrunde, die mit Meissonnier'-
scher Virtuosität angcdeutet sind, eincn bewundernden Blick
geschenkt hat, dann wendet man sich doch wieder dcn
Bildern kleinen Formats zu, von welchen die Samin-
lung mehrere enthält, alles Kabinettstücke, mit der minutiösen
Sorgfalt gemalt, die den Beschauer anmutet, als hätte
der Pinsel die Eigenschaften des Grabstichels entlehnt,
ohne die eigenen aufzugeben.
„1807" teilte die allgemeine Aufmerksamkeit mit den
zwei berühmten Kolossalbilderu der Geschwister Bouheur.
Der noch heute mit der vollen Frische und klnmittelbarkeit
wirkende „Pferdemarkt" der Schwester ist die eigentliche
Perle der Sammlung; abcr nebcn ihm steht fast auf
Die Runst für Alle II
gleicher Höhe August Bonheurs „klmgebung von Fon-
tainebleau", eine Herbstlandschaft mit Kühen, ja in der
Einheitlichkeit der Komposition nnd in der landschaftlichen
Stinimuiig übertrifft sie noch das erste Bild. Vor diesen
beiden Tierstücken erwacht das Bedauern aufs Neue, daß
dcr verstorbene Millionär scine Kunstschätze nicht der
Offentlichkeit vermachte. Was hätte dcr amerikanischc
Kunstjünger aus ihnen lernen können!
Die Franzosen sind in der Sammlnng überreich ver-
treten. Keine Schule und kein Maler von irgendwelcher
Bedeutung, die seit dcm Jahre Fünfzig aufgetaucht, fehlen,
von manchcn sieht man drei oder vier charakteristische
Arbeiten. Nnr die Jmpressionisten und die Schule, die
jetzt so großen Anhang im Lande gefnnden, Constables
Nachfolger, die Corot, Millet und Diaz, glänzen durch
ihre Abwcsenheit.
Stewart, der, wie man spottend bemerkte, seine Bildcr
nach demselben Prinzip wie seine Schnittwaren eingehandelt,
ob sie nämlich in der Mode seien, wendete uaturgeniäß
den Franzoscn den Löwenantcil an seinen Erwerbungen
zu, da sie auf dcm amerikanischen .stunstniarkt dieselbe Rolle
spielen, wie ihre Schneiderinnen und Putzmacherinnen auf
dem Gcbict dcr Frauentoilette. Sie behcrrschen ihn, seit
den Tüsseldorfern (die bci Stewart übrigenS durch vier
vortreffliche Achenbachs, Knaus' unverwüstliches „Am
Katzentisch", eine größere Anzahl Kinderbilder von Meyer
von Bremen, etliche ültere Cainphansens rc. glänzend vcr-
treten sind), die Zügel entfielen. Erst seit den letzten
Jahren beginnt die deutsche Malkunst, (besonders die
Münchener mit Defregger an der Spitze) nm die Ober-
hoheit zu riugen.
Die besondere Rücksicht anf die gerade in Mode be-
findlichen Künstler, hat sich wie selbstverständlich, in vielen
Fällen bitter gerächt: Unter den Franzosen und ihren spanisch-
italienischen Schülern findet man eine große Anzahl von
Mittelgut, von salopp gemalten odcr bloßen Yioutinc-Bildern,
die nnter berühmter, vom Tagesgescymack hochgehaltener
Flagge in die Galerie hincinsegcltcn. Selbstverständlich
gibt es auch unter ihnen, abgcschen von den Meissoniers
nnd den beiden genannten Tierstücken, vortreffliche Gemälde.
Doch sind die mcisten dersclben, wie Geromes „Wagcn-
rcnncn", Tnbufes „Verlorener Sohn", Munkaczy's „Be-
such bei Bebse", Madrazos „Viarguise" durch Verviel-
sältigungen und Ausstellungen bekannt.
Die Amerikaner selbst sind nur spärlich vertreten,
doch ist das vorhandene fast ausnahmslos gut. Treffliche
Bilder von Bicrstadt, darunter der „Smaragdteich", der
auf der Wiener Weltausstellung Beifall fand, der berühmte
„Niagara-Fall" von Chnrch, ein besondcrs für Amcrikaner
hochbedentsames Figurcnbild Huntingtons „Empsang bei
Lady Washington" niit den Porträts all' dcr bedeutenden
Münner, der strahlend schönen Fraueu, deren Andenken
jedem jetztlebenden Svhn der Vereinigten Staaten so teuer
ist, und die dem ersten Präsidenten als Ratgeber, seincr
Gemahlin als Vertreterinnen amerikanischer Gcselligkeit
zur Seitc standen, befinden sich unter den Bildern. Hiram
Powers „Griechische Sklavin" ragt unter den Skulptnren
hervor, die, soweit sie amerikanischen Bildhauern entstammen,
noch einen hilflosen Kamps zwischen Wollen und Vollbringen
aufwcisen, deutlich verkündigend, daß die amerikanische
Malerei der anierikanischen Sknlptur einen mächtigen Vor-
sprung abgewann. Ein Spaziergang dnrch dcn Zcntral-
Park bckrüftigt diese Ansicht. Tie von amerikanischen
30