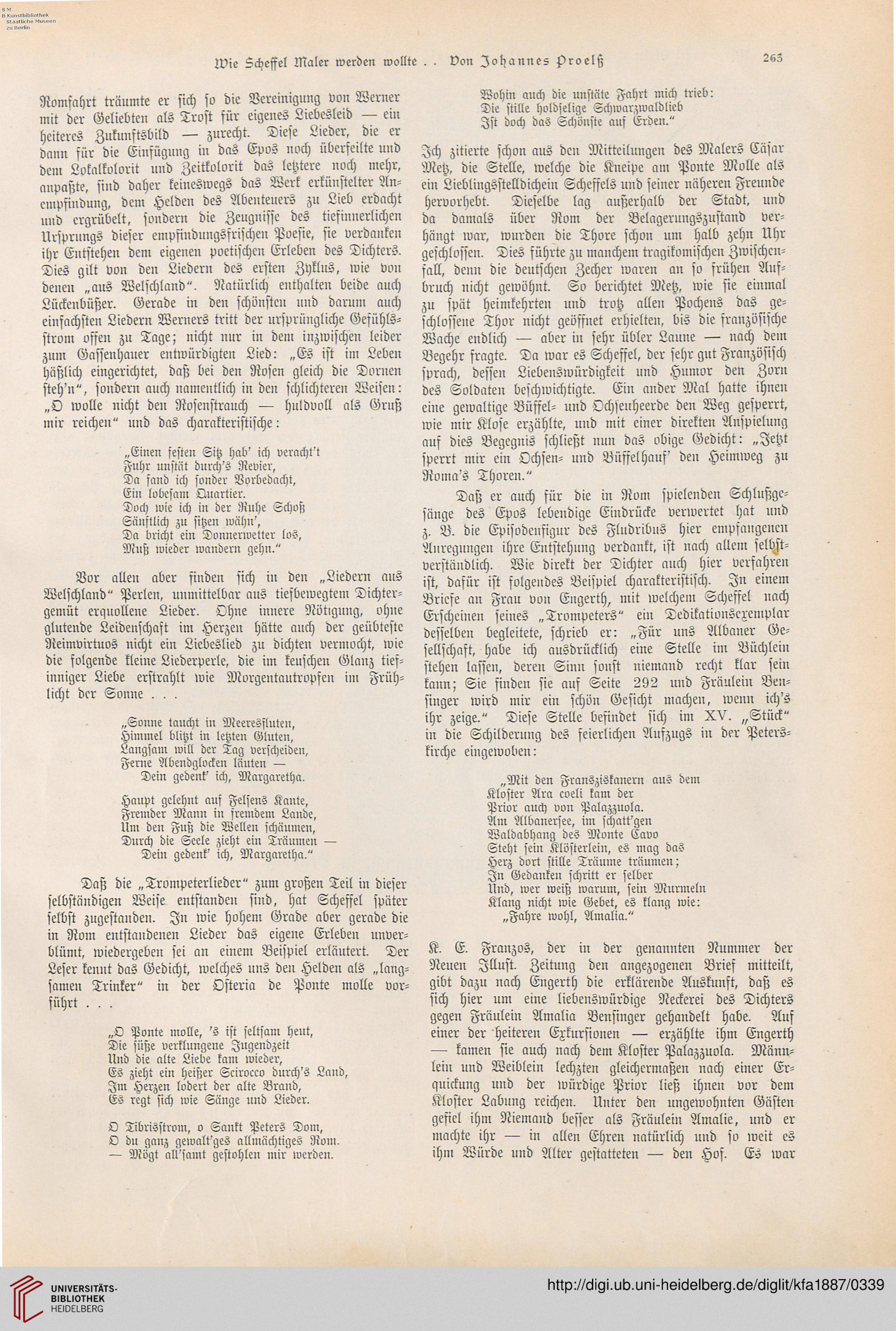N)ie Hcheffel Maler werden wollte . . Von Iohannes j)roelß 263
Romfahrt träumte er sich so die Vereinigung vou Werner
mit der Geliebteu als Trost für eigenes Liebesleid — eiu
heiteres Zukuuftsbild — zurecht. Diese Lieder, die er
dann für die Einfügung iu das Epos uoch überfeilte uud
dem Lokalkolorit uud Zeitkolorit das letztere uoch mehr,
aupaßte, sind daher keineswegs das Werk erkünstelter An-
empfindung, dem Helden des Abenteuers zu Lieb erdacht
uud ergrübelt, sondern die Zeugnisse des tiefinnerlichen
Ursprungs dieser empfindungsfrischen Poesie, sie verdanken
ihr Entsteheu deni eigenen poetischen Erleben des Dichters.
Dies gilt von den Liedern des ersteu Zyklus, wie vou
denen „aus Welschland". Natürlich enthalteu beide auch
Lückenbüßer. Gerade in den schönsten und darum auch
einfachsten Liedern Werners tritt der ursprüngliche Gesühls-
strom offen zu Tage; nicht nur in deni inzwischen leider
zum Gassenhauer entwürdigteu Lied: „Es ist im Lebeu
häßlich eingerichtet, daß bei den Rosen gleich die Dorueu
steh'u", souderu auch uameutlich iu deu schlichtereu Weiseu:
„O wolle nicht den Rosenstrauch — huldvoll als Gruß
mir reicheu" uud das charakteristische:
„Einen festen Sitz hab' ich veracht't
Fuhr unstät durch's Revier,
Da fand ich sonder Vorbedacht,
Ein lobesam Quartier.
Dvch ivie ich in der Ruhe Schoß
Sänftlich zu sitzen wähn',
Da bricht ein Donnerwetter los,
Muß wieder wandern gehn."
Vor alleu aber finden sich iu deu „Liedern aus
Welschland" Perleu, uumittelbar aus tiefbewegtem Dichter-
gemüt erguolleue Lieder. Ohne innere Nötigung, ohue
glutende Leideuschaft im Herzeu hätte auch der geübteste
Reimvirtuos nicht ein Liebeslied zu dichten vermocht, wie
die folgende kleine Liederperle, die im keuschen Glanz tief-
inniger Liebe erstrahlt wie Mvrgentautropfen im Früh-
licht dcr Soune . . .
„Sonne taucht in Meeresfluten,
Himniel blitzt in letzten Gluten,
Langsam will der Tag verscheiden,
Ferue Abendglocken lnuten —
Dein gedenk' ich, Margaretha.
Haupt gelehnt aus Felsens Kante,
Fremder Mann in sremdem Lande,
11m den F-uß die Wellen schäumen,
Durch die Seele zieht ein Träumen —
Dein gedenk' ich, Margaretha."
Daß die „Trompeterlieder" zum großen Teil in dieser
selbstäudigen Weise entstandeu sind, hat Scheffel später
selbst zugestaudeu. Jn wie hohem Grade aber gerade die
in Rom entstaudenen Lieder das eigene Erleben unver-
blümt, wiedergeben sei an eiuem Beispiel erläutert. Der
Leser kenut das Gedicht, welches uns deu Helden als „lang-
samen Trinker" in der Osteria de Ponte molle vor-
führt . . .
„O Ponte molle, 's ist seltsam heut,
Die sütze verklungene Jugendzeit
llnd die alte Liebe kam wieder,
Es zieht ein heißer Scirocco durch's Land,
Jm Herzen lodert der alte Brand,
Es regt sich wie Sänge und Lieder.
O Tibrisstrom, o Sankt Peters Dom,
O dn ganz gewalt'ges allmächtiges Rom.
— Mvgt all'samt gestohlen mir werden.
Wohin auch die unstäte Fahrt mich trieb:
Die stille holdselige Schwarzwaldlieb
Jst doch das Schönste auf Erden."
Jch zitierte schon aus dcu Mittcilungen des Malers Cäsar
Metz, die Stelle, welche die Kneipe am Ponte Molle als
eiu Lieblingsstelldicheiu Scheffels uud seiuer nähereu Freunde
hervorhebt. Dieselbe lag außerhalb der Stadt, uud
da damals über Rom der Belagerungszustand ver-
hängt war, wurden die Thore schon um halb zehn Uhr
geschlosseu. Dies führte zu manchem tragikomischeu Zwischcn-
fall, deun die deutschen Zecher waren au so früheu Auf-
bruch nicht gewöhnt. So berichtet Metz, wie sie einmal
zu spät heimkehrten uud trotz alleu Pochens das ge-
schlosseue Thor nicht geösfuet erhielten, bis die französische
Wache eudlich — aber iu sehr übler Lauue — nach dem
Begehr fragte. Da war es Scheffel, dcr sehr gut Französisch
sprach, desseu Liebeuswürdigkeit und Humor den Zvru
des Soldateu beschwichtigte. Ein ander Mal hatte ihneu
eiue gewaltige Büffel- uud Ochseuheerde den Weg gesperrt,
wie mir Klose erzählte, uud mit einer direkten Anspieluug
aus dies Begeguis schließt nuu das obige Gedicht: „Jetzt
sperrt mir ein Ochsen- und Büffelhauf' deu Heimweg zu
Roma's Thoreu."
Daß er auch für die iu Rom spieleuden Schlußge-
sänge des Epos lebendige Eindrücke verwertet hat und
z. B. die Episodeufigur des Fludribus hier empfaugencu
Aureguugeu ihre Eutstchuug verdankt, ist uach allem selbst-
verstäudlich. Wie direkt der Dichter auch hier verfahren
ist, dafür ist folgendes Beispiel charakteristisch. Jn einem
Bricfe an Frau von Engerth, mit welchem Scheffel uach
Erscheiueu seiues „Trompeters" ein Tedikationsexemplar
desselben begleitete, schrieb er: „Für uns Albaner Ge-
sellschaft, habe ich ausdrücklich eine Stelle im Büchlein
stehen lassen, deren Sinn sonst niemaud recht klar seiu
kann; Sie finden sie auf Seite 292 und Fräuleiu Ben-
singer wird mir ein schön Gesicht machen, wenn ich's
ihr zeige." Diese Stelle befindet sich im XV. „Stück"
in die Schilderung des feierlichen Aufzugs iu der Peters-
kirche eingewoben:
„Mit den Fransziskanern aus dein
Kloster Ara coeli kam der
Prior auch von Palazzuola.
?lm dllbanersee, iin schatt'gen
Waldabhang des Monte Cavo
Steht sein Klvsterlein, es mag das
Herz dort stille Trüunie träumen;
Jn Gedauken schritt er selber
lind, wer weiß warum, sein Murmeln
Klang nicht wie Gebet, es klang wie:
„Fahre wohl, Amalia."
K. E. Franzos, der in der genaunteu Nummer der
Neuen Jllust. Zeituug den angezogeuen Brief mitteilt,
gibt dazu uach Engerth die erklärende Auskunft, daß es
sich hier um eine liebeuswürdige Neckerei des Dichters
gegen Fräulein Amalia Bensinger gehandelt habe. Auf
einer der heiteren Exkursionen — erzählte ihm Eugerth
— kamen sie auch nach dem Kloster Palazzuola. Mäun-
leiu und Weiblein lechzten gleichcrmaßeu nach einer Er-
guickung uud der würdige Prior ließ ihneu vor dem
Kloster Labung reicheu. Uuter den ungewohnten Gästeu
geficl ihm Niemaud besser als Fräuleiu Amalie, uud er
machte ihr — in allen Ehreu natürlich und so weit es
ihm Würde und Alter gestatteten — den Hof. Es war