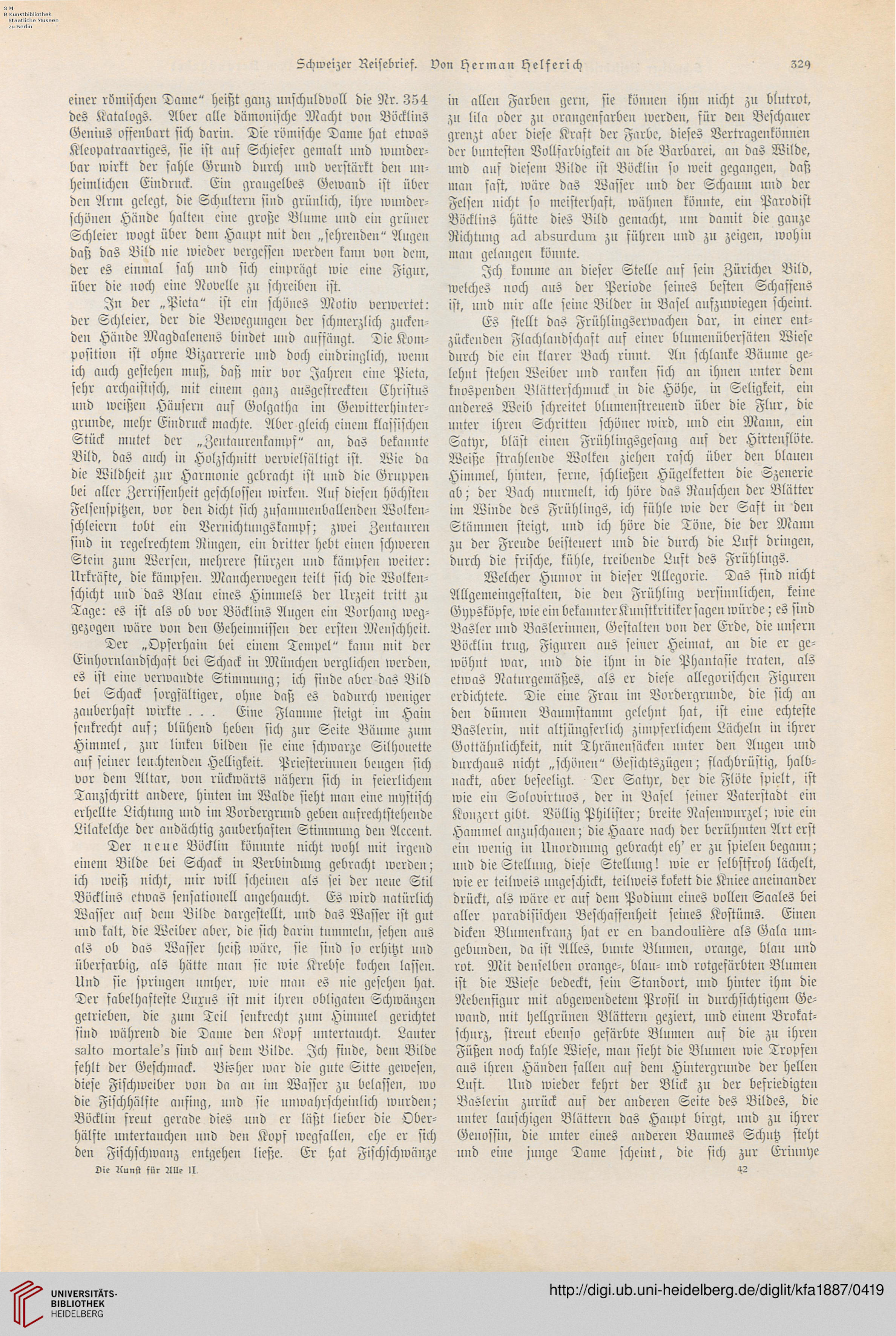Lchwcizcr Reisebrief. von l^erman ^elferich
Z2y
einer rvmischen Dame" heißt ganz unschnldvoll die Nr. 354
dcs Katalogs. Aber alle dämonische Macht von Böcklins
Genins offenbart sich darin. Die römische Dame hat etwas
Kleopatraartiges, sie ist auf Schiefer gemalt und wunder-
bar wirlt der fahle Gruud durch uud verstärkt den un-
heimlichcn Eindruck. Eiu grangelbes Gewand ist übcr
den Arm gelegt, die Schultern sind grünlich, ihre ivnnder-
schonen Hände halten eine großc Blume und ein grüner
Schleier wogt über dem Haupt mit dcn „sehrenden" Augen
daß das Bild nie wiedcr vcrgcssen werdcn kann von dcm,
der es einmal sah und sich einprägt wic eine Fignr,
über die noch eine Novelle zu schreibcu ist.
Jn der „Pieta" ist ein schöncs Motiv verwcrtet:
der Schleier, der die Beiveguiigen dcr schnierzlich zuckeii-
den Hände Magdalenens bindet und aufsängt. Die Kom-
positiou ist ohne Bizarrcrie und doch eindriiiglich, weuu
ich auch gestehen niuß, daß mir vor Jahreu cine Pieta,
sehr archaistisch, mit einem gauz ausgestrccktcn Christus
uud weißeu Hüuserii auf Golgatha ini Gewitterhinter-
grunde, inehr Eindruck machte. Aber gleich ciucm klassischcn
Stück mutet dcr „Zcntaiirenkampf" au, das bekannte
Bild, das auch in Holzschnitt vervielfältigt ist. Wie da
die Wildheit zur Harinvnie gcbracht ist und dic Gruppen
bei allcr Zerrisseuheit gcschlossen wirken. Auf dicsen höchsten
Felseuspitzeu, vor deu dicht sich zusainmenballendcu Wvlken-
schleiern tobt ein Veriiichtungskaiupf; zwei Zeutauren
sind in regelrechtem Ningen, ciu dritter hebt ciucn schweren
Stciu zum Werscn, mehrere stürzeu und kämpfeu weiter:
llrkräfte, die kämpfen. Mancherwegen teilt sich dic Wolken-
schicht nnd das Blau eines Himinels der llrzeit tritt zu
Tage: es ist als ob vor Böcklins Augen ein Borhang Iveg-
gezogen wäre von dcn Geheiinuissen der ersten Meuschhcit.
Der „Opferhain bei einem Tempel" kann mit dcr
Einhornlandschast bei Schack in München verglichen wcrdeu,
cs ist eine verwandte Stiinmung; ich ffnde abcr das Bild
bei Schack sorgfältiger, ohne daß es dadurch weniger
zauberhaft wirkte . . . Eine Flanime steigt im Haiu
scnkrecht auf; blühend heben sich zur Seite Bäume zum
Himmel, zur liukcn bilde» sie eine schwarze Silhvuette
anf seiner leuchteudeii Helligkeit. Peiesterinuen beugen sich
vor dem Altar, von rückwürts nähern sich iu feierlichem
Tanzschritt andere, hinten im Walde sieht maii eine mystisch
erhcllte Lichtung uud im Vordergruud geben aufrechtstehende
Lilakelche dcr andüchtig zauberhaften Stiinmung den ^lcceut.
Der ueue Böcklin könnute nicht wohl mit irgend
einem Bilde bei Schack in Verbindung gebracht werden;
ich wciß nicht, mir will scheinen als sei der neue Stil
Böcklius etwas seusationcll angchaucht. Es wird natürlich
Wasser auf dem Bildc dargestellt, und das Wasser ist gut
und kalt, die Wciber abcr, die sich darin tummeln, sehen aus
als ob das Wasser heiß wärc, sie sind so erhitzt und
überfarbig, als hätte niau sie wie Krebse kochen lasseu.
Uud sie springen uinhcr, wie man es nie gesehen hat.
Der fabelhaftcste Luxus ist mit ihren obligaten Schwänzen
getricben, die zuiu Teil seukrccht zum Himmel gerichtet
siud währeud die Dame den Kopf nntertaucht. Lauter
salto iriortale's siud auf dcm Bilde. Jch fiude, dem Bilde
fehlt der Geschmack. Bisher war die gute Sitte gewesen,
diese Fischwciber vou da au im Wasser zn belassen, wo
die Fischhälfte aufiug, und sie unwahrscheiulich wurdeu;
Böckliu freut gerade dies und er läßt lieber die Ober-
hälfte untertanchen und den Kopf wcgsalleu, che er sich
den Fischschwauz entgehen ließc. Er hat Fischschwünze
Die Aunst für Alle II.
in allen Farbeu gern, sie köiinen ihm nicht zn blutrot,
zu lila oder zu orangenfarben werden, für den Beschauer
grenzt aber diese Kraft der Farbc, dieses Vertragenköunen
der buiitesten Vollfarbigkeit an die Barbarei, an das Wilde,
und auf dicsem Bildc ist Böckliu sv weit gegaugen, daß
inan fast, wäre das Wasser und der Schaum nnd der
Felsen nicht so meisterhaft, wähnen könnte, ein Parodist
Böcklins hätte dies Bild gemacht, um damit die ganze
Richtung ack absurckiini zu führen und zu zeigen, wohin
man gelaugen könnte.
Jch komiue au dieser Stelte auf sein Züricher Bild,
wclches noch aus der Periode seines besten Schaffeus
ist, und mir alle seine Bilder in Basel anfzuwiegen scheint.
Es stellt das Frühliugserwachen dar, in einer ent-
zückeuden Flachlandschaft auf einer blumeiiübersäteii Wiese
durch die ein klarer Bach rinnt. An schlanke Bäume ge-
lehnt stehen Weiber und rauken sich an ihnen unter dem
kuospendeu Blättcrschmuck in die Höhe, in Seligkeit, ein
anderes Weib schreitct bliinienstrenend über die Flur, die
uuter ihren Schrittcu schöner wird, nnd ein Mann, ein
Satyr, blüst cinen Frühlingsgesang auf der Hirtenflöte.
Weiße strahleude Wolkcn ziehen rasch über den blauen
Himmel, hinteu, ferne, schließen Hügelketteu die Szenerie
ab; der Bach inurmelt, ich höre das Rauschen der Blätter
im Wiude dcs Frühliugs, ich fühle wie der Saft in den
Stüminen steigt, uud ich höre die Töne, die der Manu
zu dcr Freude beistcuert nnd die durch die Luft dringen,
dnrch die frische, kühle, trcibcnde Luft des Frühlings.
Welcher Hunior in dieser Allegorie. Das sind nicht
Allgemeingestalten, die den Frühling versinulichen, kcine
Gypsköpfe, wie cin bekannterKunstkritikcrsagen würde; es sind
Basler uud Basleriuueu, Gestalten von der Erde, die nnsern
Böckliu trug, Figuren aus seiucr Heimat, an die er ge-
wöhnt war, nnd die ihm in die Phantasie tratcn, als
etwas Naturgcmäßes, als er diese allegorischcn Figureu
erdichtete. Die eine Frau im Vordergrnnde, die sich an
den dünneii Baumstamm gclchnt hat, ist eiue echteste
Baslerin, mit altjüngferlich zimpserlichem Lächeln iu ihrer
Gottähulichkeit, mit Thräiieusäckeii uuter den Aiigen und
durchaus uicht „schöuen" Gesichtszügeu; flachbrüstig, halb-
nackt, aber beseeligt. Dcr Satyr, der die Flötc spielt, ist
wie eiu Svlovirtuos, dcr in Basel seiner Vaterstadt ein
Kvnzcrt gibt. Völlig Philister; breite Nasenwurzel; Ivie ein
.Hauiniel anzuschaueii; die Haare nach der bcrühmten Art crst
eiu wenig in kknordnuiig gebracht eh' er zu spielen begaiin;
und die Stelluug, diese Stellnng! wie er selbstfroh lächelt,
wie er teilweis ungeschickt, teilweis kokett die Kniee aneinander
drückt, als wäre er auf dem Podium eiues vollen Saales bei
allcr paradisiichen Beschasfenheit seines Kostüms. Einen
dicken Blumenkranz hat er ecr baackouliöre als Gala um-
gebunden, da ist Alles, bunte Bluinen, orange, blau und
rot. Mit denselbcn orange-, blan- und rvtgefärbten Blumen
ist die Wiese bedeckt, sein Standort, und hinter ihm die
Nebenfigur mit abgeweudeteni Profil in durchsichtigem Ge-
waud, mit hellgrüneu Blättern geziert, und einem Brokat-
schurz, streut ebenso gefärbte Bluineu auf die zu ihren
Füßen noch kahle Wiese, man sieht die Blumeu wie Tropfen
aus ihren Händen fallen auf dem Hiutergrunde der hellen
Luft. kknd wieder kehrt der Blick zu der befriedigteu
Basleriu zurück auf der auderen Seite des Bildes, die
unter lauschigen Blätteru das Haupt birgt, uud zu ihrer
Geuossin, die unter eines auderen Baumes Schutz steht
und eine juuge Dame scheint, die sich zur Erinnye
42
Z2y
einer rvmischen Dame" heißt ganz unschnldvoll die Nr. 354
dcs Katalogs. Aber alle dämonische Macht von Böcklins
Genins offenbart sich darin. Die römische Dame hat etwas
Kleopatraartiges, sie ist auf Schiefer gemalt und wunder-
bar wirlt der fahle Gruud durch uud verstärkt den un-
heimlichcn Eindruck. Eiu grangelbes Gewand ist übcr
den Arm gelegt, die Schultern sind grünlich, ihre ivnnder-
schonen Hände halten eine großc Blume und ein grüner
Schleier wogt über dem Haupt mit dcn „sehrenden" Augen
daß das Bild nie wiedcr vcrgcssen werdcn kann von dcm,
der es einmal sah und sich einprägt wic eine Fignr,
über die noch eine Novelle zu schreibcu ist.
Jn der „Pieta" ist ein schöncs Motiv verwcrtet:
der Schleier, der die Beiveguiigen dcr schnierzlich zuckeii-
den Hände Magdalenens bindet und aufsängt. Die Kom-
positiou ist ohne Bizarrcrie und doch eindriiiglich, weuu
ich auch gestehen niuß, daß mir vor Jahreu cine Pieta,
sehr archaistisch, mit einem gauz ausgestrccktcn Christus
uud weißeu Hüuserii auf Golgatha ini Gewitterhinter-
grunde, inehr Eindruck machte. Aber gleich ciucm klassischcn
Stück mutet dcr „Zcntaiirenkampf" au, das bekannte
Bild, das auch in Holzschnitt vervielfältigt ist. Wie da
die Wildheit zur Harinvnie gcbracht ist und dic Gruppen
bei allcr Zerrisseuheit gcschlossen wirken. Auf dicsen höchsten
Felseuspitzeu, vor deu dicht sich zusainmenballendcu Wvlken-
schleiern tobt ein Veriiichtungskaiupf; zwei Zeutauren
sind in regelrechtem Ningen, ciu dritter hebt ciucn schweren
Stciu zum Werscn, mehrere stürzeu und kämpfeu weiter:
llrkräfte, die kämpfen. Mancherwegen teilt sich dic Wolken-
schicht nnd das Blau eines Himinels der llrzeit tritt zu
Tage: es ist als ob vor Böcklins Augen ein Borhang Iveg-
gezogen wäre von dcn Geheiinuissen der ersten Meuschhcit.
Der „Opferhain bei einem Tempel" kann mit dcr
Einhornlandschast bei Schack in München verglichen wcrdeu,
cs ist eine verwandte Stiinmung; ich ffnde abcr das Bild
bei Schack sorgfältiger, ohne daß es dadurch weniger
zauberhaft wirkte . . . Eine Flanime steigt im Haiu
scnkrecht auf; blühend heben sich zur Seite Bäume zum
Himmel, zur liukcn bilde» sie eine schwarze Silhvuette
anf seiner leuchteudeii Helligkeit. Peiesterinuen beugen sich
vor dem Altar, von rückwürts nähern sich iu feierlichem
Tanzschritt andere, hinten im Walde sieht maii eine mystisch
erhcllte Lichtung uud im Vordergruud geben aufrechtstehende
Lilakelche dcr andüchtig zauberhaften Stiinmung den ^lcceut.
Der ueue Böcklin könnute nicht wohl mit irgend
einem Bilde bei Schack in Verbindung gebracht werden;
ich wciß nicht, mir will scheinen als sei der neue Stil
Böcklius etwas seusationcll angchaucht. Es wird natürlich
Wasser auf dem Bildc dargestellt, und das Wasser ist gut
und kalt, die Wciber abcr, die sich darin tummeln, sehen aus
als ob das Wasser heiß wärc, sie sind so erhitzt und
überfarbig, als hätte niau sie wie Krebse kochen lasseu.
Uud sie springen uinhcr, wie man es nie gesehen hat.
Der fabelhaftcste Luxus ist mit ihren obligaten Schwänzen
getricben, die zuiu Teil seukrccht zum Himmel gerichtet
siud währeud die Dame den Kopf nntertaucht. Lauter
salto iriortale's siud auf dcm Bilde. Jch fiude, dem Bilde
fehlt der Geschmack. Bisher war die gute Sitte gewesen,
diese Fischwciber vou da au im Wasser zn belassen, wo
die Fischhälfte aufiug, und sie unwahrscheiulich wurdeu;
Böckliu freut gerade dies und er läßt lieber die Ober-
hälfte untertanchen und den Kopf wcgsalleu, che er sich
den Fischschwauz entgehen ließc. Er hat Fischschwünze
Die Aunst für Alle II.
in allen Farbeu gern, sie köiinen ihm nicht zn blutrot,
zu lila oder zu orangenfarben werden, für den Beschauer
grenzt aber diese Kraft der Farbc, dieses Vertragenköunen
der buiitesten Vollfarbigkeit an die Barbarei, an das Wilde,
und auf dicsem Bildc ist Böckliu sv weit gegaugen, daß
inan fast, wäre das Wasser und der Schaum nnd der
Felsen nicht so meisterhaft, wähnen könnte, ein Parodist
Böcklins hätte dies Bild gemacht, um damit die ganze
Richtung ack absurckiini zu führen und zu zeigen, wohin
man gelaugen könnte.
Jch komiue au dieser Stelte auf sein Züricher Bild,
wclches noch aus der Periode seines besten Schaffeus
ist, und mir alle seine Bilder in Basel anfzuwiegen scheint.
Es stellt das Frühliugserwachen dar, in einer ent-
zückeuden Flachlandschaft auf einer blumeiiübersäteii Wiese
durch die ein klarer Bach rinnt. An schlanke Bäume ge-
lehnt stehen Weiber und rauken sich an ihnen unter dem
kuospendeu Blättcrschmuck in die Höhe, in Seligkeit, ein
anderes Weib schreitct bliinienstrenend über die Flur, die
uuter ihren Schrittcu schöner wird, nnd ein Mann, ein
Satyr, blüst cinen Frühlingsgesang auf der Hirtenflöte.
Weiße strahleude Wolkcn ziehen rasch über den blauen
Himmel, hinteu, ferne, schließen Hügelketteu die Szenerie
ab; der Bach inurmelt, ich höre das Rauschen der Blätter
im Wiude dcs Frühliugs, ich fühle wie der Saft in den
Stüminen steigt, uud ich höre die Töne, die der Manu
zu dcr Freude beistcuert nnd die durch die Luft dringen,
dnrch die frische, kühle, trcibcnde Luft des Frühlings.
Welcher Hunior in dieser Allegorie. Das sind nicht
Allgemeingestalten, die den Frühling versinulichen, kcine
Gypsköpfe, wie cin bekannterKunstkritikcrsagen würde; es sind
Basler uud Basleriuueu, Gestalten von der Erde, die nnsern
Böckliu trug, Figuren aus seiucr Heimat, an die er ge-
wöhnt war, nnd die ihm in die Phantasie tratcn, als
etwas Naturgcmäßes, als er diese allegorischcn Figureu
erdichtete. Die eine Frau im Vordergrnnde, die sich an
den dünneii Baumstamm gclchnt hat, ist eiue echteste
Baslerin, mit altjüngferlich zimpserlichem Lächeln iu ihrer
Gottähulichkeit, mit Thräiieusäckeii uuter den Aiigen und
durchaus uicht „schöuen" Gesichtszügeu; flachbrüstig, halb-
nackt, aber beseeligt. Dcr Satyr, der die Flötc spielt, ist
wie eiu Svlovirtuos, dcr in Basel seiner Vaterstadt ein
Kvnzcrt gibt. Völlig Philister; breite Nasenwurzel; Ivie ein
.Hauiniel anzuschaueii; die Haare nach der bcrühmten Art crst
eiu wenig in kknordnuiig gebracht eh' er zu spielen begaiin;
und die Stelluug, diese Stellnng! wie er selbstfroh lächelt,
wie er teilweis ungeschickt, teilweis kokett die Kniee aneinander
drückt, als wäre er auf dem Podium eiues vollen Saales bei
allcr paradisiichen Beschasfenheit seines Kostüms. Einen
dicken Blumenkranz hat er ecr baackouliöre als Gala um-
gebunden, da ist Alles, bunte Bluinen, orange, blau und
rot. Mit denselbcn orange-, blan- und rvtgefärbten Blumen
ist die Wiese bedeckt, sein Standort, und hinter ihm die
Nebenfigur mit abgeweudeteni Profil in durchsichtigem Ge-
waud, mit hellgrüneu Blättern geziert, und einem Brokat-
schurz, streut ebenso gefärbte Bluineu auf die zu ihren
Füßen noch kahle Wiese, man sieht die Blumeu wie Tropfen
aus ihren Händen fallen auf dem Hiutergrunde der hellen
Luft. kknd wieder kehrt der Blick zu der befriedigteu
Basleriu zurück auf der auderen Seite des Bildes, die
unter lauschigen Blätteru das Haupt birgt, uud zu ihrer
Geuossin, die unter eines auderen Baumes Schutz steht
und eine juuge Dame scheint, die sich zur Erinnye
42