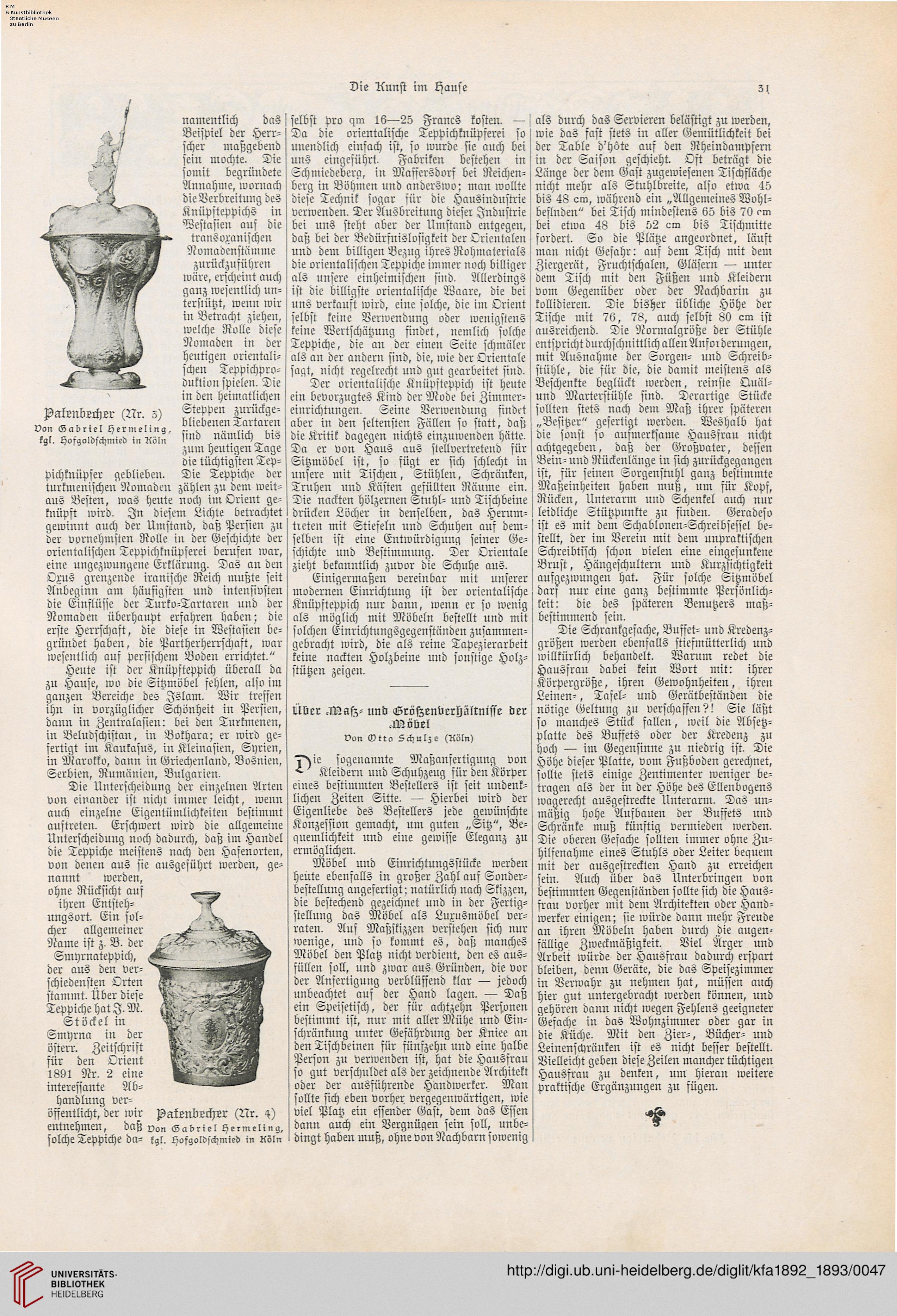Die Kunst im Hause
namentlich das
Beispiel der Herr-
scher maßgebend
sein mochte. Die
somit begründete
Annahme, wornach
die Verbreitung des
Knüpsteppichs in
Westasien auf die
transoxanischen
Nomadenstämme
zurückzuführen
wäre, erscheint auch
ganz wesentlich un-
terstützt, wenn wir
in Betracht ziehen,
welche Rolle diese
Nomaden in der
heutigen orientali-
schen Teppichpro-
duktion spielen. Die
in den heimatlichen
Steppen zurückge-
bliebenen Tartaren
sind nämlich bis
zum heutigen Tage
oie tüchtigsten Tep-
pichknüpfer geblieben. Die Teppiche der
turkmenischen Nomaden zählen zu dem weit-
aus Besten, was heute noch im Orient ge-
knüpft wird. In diesem Lichte betrachtet
gewinnt auch der Umstand, daß Persien zu
der vornehmsten Rolle in der Geschichte der
orientalischen Teppichknüpserei berufen war,
eine ungezwungene Erklärung. Das an den
Oxus grenzende iranische Reich mußte seit
Anbeginn am häufigsten und intensivsten
die Einflüsse der Turko-Tarlaren und der
Nomaden überhaupt erfahren haben; die
erste Herrschaft, die diese in Westasien be-
gründet haben, die Partherherrschaft, war
wesentlich auf persischem Boden errichtet."
Heute ist der Knüpsteppich überall da
zu Hause, wo die Sitzmöbel fehlen, also im
ganzen Bereiche des Islam. Wir treffen
ihn in vorzüglicher Schönheit in Persien,
dann in Zentralasien: bei den Turkmenen,
in Beludschistan, in Bokhara; er wird ge-
fertigt im Kaukasus, in Kleinasien, Syrien,
in Marokko, dann in Griechenland, Bosnien,
Serbien, Rumänien, Bulgarien.
Die Unterscheidung der einzelnen Arten
von einander ist nicht immer leicht, wenn
auch einzelne Eigentümlichkeiten bestimmt
austreten. Erschwert wird die allgemeine
Unterscheidung noch dadurch, daß im Handel
die Teppiche meistens nach den Hafenorten,
von denen aus sie ausgesührt werden, ge-
nannt werden,
ohne Rücksicht auf
ihren Entsteh-
ungsort. Ein sol-
cher allgemeiner
Name ist z. B. der
Smyrnateppich,
der aus den ver-
schiedensten Orten
stammt. Über diese
Teppiche hatJ.M.
Stöckel in
Smyrna in der
österr. Zeitschrift
für den Orient
1891 Nr. 2 eine
interessante Ab-
handlung ver-
öffentlicht, der wir jSalenbechrr (Nr. 4)
entnehmen, daß Von Gabriel Hermeling,
solche Teppiche da- kgl. Hofgoldschmied in Köln
selbst pro gm 16—25 Francs kosten. —
Da die orientalische Teppichknüpserei so
unendlich einfach ist, so wurde sie auch bei
uns Angeführt. Fabriken bestehen in
Schmiedebera, in Maffersdorf bei Reichen-
berg in Böhmen und anderswo; man wollte
diese Technik sogar für die Hausindustrie
verwenden. Der Ausbreitung dieser Industrie
bei uns steht aber der Umstand entgegen,
daß bei der Bedürfnislosigkeit der Orientalen
und dem billigen Bezug ihres Rohmaterials
die orientalischen Teppiche immer noch billiger
als unsere einheimischen sind. Allerdings
ist die billigste orientalische Waare, die bei
uns verkauft wird, eine solche, die im Orient
selbst keine Verwendung oder wenigstens
keine Wertschätzung findet, nemlich solche
Teppiche, die an der einen Seite schmäler
als an der andern sind, die, wie der Orientale
sagt, nicht regelrecht und gut gearbeitet sind.
Der orientalische Knüpsteppich ist heute
ein bevorzugtes Kind der Mode bei Zimmer-
einrichtungen. Seine Verwendung findet
aber in den seltensten Fällen so statt, daß
die Kritik dagegen nichts einzuwenden hätte.
Da er von Haus aus stellvertretend sür
Sitzmöbel ist, so fügt er sich schlecht in
unsere mit Tischen, Stühlen, Schränken,
Truhen und Kästen gefüllten Räume ein.
Die nackten hölzernen Stuhl- und Tischbeine
drücken Löcher in denselben, das Herum-
tteten mit Stiefeln und Schuhen auf dem-
selben ist eine Entwürdigung seiner Ge-
schichte und Bestimmung. Der Orientale
zieht bekanntlich zuvor die Schuhe aus.
Einigermaßen vereinbar mit unserer
modernen Einrichtung ist der orientalische
Knüpsteppich nur dann, wenn er so wenig
als möglich mit Möbeln bestellt und mit
solchen Einrichtungsgegenständen zusammen-
gebracht wird, die als reine Tapezierarbeit
keine nackten Holzbeine und sonstige Holz-
stützen zeigen.
Über -Matz- und GrötzenvcrhLllnisft der
Möbel
von Dtto Schulze (Aöln)
ie sogenannte Maßanfertigung von
Kleidern und Schuhzeug für den Körper
eines bestimmten Bestellers ist seit undenk-
lichen Zeiten Sitte. — Hierbei wird der
Eigenliebe des Bestellers jede gewünschte
Konzession gemacht, um guten „Sitz", Be-
quemlichkeit und eine gewisse Eleganz zu
ermöglichen.
Möbel und Einrichtungsstücke werden
heute ebenfalls in großer Zahl auf Sonder-
bestellung angefertigt; natürlich nach Skizzen,
die bestechend gezeichnet und in der Fertig-
stellung das Möbel als Luxusmöbel ver-
raten. Auf Maßskizzen verstehen sich nur
wenige, und so kommt es, daß manches
Möbel den Platz nicht verdient, den es aus-
füllen soll, und zwar aus Gründen, die vor
der Anfertigung verblüffend klar — jedoch
unbeachtet aus der Hand lagen. — Daß
ein Speisetisch, der für achtzehn Personen
bestimmt ist, nur mit aller Mühe und Ein-
schränkung unter Gefährdung der Kniee an
den Tischbeinen für fünfzehn und eine halbe
Person zu verwenden ist, hat die Hausfrau
so gut verschuldet als der zeichnende Architekt
oder der ausführende Handwerker. Man
sollte sich eben vorher vergegenwärtigen, wie
viel Platz ein essender Gast, dem das Essen
dann auch ein Vergnügen sein soll, unbe-
dingt haben muß, ohne von Nachbarn sowenig
-1
als durch das Servieren belästigt zu werden,
wie das fast stets in aller Gemütlichkeit bei
der Table d'höte auf den Rheindampfern
in der Saison geschieht. Oft beträgt die
Länge der dem Gast zugewiesenen Tischfläche
nicht mehr als Stuhlbreite, also etwa 45
bis 48 cm, während ein „Allgemeines Wohl-
befinden" bei Tisch mindestens 65 bis 70 cm
bei etwa 48 bis 52 cm bis Tischmitte
fordert. So die Plätze angeordnet, läuft
man nicht Gefahr: auf dem Tisch mit dem
j Ziergerät, Fruchtschalen, Gläsern — unter
dem Tisch mit den Füßen und Kleidern
vom Gegenüber oder der Nachbarin zu
kollidieren. Die bisher übliche Höhe der
Tische mit 76, 78, auch selbst 80 cm ist
ausreichend. Die Normalgröße der Stühle
entspricht durchschnittlich allen Anforderungen,
mit Ausnahme der Sorgen- und Schreib-
stühle, die für die, die damit meistens als
Beschenkte beglückt werden, reinste Quäl-
und Marterstühle sind. Derartige Stücke
sollten stets nach dem Maß ihrer späteren
„Besitzer" gefertigt werden. Weshalb hat
die sonst so aufmerksame Hausfrau nicht
achtgegeben, daß der Großvater, dessen
Bein- und Rückenlänge in sich zurückgegangen
ist, sür seinen Sorgenstuhl ganz bestimmte
Maßeinheiten haben muß, um für Kopf,
Rücken, Unterarm und Schenkel auch nur
leidliche Stützpunkte zu finden. Geradeso
ist es mit dem Schablonen-Schreibsessel be-
stellt, der in, Verein mit dem unpraktischen
Schreibtisch schon vielen eine eingesunkene
Brust, Hängeschultern und Kurzsichtigkeit
aufgezwungen hat. Für solche Sitzmöbel
darf nur eine ganz bestimmte Persönlich-
keit: die des späteren Benutzers maß-
bestimmend sein.
Die Schrankgefache, Buffet- und Kredenz-
größen werden ebenfalls stiefmütterlich und
willkürlich behandelt. Warum redet die
Hausfrau dabei kein Wort mit: ihrer
Körpergröße, ihren Gewohnheiten, ihren
Leinen-, Tafel- und Gerätbeständen die
nötige Geltung zu verschaffen?! Sie läßt
so manches Stück fallen, weil die Absetz-
platte des Buffets oder der Kredenz zu
hoch — im Gegensinne zu niedrig ist. Die
Höhe dieser Platte, vom Fußboden gerechnet,
sollte stets einige Zentimenter weniger be-
tragen als der in der Höhe des Ellenbogens
wagerecht ausgestreckte Unterarm. Das un-
mäßig hohe Aufbauen der Buffets und
Schränke muß künftig vermieden werden.
Die oberen Gefache sollten immer ohne Zu-
hilfenahme eines Stuhls oder Leiter bequem
mit der ausgestreckten Hand zu erreichen
sein. Auch über das Unterbringen von
bestimmten Gegenständen sollte sich die Haus-
frau vorher mit dem Architekten oder Hand-
werker einigen; sie würde dann mehr Freude
an ihren Möbeln haben durch Pie augen-
fällige Zweckmäßigkeit. Viel Ärger und
Arbeit würde der Hausftau dadurch erspart
bleiben, denn Geräte, die das Speisezimmer
in Verwahr zu nehmen hat, müssen auch
hier gut untergebracht werden können, und
gehören dann nicht wegen Fehlens geeigneter
Gefache in das Wohnzimmer oder gar in
die Küche. Mit den Zier-, Bücher- und
Leinenschränken ist es nicht besser bestellt.
Vielleicht geben diese Zeilen mancher tüchtigen
Hausftau zu denken, um hieran weitere
praktische Ergänzungen zu fügen.
Palrnbrihrr (Nr. 3)
namentlich das
Beispiel der Herr-
scher maßgebend
sein mochte. Die
somit begründete
Annahme, wornach
die Verbreitung des
Knüpsteppichs in
Westasien auf die
transoxanischen
Nomadenstämme
zurückzuführen
wäre, erscheint auch
ganz wesentlich un-
terstützt, wenn wir
in Betracht ziehen,
welche Rolle diese
Nomaden in der
heutigen orientali-
schen Teppichpro-
duktion spielen. Die
in den heimatlichen
Steppen zurückge-
bliebenen Tartaren
sind nämlich bis
zum heutigen Tage
oie tüchtigsten Tep-
pichknüpfer geblieben. Die Teppiche der
turkmenischen Nomaden zählen zu dem weit-
aus Besten, was heute noch im Orient ge-
knüpft wird. In diesem Lichte betrachtet
gewinnt auch der Umstand, daß Persien zu
der vornehmsten Rolle in der Geschichte der
orientalischen Teppichknüpserei berufen war,
eine ungezwungene Erklärung. Das an den
Oxus grenzende iranische Reich mußte seit
Anbeginn am häufigsten und intensivsten
die Einflüsse der Turko-Tarlaren und der
Nomaden überhaupt erfahren haben; die
erste Herrschaft, die diese in Westasien be-
gründet haben, die Partherherrschaft, war
wesentlich auf persischem Boden errichtet."
Heute ist der Knüpsteppich überall da
zu Hause, wo die Sitzmöbel fehlen, also im
ganzen Bereiche des Islam. Wir treffen
ihn in vorzüglicher Schönheit in Persien,
dann in Zentralasien: bei den Turkmenen,
in Beludschistan, in Bokhara; er wird ge-
fertigt im Kaukasus, in Kleinasien, Syrien,
in Marokko, dann in Griechenland, Bosnien,
Serbien, Rumänien, Bulgarien.
Die Unterscheidung der einzelnen Arten
von einander ist nicht immer leicht, wenn
auch einzelne Eigentümlichkeiten bestimmt
austreten. Erschwert wird die allgemeine
Unterscheidung noch dadurch, daß im Handel
die Teppiche meistens nach den Hafenorten,
von denen aus sie ausgesührt werden, ge-
nannt werden,
ohne Rücksicht auf
ihren Entsteh-
ungsort. Ein sol-
cher allgemeiner
Name ist z. B. der
Smyrnateppich,
der aus den ver-
schiedensten Orten
stammt. Über diese
Teppiche hatJ.M.
Stöckel in
Smyrna in der
österr. Zeitschrift
für den Orient
1891 Nr. 2 eine
interessante Ab-
handlung ver-
öffentlicht, der wir jSalenbechrr (Nr. 4)
entnehmen, daß Von Gabriel Hermeling,
solche Teppiche da- kgl. Hofgoldschmied in Köln
selbst pro gm 16—25 Francs kosten. —
Da die orientalische Teppichknüpserei so
unendlich einfach ist, so wurde sie auch bei
uns Angeführt. Fabriken bestehen in
Schmiedebera, in Maffersdorf bei Reichen-
berg in Böhmen und anderswo; man wollte
diese Technik sogar für die Hausindustrie
verwenden. Der Ausbreitung dieser Industrie
bei uns steht aber der Umstand entgegen,
daß bei der Bedürfnislosigkeit der Orientalen
und dem billigen Bezug ihres Rohmaterials
die orientalischen Teppiche immer noch billiger
als unsere einheimischen sind. Allerdings
ist die billigste orientalische Waare, die bei
uns verkauft wird, eine solche, die im Orient
selbst keine Verwendung oder wenigstens
keine Wertschätzung findet, nemlich solche
Teppiche, die an der einen Seite schmäler
als an der andern sind, die, wie der Orientale
sagt, nicht regelrecht und gut gearbeitet sind.
Der orientalische Knüpsteppich ist heute
ein bevorzugtes Kind der Mode bei Zimmer-
einrichtungen. Seine Verwendung findet
aber in den seltensten Fällen so statt, daß
die Kritik dagegen nichts einzuwenden hätte.
Da er von Haus aus stellvertretend sür
Sitzmöbel ist, so fügt er sich schlecht in
unsere mit Tischen, Stühlen, Schränken,
Truhen und Kästen gefüllten Räume ein.
Die nackten hölzernen Stuhl- und Tischbeine
drücken Löcher in denselben, das Herum-
tteten mit Stiefeln und Schuhen auf dem-
selben ist eine Entwürdigung seiner Ge-
schichte und Bestimmung. Der Orientale
zieht bekanntlich zuvor die Schuhe aus.
Einigermaßen vereinbar mit unserer
modernen Einrichtung ist der orientalische
Knüpsteppich nur dann, wenn er so wenig
als möglich mit Möbeln bestellt und mit
solchen Einrichtungsgegenständen zusammen-
gebracht wird, die als reine Tapezierarbeit
keine nackten Holzbeine und sonstige Holz-
stützen zeigen.
Über -Matz- und GrötzenvcrhLllnisft der
Möbel
von Dtto Schulze (Aöln)
ie sogenannte Maßanfertigung von
Kleidern und Schuhzeug für den Körper
eines bestimmten Bestellers ist seit undenk-
lichen Zeiten Sitte. — Hierbei wird der
Eigenliebe des Bestellers jede gewünschte
Konzession gemacht, um guten „Sitz", Be-
quemlichkeit und eine gewisse Eleganz zu
ermöglichen.
Möbel und Einrichtungsstücke werden
heute ebenfalls in großer Zahl auf Sonder-
bestellung angefertigt; natürlich nach Skizzen,
die bestechend gezeichnet und in der Fertig-
stellung das Möbel als Luxusmöbel ver-
raten. Auf Maßskizzen verstehen sich nur
wenige, und so kommt es, daß manches
Möbel den Platz nicht verdient, den es aus-
füllen soll, und zwar aus Gründen, die vor
der Anfertigung verblüffend klar — jedoch
unbeachtet aus der Hand lagen. — Daß
ein Speisetisch, der für achtzehn Personen
bestimmt ist, nur mit aller Mühe und Ein-
schränkung unter Gefährdung der Kniee an
den Tischbeinen für fünfzehn und eine halbe
Person zu verwenden ist, hat die Hausfrau
so gut verschuldet als der zeichnende Architekt
oder der ausführende Handwerker. Man
sollte sich eben vorher vergegenwärtigen, wie
viel Platz ein essender Gast, dem das Essen
dann auch ein Vergnügen sein soll, unbe-
dingt haben muß, ohne von Nachbarn sowenig
-1
als durch das Servieren belästigt zu werden,
wie das fast stets in aller Gemütlichkeit bei
der Table d'höte auf den Rheindampfern
in der Saison geschieht. Oft beträgt die
Länge der dem Gast zugewiesenen Tischfläche
nicht mehr als Stuhlbreite, also etwa 45
bis 48 cm, während ein „Allgemeines Wohl-
befinden" bei Tisch mindestens 65 bis 70 cm
bei etwa 48 bis 52 cm bis Tischmitte
fordert. So die Plätze angeordnet, läuft
man nicht Gefahr: auf dem Tisch mit dem
j Ziergerät, Fruchtschalen, Gläsern — unter
dem Tisch mit den Füßen und Kleidern
vom Gegenüber oder der Nachbarin zu
kollidieren. Die bisher übliche Höhe der
Tische mit 76, 78, auch selbst 80 cm ist
ausreichend. Die Normalgröße der Stühle
entspricht durchschnittlich allen Anforderungen,
mit Ausnahme der Sorgen- und Schreib-
stühle, die für die, die damit meistens als
Beschenkte beglückt werden, reinste Quäl-
und Marterstühle sind. Derartige Stücke
sollten stets nach dem Maß ihrer späteren
„Besitzer" gefertigt werden. Weshalb hat
die sonst so aufmerksame Hausfrau nicht
achtgegeben, daß der Großvater, dessen
Bein- und Rückenlänge in sich zurückgegangen
ist, sür seinen Sorgenstuhl ganz bestimmte
Maßeinheiten haben muß, um für Kopf,
Rücken, Unterarm und Schenkel auch nur
leidliche Stützpunkte zu finden. Geradeso
ist es mit dem Schablonen-Schreibsessel be-
stellt, der in, Verein mit dem unpraktischen
Schreibtisch schon vielen eine eingesunkene
Brust, Hängeschultern und Kurzsichtigkeit
aufgezwungen hat. Für solche Sitzmöbel
darf nur eine ganz bestimmte Persönlich-
keit: die des späteren Benutzers maß-
bestimmend sein.
Die Schrankgefache, Buffet- und Kredenz-
größen werden ebenfalls stiefmütterlich und
willkürlich behandelt. Warum redet die
Hausfrau dabei kein Wort mit: ihrer
Körpergröße, ihren Gewohnheiten, ihren
Leinen-, Tafel- und Gerätbeständen die
nötige Geltung zu verschaffen?! Sie läßt
so manches Stück fallen, weil die Absetz-
platte des Buffets oder der Kredenz zu
hoch — im Gegensinne zu niedrig ist. Die
Höhe dieser Platte, vom Fußboden gerechnet,
sollte stets einige Zentimenter weniger be-
tragen als der in der Höhe des Ellenbogens
wagerecht ausgestreckte Unterarm. Das un-
mäßig hohe Aufbauen der Buffets und
Schränke muß künftig vermieden werden.
Die oberen Gefache sollten immer ohne Zu-
hilfenahme eines Stuhls oder Leiter bequem
mit der ausgestreckten Hand zu erreichen
sein. Auch über das Unterbringen von
bestimmten Gegenständen sollte sich die Haus-
frau vorher mit dem Architekten oder Hand-
werker einigen; sie würde dann mehr Freude
an ihren Möbeln haben durch Pie augen-
fällige Zweckmäßigkeit. Viel Ärger und
Arbeit würde der Hausftau dadurch erspart
bleiben, denn Geräte, die das Speisezimmer
in Verwahr zu nehmen hat, müssen auch
hier gut untergebracht werden können, und
gehören dann nicht wegen Fehlens geeigneter
Gefache in das Wohnzimmer oder gar in
die Küche. Mit den Zier-, Bücher- und
Leinenschränken ist es nicht besser bestellt.
Vielleicht geben diese Zeilen mancher tüchtigen
Hausftau zu denken, um hieran weitere
praktische Ergänzungen zu fügen.
Palrnbrihrr (Nr. 3)