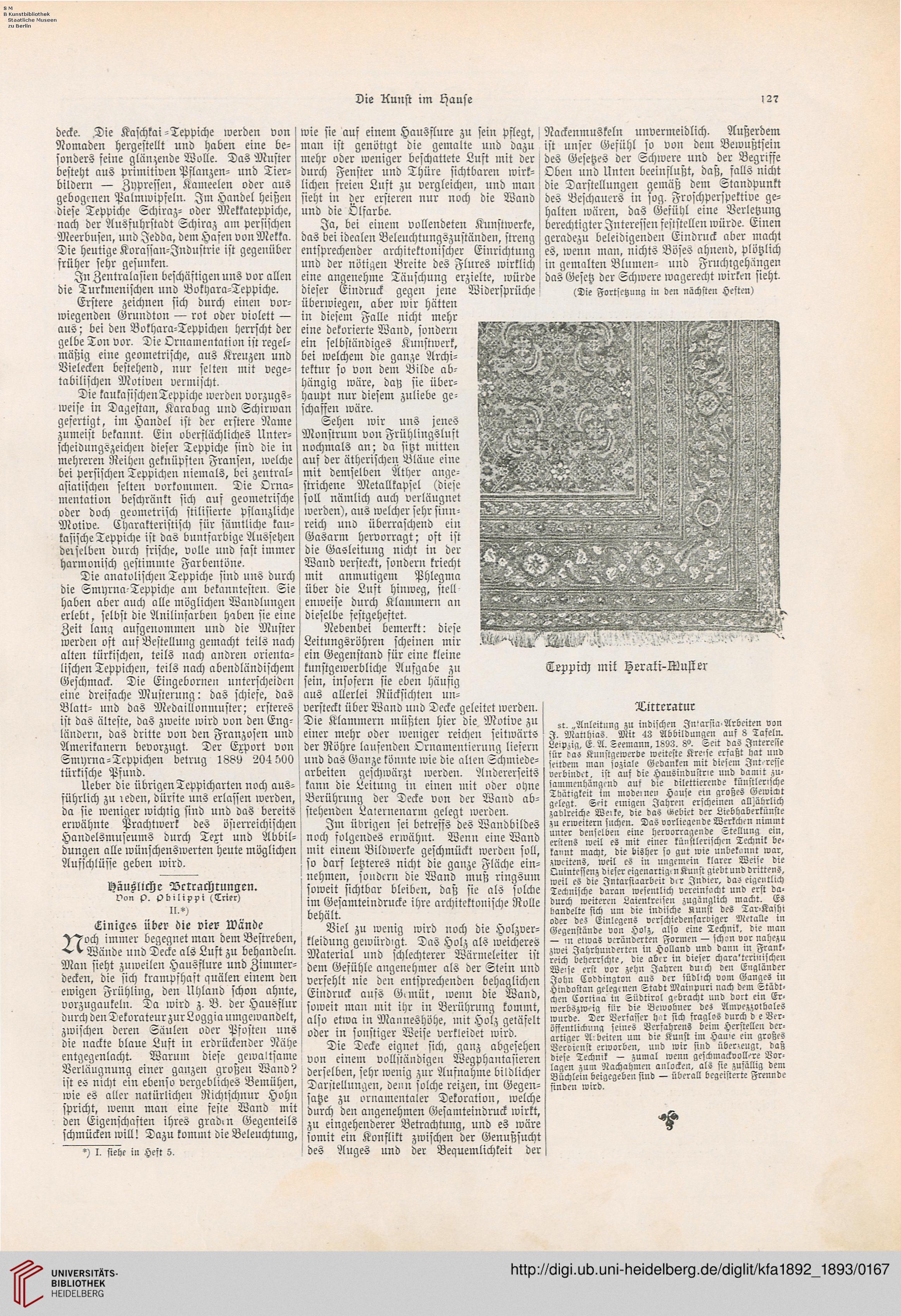Die Kunst im Hause
>27
decke. .Die Kaschkai-Teppiche werden von
Nomaden hergestellt und haben eine be-
sonders feine glänzende Wolle. Das Muster
besteht aus primitiven Pflanzen- und Tier-
bildern — Zypressen, Kameelen oder aus
gebogenen Palmwipfeln. Im Handel heißen
diese Teppiche Schiraz- oder Mekkaleppiche,
nach der Ausfuhrstadt Schiraz am persischen
Meerbusen, nnd Jedda, dem Hafen von Mekka.
Die heutige Korassan-Jndustrie ist gegenüber
früher sehr gesunken.
In Zentralasien beschäftigen uns vor allen
die Turkmenischen und Bokhara-Teppiche.
Elftere zeichnen sich durch einen vor-
wiegenden Grundton — rot oder violett —
aus; bei den Bokhara-Teppichen herrscht der
gelbe Ton vor. Die Lrnamentation ist regel-
mäßig eine geometrische, aus Kreuzen und
Vielecken bestehend, nur selten mit vege-
tabilischen Motiven vermischt.
Die kaukasischenTeppiche werden vorzugs-
weise in Dagestan, Karabag und Schirwan
gefertigt, im Handel ist der elftere Name
zumeist bekannt. Ein oberflächliches Unter-
scheidungszeichen dieser Teppiche sind die in
mehreren Reihen geknüpften Fransen, welche
bei persischen Teppichen niemals, bei zentral-
asiatischen selten Vorkommen. Die Orna-
mentation beschränkt sich auf geometrische
oder doch geometrisch stilisierte pflanzliche
Motive. Charakteristisch für sämtliche kau-
kasische Teppiche ist das buntfarbige Aussehen
derselben durch frische, volle und säst immer
harmonisch gestimmte Farbentöne.
Tie anatolischen Teppiche sind uns durch
die Smyrna-Teppiche am bekanntesten. Sie
haben aber auch alle möglichen Wandlungen
erlebt, selbst die Anilinfarben haben sie eine
Zeit lang ausgenommen und die Muster
werden oft auf Bestellung gemacht teils nach
alten türkischen, teils nach andren orienta-
lischen Teppichen, teils nach abendländischem
Geschmack. Die Eingebornen unterscheiden
eine dreifache Musterung: das schiefe, das
Blatt- und das Medaillonmuster; elfteres
ist das älteste, das zweite wird von den Eng-
ländern, das dritte von den Franzosen und
Amerikanern bevorzugt. Der Export von
Smyrna-Teppichen betrug 1880 204 500
türkische Pfund.
Ueber die übrigenTepPicharten noch aus-
sührlich zu reden, dürfte uns erlassen werden,
da sie weniger wichtig sind und das bereits
erwähnte Prachtwerk des österreichischen
Handelsmuseums durch Text und Abbil-
dungen alle wünschenswerten heute möglichen
Aufschlüsse geben wird.
tzgupliche Vrlrachrungen.
ii.»)
Einiges Uber die vier wände
>"Toch immer begegnet man dem Bestreben,
Wände und Decke als Luft zu behandeln.
Man sieht zuiveilen Hausflure und Zimmer-
decken, die sich krampshast quälen einem den
ewigen Frühling, den Uhland schon ahnte,
vorzugaukeln. Ta wird z. B. der Hausflur
durch den Dekorateur zur Loggia umgewandelt,
zwischen deren Säulen oder Pfosten uns
die nackte blaue Luft in erdrückender Nähe
entgegcnlacht. Warum diese gewaltsame
Verläugnung einer ganzen großen Wand?
ist es nicht ein ebenso vergebliches Bemühen,
wie es aller natürlichen Richtschnur Hohn
spricht, wenn man eine feste Wand mit
den Eigenschaften ihres grainn Gegenteils
schmücken will! Dazu kommt die Beleuchtung,
*) I. siehe in Heft 5.
wie sie auf einem Haussture zu sein Pflegt,
man ist genötigt die gemalte und dazu
mehr oder weniger beschattete Lust mit der
durch Fenster und Thüre sichtbaren wirk-
lichen freien Lust zu vergleichen, und man
sieht in der ersteren nur noch die Wand
und die Ölfarbe.
Ja, bei einem vollendeten Kunstwerke,
das bei idealen Beleuchtungszuständen, streng
entsprechender architektonischer Einrichtung
und der nötigen Breite des Flures wirklich
eine angenehme Täuschung erzielte, würde
dieser Eindruck gegen jene Widersprüche
überwiegen, aber wir hätten
in diesem Falle nicht mehr
eine dekorierte Wand, sondern
ein selbständiges Kunstwerk,
bei welchem die ganze Archi-
tektur so von dem Bilde ab-
hängig wäre, daß sie über-
haupt nur diesem zuliebe ge-
schaffen wäre.
Sehen wir uns jenes
Monstrum von Frühlingsluft
nochmals an; da sitzt mitten
auf der ätherischen Bläue eine
mit demselben Äther ange-
strichene Metallkapsel (diese
soll nämlich auch verläugnet
werden), aus welcher sehr sinn-
reich und überraschend ein
Gasarm hervorragt; oft ist
die Gasleitung nicht in der
Wand versteckt, sondern kriecht
mit anmutigem Phlegma
über die Luft hinweg, stell
enweise durch Klammem an
dieselbe festgeheftet.
Nebenbei bemerkt: diese
Leitungsröhren scheinen mir
ein Gegenstand für eine kleine
kunstgewerbliche Aufgabe zu
sein, insofern sie eben häufig
aus allerlei Rücksichten un-
versteckt über Wand und Decke geleitet werden.
Die Klammem müßten hier die Motive zu
einer mehr oder weniger reichen seitwärts
der Röhre lausenden Omamentierung liefern
und das Ganze könnte wie die alten Schmiede-
arbeiten geschwärzt werden. Andererseits
kann die Leitung in einen mit oder ohne
Berührung der Decke von der Wand ab-
stehenden Laiemenarm gelegt werden.
Im übrigen sei betreffs des Wandbildes
noch folgendes erwähnt. Wenn eine Wand
mit einem Bildwerke geschmückt werden soll,
so darf letzteres nicht die ganze Fläche ein-
uehmen, sondern die Wand muß ringsum
soweit sichtbar bleiben, daß sie als solcke
im Gesamteindrucke ihre architektonische Rolle
behält.
Viel zu wenig wird noch die Holzver-
kleidung gewürdigt. Das Holz als weicheres
Material und schlechterer Wärmeleiter ist
dem Gefühle angenehmer als der Stein und
verfehlt nie den entsprechenden behaglichen
Eindruck auss Gmrüt, wenn die Wand,
! soweit man mit ihr in Berührung kommt,
^ also etwa in Manneshöhe, mit Holz getäfelt
^ oder in sonstiger Weise verkleidet wird.
Die Decke eignet sich, ganz abgesehen
von einem vollständigen Wegphantasieren
derselben, sehr wenig zur Aufnahme bildlicher
! Darstellungen, denn solche reizen, im Gegen-
sätze zu ornamentaler Dekoration, welche
durch den angenehmen Gesamteindmck wirkt,
zu eingehenderer Betrachtung, und es wäre
somit ein Konflikt zwischen der Genußsucht
! des Auges und der Bequemlichkeit der
Nackenmuskeln unvermeidlich. Außerdem
ist unser Gefühl so von dem Bewußtsein
des Gesetzes der Schwere und der Begriffe
Oben und Unten beeinflußt, daß^falls nicht
die Darstellungen gemäß dem Standpunkt
des Beschauers in sog. Froschperspektive ge-
halten wären, das Gefühl eine Verletzung
berechtigter Interessen feststellen würde. Einen
geradezu beleidigenden Eindruck aber macht
es, wenn man, nichts Böses ahnend, plötzlich
in gemalten Blumen- und Fruchigehängen
das Gesetz der Schwere wagerecht wirken sieht.
(Die Fortsetzung in den nächsten Heften)
...: .
Teppich mit Hersti-Wuster
Lillersrur
-t, „Anleitung zu indischen Intarsia Arbeiten von
I. Matthias. Mit 43 Abbildungen aus 8 Tafeln.
Leipzig, E A. Seemann, 1893. 8°. Seit das Interesse
sür das Kunstgewerbe weiteste Krege erfaßt hat und
seitdem man soziale Gedanken mit diesem Int resse
verbindet, ist aus die Hausindustrie und damit zu-
sammenhängend auf die bilettierende künstlereiche
Tbätigkeit im mode, ne» Hause ein großes Gewicht
gelegt. Seit einigen Jahren erscheinen alljährlich
zablreiche Weile, die das Gebiet der Liebhaberkünste
zu erweitern suchen. Das vorliegende Merkchen nimmt
unter denselben eine hervorragende Stellung ein,
erstens weil es mit einer künstlerischen Technik be-
kannt macht, die bisher so gut wie unbekannt war,
zweitens, weil es in ungemein klarer Weise die
Quintessenz dieser eigenartig,!! Kunst giebtund drittens,
weil es die Jntarsiaarbeit dir Indier, das eigentlich
Technische daran wesentlich vereinsacht und erst da-
durch weiteren Laienkreisen zugänglich macht. Es
bandelte sich NM die indische Kunst des nar-Kashi
oder des Einlegens verschiedenfarbiger Metalle in
Gegenstände von Holz, also eine Technik, die man
— !N etwas veränderten Formen — schon vor nahezu
zwei Jahrhunderten in Holland und dann in Frank-
reich beherrschte, die aber in dieser chara'terinischen
We-se erst vor zehn Jahren durch den Engländer
Job» Coddington aus der südlich vom Ganges in
Hindostan gelegenen Stadt Mainpuri nach dem Städt-
chen Cortina in Südtirol gebracht und dort ein Er-
werbszweig sür die Bewohner des Amvezzothales
wurde. Der Versager h. t sich sraglos durch d e Ver-
öffentlichung seines Verfahrens beim Herstellen der-
artiger A. beiten um die Kunst im Haute ein großes
Verdienst erworben, nnd wir sind überzeugt, daß
diese Technik — zumal wenn geschmackvollere Vor-
lagen zum Nachahmen anlocken, als sie zusällig dem
Büchlein beigegeben sind — überall begeisterte Frennde
finden wird.
>27
decke. .Die Kaschkai-Teppiche werden von
Nomaden hergestellt und haben eine be-
sonders feine glänzende Wolle. Das Muster
besteht aus primitiven Pflanzen- und Tier-
bildern — Zypressen, Kameelen oder aus
gebogenen Palmwipfeln. Im Handel heißen
diese Teppiche Schiraz- oder Mekkaleppiche,
nach der Ausfuhrstadt Schiraz am persischen
Meerbusen, nnd Jedda, dem Hafen von Mekka.
Die heutige Korassan-Jndustrie ist gegenüber
früher sehr gesunken.
In Zentralasien beschäftigen uns vor allen
die Turkmenischen und Bokhara-Teppiche.
Elftere zeichnen sich durch einen vor-
wiegenden Grundton — rot oder violett —
aus; bei den Bokhara-Teppichen herrscht der
gelbe Ton vor. Die Lrnamentation ist regel-
mäßig eine geometrische, aus Kreuzen und
Vielecken bestehend, nur selten mit vege-
tabilischen Motiven vermischt.
Die kaukasischenTeppiche werden vorzugs-
weise in Dagestan, Karabag und Schirwan
gefertigt, im Handel ist der elftere Name
zumeist bekannt. Ein oberflächliches Unter-
scheidungszeichen dieser Teppiche sind die in
mehreren Reihen geknüpften Fransen, welche
bei persischen Teppichen niemals, bei zentral-
asiatischen selten Vorkommen. Die Orna-
mentation beschränkt sich auf geometrische
oder doch geometrisch stilisierte pflanzliche
Motive. Charakteristisch für sämtliche kau-
kasische Teppiche ist das buntfarbige Aussehen
derselben durch frische, volle und säst immer
harmonisch gestimmte Farbentöne.
Tie anatolischen Teppiche sind uns durch
die Smyrna-Teppiche am bekanntesten. Sie
haben aber auch alle möglichen Wandlungen
erlebt, selbst die Anilinfarben haben sie eine
Zeit lang ausgenommen und die Muster
werden oft auf Bestellung gemacht teils nach
alten türkischen, teils nach andren orienta-
lischen Teppichen, teils nach abendländischem
Geschmack. Die Eingebornen unterscheiden
eine dreifache Musterung: das schiefe, das
Blatt- und das Medaillonmuster; elfteres
ist das älteste, das zweite wird von den Eng-
ländern, das dritte von den Franzosen und
Amerikanern bevorzugt. Der Export von
Smyrna-Teppichen betrug 1880 204 500
türkische Pfund.
Ueber die übrigenTepPicharten noch aus-
sührlich zu reden, dürfte uns erlassen werden,
da sie weniger wichtig sind und das bereits
erwähnte Prachtwerk des österreichischen
Handelsmuseums durch Text und Abbil-
dungen alle wünschenswerten heute möglichen
Aufschlüsse geben wird.
tzgupliche Vrlrachrungen.
ii.»)
Einiges Uber die vier wände
>"Toch immer begegnet man dem Bestreben,
Wände und Decke als Luft zu behandeln.
Man sieht zuiveilen Hausflure und Zimmer-
decken, die sich krampshast quälen einem den
ewigen Frühling, den Uhland schon ahnte,
vorzugaukeln. Ta wird z. B. der Hausflur
durch den Dekorateur zur Loggia umgewandelt,
zwischen deren Säulen oder Pfosten uns
die nackte blaue Luft in erdrückender Nähe
entgegcnlacht. Warum diese gewaltsame
Verläugnung einer ganzen großen Wand?
ist es nicht ein ebenso vergebliches Bemühen,
wie es aller natürlichen Richtschnur Hohn
spricht, wenn man eine feste Wand mit
den Eigenschaften ihres grainn Gegenteils
schmücken will! Dazu kommt die Beleuchtung,
*) I. siehe in Heft 5.
wie sie auf einem Haussture zu sein Pflegt,
man ist genötigt die gemalte und dazu
mehr oder weniger beschattete Lust mit der
durch Fenster und Thüre sichtbaren wirk-
lichen freien Lust zu vergleichen, und man
sieht in der ersteren nur noch die Wand
und die Ölfarbe.
Ja, bei einem vollendeten Kunstwerke,
das bei idealen Beleuchtungszuständen, streng
entsprechender architektonischer Einrichtung
und der nötigen Breite des Flures wirklich
eine angenehme Täuschung erzielte, würde
dieser Eindruck gegen jene Widersprüche
überwiegen, aber wir hätten
in diesem Falle nicht mehr
eine dekorierte Wand, sondern
ein selbständiges Kunstwerk,
bei welchem die ganze Archi-
tektur so von dem Bilde ab-
hängig wäre, daß sie über-
haupt nur diesem zuliebe ge-
schaffen wäre.
Sehen wir uns jenes
Monstrum von Frühlingsluft
nochmals an; da sitzt mitten
auf der ätherischen Bläue eine
mit demselben Äther ange-
strichene Metallkapsel (diese
soll nämlich auch verläugnet
werden), aus welcher sehr sinn-
reich und überraschend ein
Gasarm hervorragt; oft ist
die Gasleitung nicht in der
Wand versteckt, sondern kriecht
mit anmutigem Phlegma
über die Luft hinweg, stell
enweise durch Klammem an
dieselbe festgeheftet.
Nebenbei bemerkt: diese
Leitungsröhren scheinen mir
ein Gegenstand für eine kleine
kunstgewerbliche Aufgabe zu
sein, insofern sie eben häufig
aus allerlei Rücksichten un-
versteckt über Wand und Decke geleitet werden.
Die Klammem müßten hier die Motive zu
einer mehr oder weniger reichen seitwärts
der Röhre lausenden Omamentierung liefern
und das Ganze könnte wie die alten Schmiede-
arbeiten geschwärzt werden. Andererseits
kann die Leitung in einen mit oder ohne
Berührung der Decke von der Wand ab-
stehenden Laiemenarm gelegt werden.
Im übrigen sei betreffs des Wandbildes
noch folgendes erwähnt. Wenn eine Wand
mit einem Bildwerke geschmückt werden soll,
so darf letzteres nicht die ganze Fläche ein-
uehmen, sondern die Wand muß ringsum
soweit sichtbar bleiben, daß sie als solcke
im Gesamteindrucke ihre architektonische Rolle
behält.
Viel zu wenig wird noch die Holzver-
kleidung gewürdigt. Das Holz als weicheres
Material und schlechterer Wärmeleiter ist
dem Gefühle angenehmer als der Stein und
verfehlt nie den entsprechenden behaglichen
Eindruck auss Gmrüt, wenn die Wand,
! soweit man mit ihr in Berührung kommt,
^ also etwa in Manneshöhe, mit Holz getäfelt
^ oder in sonstiger Weise verkleidet wird.
Die Decke eignet sich, ganz abgesehen
von einem vollständigen Wegphantasieren
derselben, sehr wenig zur Aufnahme bildlicher
! Darstellungen, denn solche reizen, im Gegen-
sätze zu ornamentaler Dekoration, welche
durch den angenehmen Gesamteindmck wirkt,
zu eingehenderer Betrachtung, und es wäre
somit ein Konflikt zwischen der Genußsucht
! des Auges und der Bequemlichkeit der
Nackenmuskeln unvermeidlich. Außerdem
ist unser Gefühl so von dem Bewußtsein
des Gesetzes der Schwere und der Begriffe
Oben und Unten beeinflußt, daß^falls nicht
die Darstellungen gemäß dem Standpunkt
des Beschauers in sog. Froschperspektive ge-
halten wären, das Gefühl eine Verletzung
berechtigter Interessen feststellen würde. Einen
geradezu beleidigenden Eindruck aber macht
es, wenn man, nichts Böses ahnend, plötzlich
in gemalten Blumen- und Fruchigehängen
das Gesetz der Schwere wagerecht wirken sieht.
(Die Fortsetzung in den nächsten Heften)
...: .
Teppich mit Hersti-Wuster
Lillersrur
-t, „Anleitung zu indischen Intarsia Arbeiten von
I. Matthias. Mit 43 Abbildungen aus 8 Tafeln.
Leipzig, E A. Seemann, 1893. 8°. Seit das Interesse
sür das Kunstgewerbe weiteste Krege erfaßt hat und
seitdem man soziale Gedanken mit diesem Int resse
verbindet, ist aus die Hausindustrie und damit zu-
sammenhängend auf die bilettierende künstlereiche
Tbätigkeit im mode, ne» Hause ein großes Gewicht
gelegt. Seit einigen Jahren erscheinen alljährlich
zablreiche Weile, die das Gebiet der Liebhaberkünste
zu erweitern suchen. Das vorliegende Merkchen nimmt
unter denselben eine hervorragende Stellung ein,
erstens weil es mit einer künstlerischen Technik be-
kannt macht, die bisher so gut wie unbekannt war,
zweitens, weil es in ungemein klarer Weise die
Quintessenz dieser eigenartig,!! Kunst giebtund drittens,
weil es die Jntarsiaarbeit dir Indier, das eigentlich
Technische daran wesentlich vereinsacht und erst da-
durch weiteren Laienkreisen zugänglich macht. Es
bandelte sich NM die indische Kunst des nar-Kashi
oder des Einlegens verschiedenfarbiger Metalle in
Gegenstände von Holz, also eine Technik, die man
— !N etwas veränderten Formen — schon vor nahezu
zwei Jahrhunderten in Holland und dann in Frank-
reich beherrschte, die aber in dieser chara'terinischen
We-se erst vor zehn Jahren durch den Engländer
Job» Coddington aus der südlich vom Ganges in
Hindostan gelegenen Stadt Mainpuri nach dem Städt-
chen Cortina in Südtirol gebracht und dort ein Er-
werbszweig sür die Bewohner des Amvezzothales
wurde. Der Versager h. t sich sraglos durch d e Ver-
öffentlichung seines Verfahrens beim Herstellen der-
artiger A. beiten um die Kunst im Haute ein großes
Verdienst erworben, nnd wir sind überzeugt, daß
diese Technik — zumal wenn geschmackvollere Vor-
lagen zum Nachahmen anlocken, als sie zusällig dem
Büchlein beigegeben sind — überall begeisterte Frennde
finden wird.