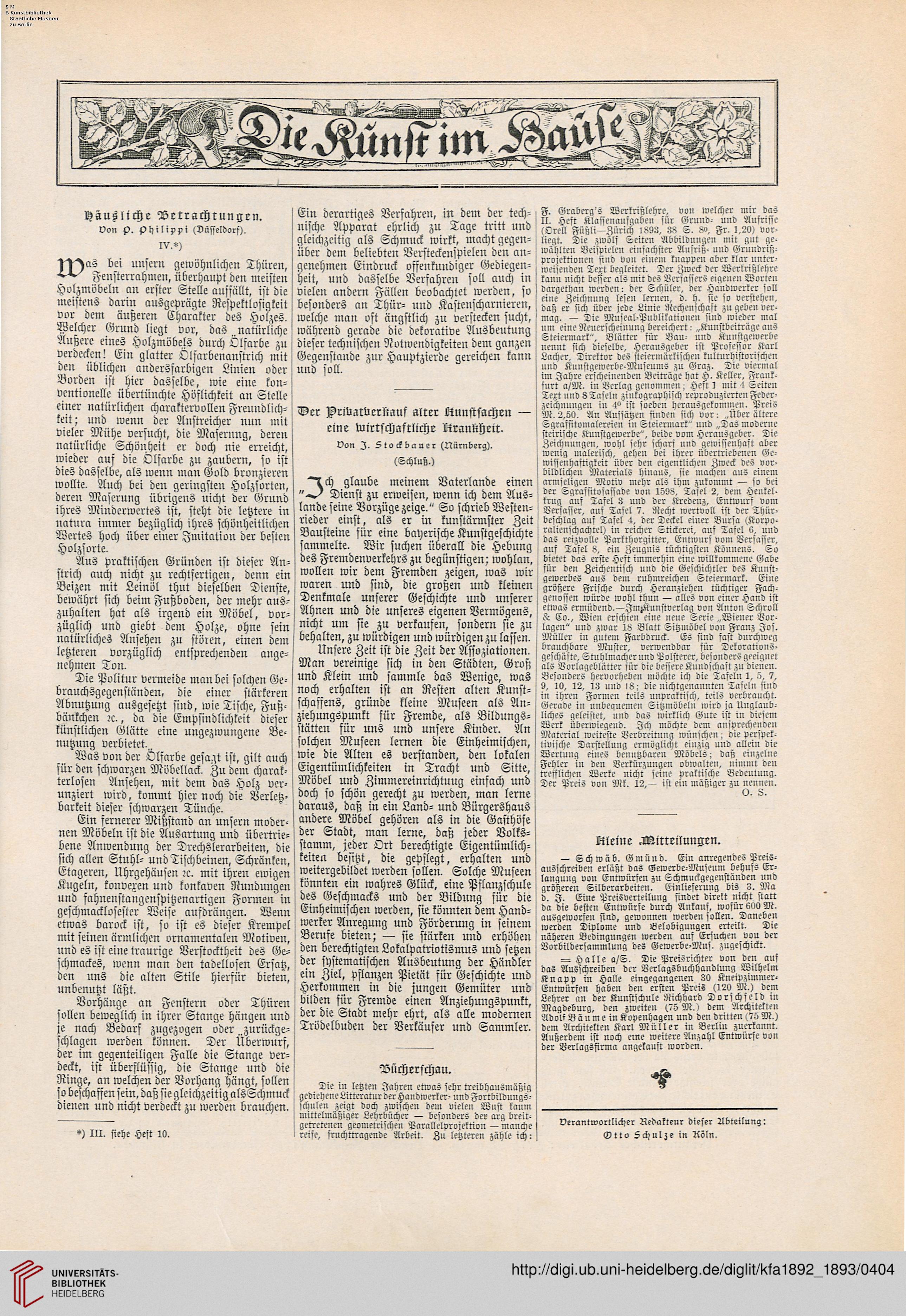HäuKliche Vctrgckjlungcn.
von p. Philippi (Düsseldorf).
IV.*)
bei unfern gewöhnlichen Thuren,
Fensterrahmen, überhaupt den meisten
Holzmöbeln an erster Stelle auffällt, ist die
meistens darin ausgeprägte Respektlosigkeit
vor dem äußeren Charakter des Holzes.
Welcher Grund liegt vor, das „natürliche
Außere eines Holzmöbels durch Ölfarbe zu
verdecken! Ein glatter Ölfarbenanstrich mit
den üblichen andersfarbigen Linien oder
Borden ist hier dasselbe, wie eine kon-
ventionelle übertünchte Höflichkeit au Stelle
einer natürlichen charaktervollen Freundlich-
keit; und wenn der Anstreicher nun mit
vieler Mühe versucht, die Maserung, deren
natürliche Schönheit er doch nie erreicht,
wieder auf die Ölfarbe zu zaubern, so ist
dies dasselbe, als wenn man Gold bronzieren
wollte. Auch bei den geringsten Holzsorten,
deren Maserung übrigens uicht der Grund
ihres Minderwertes ist, steht die letztere in
natura immer bezüglich ihres schönheitlichen
Wertes hoch über einer Imitation der besten
Holzsorte.
Aus praktischen Gründen ist dieser An-
strich auch nicht zu rechtfertigen, denn ein
Beizen mit Leinöl thut dieselben Dienste,
bewährt sich beim Fußboden, der mehr aus-
zuhalten hat als irgend ein Möbel, vor-
züglich und giebt dem Holze, ohne sein
natürliches Ansehen zu stören, einen dem
letzteren vorzüglich entsprechenden ange-
nehmen Ton.
Die Politur vermeide man bei solchen Ge-
brauchsgegenständen, die einer stärkeren
Abnutzung ausgesetzt sind, wie Tische, Fuß-
bänkchen w., da die Empfindlichkeit dieser
künstlichen Glätte eine ungezwungene Be-
nutzung verbietet.,,
Was von der Ölfarbe gesagt ist, gilt auch
für den schwarzen Möbellack. Zu dem charak-
terlosen Ansehen, mit dem das Holz ver-
unziert wird, kommt hiernach die Verletz-
barkeit dieser schwarzen Tünche.
Ein fernerer Mißstand an unfern moder-
nen Möbeln ist die Ausartung und übertrie-
bene Anwendung der Drechslerarbeiten, die
sich alten Stuhl- und Tischbeinen, Schränken,
Etageren, Uhrgehäusen w. mit ihren ewigen
Kugeln, konvexen und konkaven Rundungen
und fahnenstangenspitzenartigen Formen in
geschmacklosester Weise aufdrängen. Wenn
etwas barock ist, so ist es dieser Krempel
mit seinen ärmlichen ornamentalen Motiven,
und es ist eine traurige Verstocktheit des Ge-
schmackes, wenn man den tadellosen Ersatz,
den uns die alten Stile hierfür bieten,
unbenutzt läßt.
Vorhänge an Fenstern oder Thüren
sollen beweglich in ihrer Stange hängen und
je nach Bedarf zugezogen oder „zurückge-
schlagen werden können. Der Überwurf,
der im gegenteiligen Falle die Stange ver-
deckt, ist überflüssig, die Stange und die
Ringe, an welchen der Vorhang hängt, sollen
so beschaffen sein, daß sie gleichzeitig alsSchmuck
dienen und nicht verdeckt zu werden brauchen.
*) III. siehe Heft 10.
Ein derartiges Verfahren, in dem der tech-
nische Apparat ehrlich zu Tage tritt und
gleichzeitig als Schmuck wirkt, macht gegen-
über dem beliebten Versteckenspielen den an-
genehmen Eindruck offenkundiger Gediegen-
heit, und dasselbe Verfahren soll auch in
vielen andern Fällen beobachtet werden, so
besonders an Thür- und Kastenscharnieren,
welche man oft ängstlich zu verstecken sucht,
während gerade die dekorative Ausbeutung
dieser technischen Notwendigkeiten dem ganzen
Gegenstände zur Hauptzierde gereichen kann
und soll.
Ver Vribarverkguf slrer ttunstsscljen —
eine wirtschaftliche l-iranlchcit.
von ). Stockbauer (Nürnberg).
(Schluß.)
^lch glaube meinem Vaterlande einen
) Dienst zu erweisen, wenn ich dem Aus-
landeseine Vorzüge zeige." So schrieb Westen-
rieder einst, als er in kunstärmster Zeit
Bausteine für eine bayerische Kunstgeschichte
sammelte. Wir suchen überall die Hebung
des Fremdenverkehrs zu begünstigen; wohlan,
wollen wir dem Fremden zeigen, was wir
waren und sind, die großen und kleinen
Denkmale unserer Geschichte und unserer
Ahnen und die unseres eigenen Vermögens,
nicht um sie zu verkaufen, sondern sie zu
behalten, zu würdigen und würbigen zu lassen.
Unsere Zeit ist die Zeit der Assoziationen.
Man vereinige sich in den Städten, Groß
und Klein und sammle das Wenige, was
noch erhalten ist an Resten alten Kunst-
schaffens, gründe kleine Museen als An-
ziehungspunkt für Fremde, als Bildungs-
stätten für uns und unsere Kinder. An
solchen Museen lernen die Einheimischen,
wie die Alten es verstanden, den lokalen
Eigentümlichkeiten in Tracht und Sitte,
Möbel und Zimmereinrichtuug einfach unb
doch so schön gerecht zu werden, man lerne
daraus, daß in ein Land- und Bürgershaus
andere Möbel gehören als in die Gasthöfe
der Stadt, man lerne, daß jeder Volks-
stamm, jeder Ort berechtigte Eigentümlich-
keiten besitzt, die gepflegt, erhalten und
weitergebildet werden sollen. Solche Museen
könnten ein wahres Glück, eine Pflanzschule
des Geschmacks und der Bildung für die
Einheimischen werden, sie könnten dem Hand-
werker Anregung und Förderung in seinem
Berufe bieten; — sie stärken und erhöhen
den berechtigten Lokalpatriotismus und setzen
der systematischen Ausbeutung der Händler
ein Ziel, pflanzen Pietät für Geschichte und
Herkommen in die jungen Gemüter und
bilden für Fremde einen Anziehungspunkt,
der die Stadt mehr ehrt, als alle modernen
Trödelbuden der Verkäufer und Sammler.
BülHerschsu.
Tie in letzten Jahren etwas sehr treibhausmäßig
gediehene Litteratur der Handwerker- und Fortbildungs-
schulen zeigt doch zwischen dem vielen Wust kaum
mittelmäßiger Lehrbücher — besonders der arg breit-
getretenen geometrischen Parallelprojektion — manche
reife, fruchttragende Arbeit. Zu letzteren zähle ich:
F. Graberg's Werkrißlehre, von welcher mir das
II. Heft Klassenaufgaben für Grund- und Aufrisse
(Orell Füßli—Zürich 1893, 38 S. 8», Fr. 1,20) vor-
liegt. Die zwölf Seiten Abbildungen mit gut ge-
wählten Beispielen einfachster Aufriß- und Grundriß-
Projektionen sind von einem knappen aber klar unter-
weisenden Text begleitet. Der Zweck der Werkrißlehre
kann nicht besser als mit des Verfassers eigenen Worten
dargethan werden: der Schüler, der Handwerker soll
eine Zeichnung lesen lernen, d. h. sie so verstehen,
daß er sich über jede Linie Rechenschaft zu geben ver-
mag. — Tie Museal-Publikationen sind wieder mal
um eine Neuerscheinung bereichert: „Kunstbeiträge aus
Steiermark", Blätter für Bau- und Kunstgewerbe
nennt sich dieselbe, Herausgeber ist Professor Karl
Lacher. Direktor des steiermärkischen kulturhistorischen
und Kunstgewerbe-Museums zu Graz. Die viermal
im Jahre erscheinenden Beiträge hat H. Keller, Frank-
furt a/M. in Verlag genommen, Heft I mit 4 Seiten
Text und 8 Tafeln zinkographisch reproduzierten Feder-
zeichnungen in 4« ist soeben herausgekommen. Preis
M. 2,50. An Aussätzen finden sich vor: „Über ältere
Sgrasfitomalereien in Steiermark" und „Das moderne
steirische Kunstgewerbe", beide vom Herausgeber. Die
Zeichnungen, wohl sehr scharf und gewissenhaft aber
wenig malerisch, gehen bei ihrer übertriebenen Ge-
wissenhaftigkeit über den eigentlichen Zweck des vor-
bildlichen Materials hinaus, sie machen aus einem
armseligen Motiv mehr als ihm zukommt — so bei
der Sgraffitofassade von 1598, Tafel 2, dem Henkel-
krug auf Tafel 3 und der Kredenz, Entwurf vom
Verfasser, auf Tafel 7. Recht wertvoll ist der Thür-
beschlag auf Tafel 4, der Teckel einer Bursa (Korpo-
ralienschachtel) in reicher Stickerei, auf Tafel 6, und
das reizvolle Parkrhorgitter, Entwurf vom Verfasser,
auf Tafel 8, ein Zeugnis tüchtigsten Könnens. So
bietet das erste Heft immerhin eine willkommene Gabe
für den Zeichentisch und die Geschichtler des Kunst-
gewerbes aus dem ruhmreichen Steiermark. Eine
größere Frische durch Heranziehen tüchtiger Fach-
genossen würde wohl thun — alles von einer Hand ist
etwas ermüdend.—JmzKunstverlag von Anton'Schroll
L Co., Wien erschien eine neue Serie „Wiener Vor-
lagen" und zwar 18 Blatt Sitzmöbel von Franz Jos.
Müller in gutem Farbdruck. Es sind fast durchweg
brauchbare Muster, verwendbar für Tekorations-
geschäfle, Stuhlmacherund Polsterer, besonders geeignet
als Vorlageblätter für die bepere Kundschaft zu dienen.
Besonders hervorheben möchte ich die Tafeln 1, 5, 7,
9, 10, 12, 13 und 18, die nichlgcnannten Tafeln sind
in ihren Formen teils unpraktisch, teils verbraucht.
Gerade in unbequemen Sitzmöbeln wird ja Unglaub-
liches geleistet, und das wirklich Gute ist in diesem
Werk überwiegend. Ich möchte dem ansprechenden
Material weiteste Verbreitung wünschen; die perspek-
tivische Darstellung ermöglicht einzig und allein die
Wertung eines benutzbaren Möbels; daß einzelne
Fehler in den Verkürzungen obwalten, nimmt den
trefflichen Werke nicht seine praktische Bedeutung.
Ter Preis von Mk. 12,— ist ein mäßiger zu nennen.
Meine -Mitteilungen.
— Schwäb. Gmünd. Ein anregendes Preis-
ausschreiben erläßt das Gewerbe-Museum behufs Er-
langung von Entwürfen zu Schmuckgegenständen und
größeren Silberarbeiten. Einlieferung bis 3. Ma
d. I. Eine Preisvcrteilung findet direkt nicht statt
da die besten Entwürfe durch Ankauf, wofür 600 M.
ausgeworfen sind, gewonnen werden sollen. Daneben
werden Diplome und Belobigungen erteilt. Die
näheren Bedingungen werden auf Ersuchen vou der
Vorbildersammlung des Gewerbe-Mus. zugeschickt.
— Halle a/S. Die Preisrichter von den auf
das Ausschreiben der Verlagsbuchhandlung Wilhelm
Knapp in Halle eingegangenen 30 Kneipzimmer-
Entwürfen haben den ersten Preis (120 M.) dem
Lehrer an der Kunstschule Richhard Dorsch seid in
Magdeburg, den zweiten (75 M.) dem Architekten
Adoli Bäumein Kopenhagen und den dritten (75 M.)
dem Architekten Karl Müller in Berlin zuerkannt.
Außerdem ist noch eme weitere Anzahl Entwürfe von
der Verlagsfirma angekauft worden.
Verantwortlicher Redakteur dieser Abteilung:
(Otto Schulze in Köln.