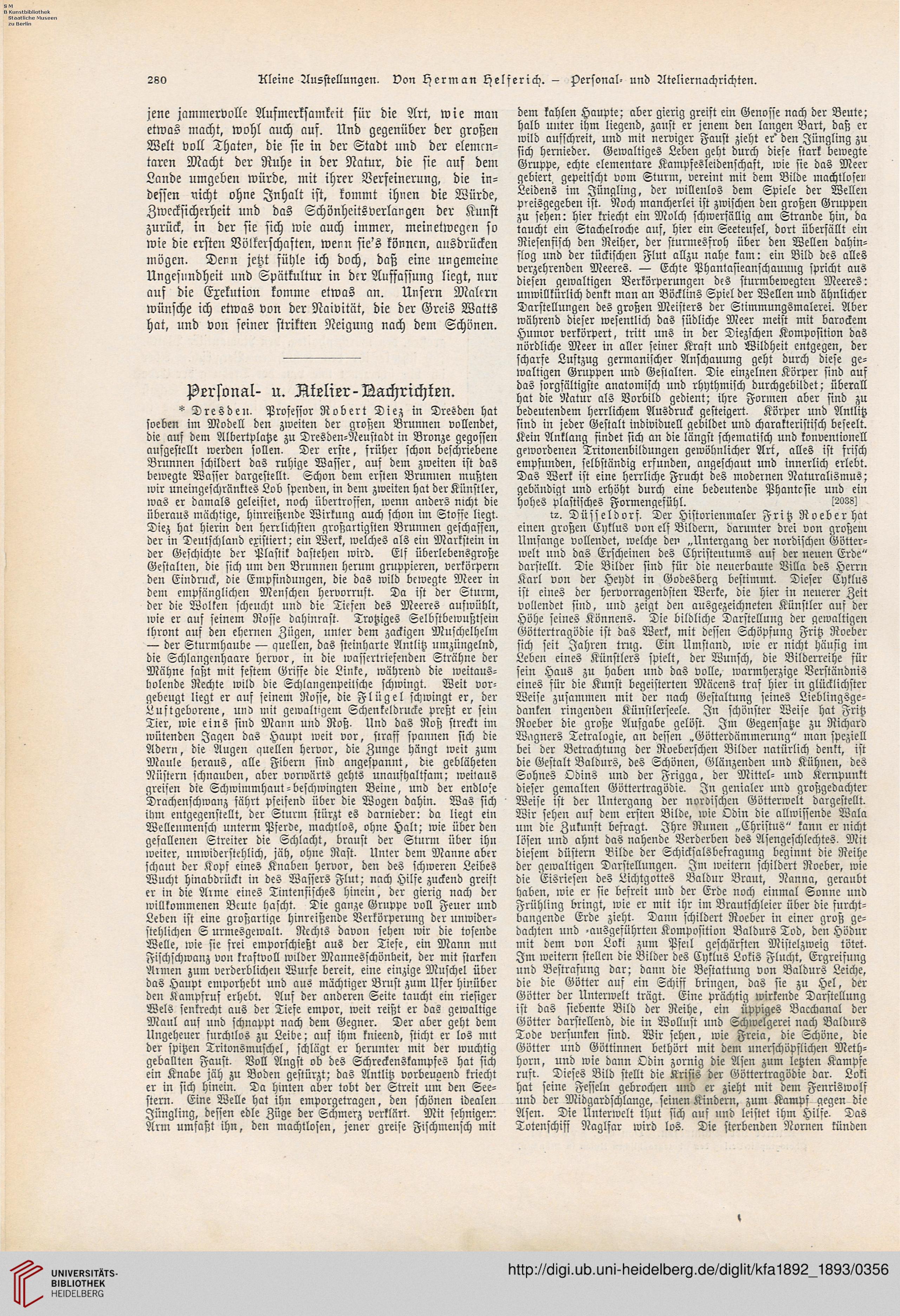280
Kleine Ausstellungen, von kserman kselfericb. - Personal- und Ateliernachrichten.
jene jammervolle Aufmerksamkeit für die Art, wie man
etwas macht, wohl auch auf. Und gegenüber der großen
Welt voll Thaten, die sie in der Stadt und der elemen-
taren Macht der Ruhe in der Natur, die sie auf dem
Lande umgeben würde, mit ihrer Verfeinerung, die in-
dessen nicht ohne Inhalt ist, kommt ihnen die Würde,
Zwccksicherheit und das Schönheitsverlangen der Kunst
zurück, in der sie sich wie auch immer, meinetwegen so
wie die ersten Völkerschaften, wenn sie's können, ausdrücken
mögen. Denn jetzt fühle ich doch, daß eine ungemeine
Ungesnndheit und Spätkultur in der Auffassung liegt, nur
auf die Exekution komme etwas an. Unfern Malern
wünsche ich etwas von der Naivität, die der Greis Watts
hat, und von seiner strikten Neigung nach dem Schönen.
Personal- u. Melier-Nachrichten.
* Dresden. Professor Robert Diez in Dresden hat
soeben im Modell den zweiten der großen Brunnen vollendet,
die auf dem Albertplatze zu Dresden-Neustadt in Bronze gegossen
aufgestellt werden sollen. Der erste, früher schon beschriebene
Brunnen schildert das ruhige Wasser, auf dem zweiten ist das
bewegte Wasser dargestellt. Schon dem ersten Brunnen mußten
wir uneingeschränktes Lob spenden, in dem zweiten hat der Künstler,
was er damals geleistet, noch übertrofsen, wenn anders nicht die
überaus mächtige, hinreißende Wirkung auch schon im Stoffe liegt.
Diez hat hierin den herrlichsten großartigsten Brunnen geschaffen,
der in Deutschland existiert; ein Werk, welches als ein Markstein in
der Geschichte der Plastik dastehen wird. Elf überlebensgroße
Gestalten, die sich um den Brunnen herum gruppieren, verkörpern
den Eindruck, die Empfindungen, die das wild bewegte Meer in
dem empfänglichen Menschen Hervorrust. Da ist der Sturm,
der die Wolken scheucht und die Tiefen des Meeres aufwühlt,
wie er auf seinem Rosse dahinrast. Trotziges Selbstbewußtsein
thront auf den ehernen Zügen, unter dem zackigen Muschelhelm
— der Sturmhaube — quellen, das steinharte Antlitz umzüngelnd,
die Schlangenhaare hervor, in die wasscrlriefenden Strähne der
Mähne faßt mit festem Griffe die Linke, während die weitaus-
holende Rechte wild die Schlangenpeitsche schwingt. Weit vor-
gebeugt liegt er auf seinem Rosse, die Flügel schwingt er, der
Lu st geborene, uns mit gewaltigem Schenkeldrucke preßt er sein
Tier, wie eins sind Mann und Roß. Und das Roß streckt im
wütenden Jagen das Haupt weit vor, straff spannen sich die
Adern, die Augen quellen hervor, die Zunge hängt weit zum
Maule heraus, alle Fibern sind angespannt, die gebläheten
Nüstern schnauben, aber vorwärts gehts unaufhaltsam; weitaus
greisen die Schwimmhaut-beschwingten Beine, und der endlose
Drachenschwanz fährt pfeisend über die Wogen dahin. Was sich
chm entgegenstellt, der Sturm stürzt es darnieder: da liegt ein
Wellenmensch unterm Pferde, machtlos, ohne Halt; wie über den
gefallenen Streiter die Schlacht, braust der Sturm über ihn
weiter, unwiderstehlich, jäh, ohne Rast. Unter dem Manne aber
schaut der Kopf eines Knaben hervor, den des schweren Leibes
Wucht hinabdrückl in des Wassers Flut; nach Hilfe zuckend greift
er in die Arme eines Tintenfisches hinein, der gierig nach der
willkommenen Beute hascht. Die ganze Gruppe voll Feuer und
Leben ist eine großartige hinreißende Verkörperung der unwider-
stehlichen S urmesgewalt. Rechts davon sehen wir die tosende
Welle, wie sie frei emporschießt aus der Tiefe, ein Mann mit
Fischschwanz von kraftvoll wilder Mannesschönbeit, der mit starken
Armen zum verderblichen Wurfe bereit, eine einzige Muschel über
das Haupt emporhebt und aus mächtiger Brust zum Ufer hinüber
den Kampstuf erhebt. Auf der anderen Seite taucht ein riesiger
Wels senkrecht aus der Tiefe empor, weit reißt er das gewaltige
Maul aus und schnappt nach dem Gegner. Der aber geht dem
Ungeheuer furchtlos zu Leibe; auf ihm knieend, sticht er los mit
der spitzen Tritonsmuschel, schlägt er herunter mit der wuchtig
geballten Faust. Voll Angst ob des Schreckenskampfes hat sich
ein Knabe jäh zu Boden gestürzt; das Antlitz vorbeugend kriecht
er in sich hinein. Da hinten aber tobt der Streit um den See-
stern. Eine Welle hat ihn emporgetragen, den schönen idealen
Jüngling, dessen edle Züge der Schmerz verklärt. Mit sehnigem
Arm umfaßt ihn, den machtlosen, jener greise Fischmensch mit
dem kahlen Haupte; aber gierig greift ein Genosse nach der Beute;
halb unter ihm liegend, zaust er jenem den langen Bart, daß er
wild aufschreit, und mit nerviger Faust zieht er' den Jüngling zu
sich hernieder. Gewaltiges Leben geht durch diese stark bewegte
Gruppe, echte elementare Kampfesleidenschaft, wie sie das Meer
gebiert, gepeitscht vom Sturm, vereint mit dem Bilde machtlosen
Leidens im Jüngling, der willenlos dem Spiele der Wellen
preisgegeben ist. Noch mancherlei ist zwischen den großen Gruppen
zu sehen: hier kriecht ein Molch schwerfällig am Strande hin, da
taucht ein Stachelroche auf, hier ein Seeteufel, dort überfällt ein
Riesenfisch den Reiher, der sturmesfroh über den Wellen dahin-
flog und der tückischen Flut allzu nahe kam: ein Bild des alles
verzehrenden Meeres. — Echte Phantasieanschauung spricht aus
diesen gewaltigen Verkörperungen des sturmbewegten Meeres:
unwillkürlich denkt man an Böcklins Spiel der Wellen und ähnlicher
Darstellungen des großen Meisters der Slimmungsmalerei. Aber
während dieser wesentlich das südliche Meer meist mit barockem
Humor verkörpert, tritt uns in der Diezschen Komposition das
nördliche Meer in aller seiner Kraft und Wildheit entgegen, der
scharfe Luftzug germanischer Anschauung geht durch diese ge-
waltigen Gruppen und Gestalten. Die einzelnen Körper sind auf
das sorgfältigste anatomisch und rhythmisch durchgebildet; überall
hat die Natur als Vorbild gedient; ihre Formen aber sind zu
bedeutendem herrlichem Ausdruck gesteigert. Körper und Antlitz
sind in jeder Gestalt individuell gebildet und charakteristisch beseelt.
Kein Anklang findet sich an die längst schematisch und konventionell
gewordenen Tritonenbildungen gewöhnlicher Art, alles ist frisch
empsunden, selbständig erfunden, angeschaut und innerlich erlebt.
Das Werk ist eine herrliche Frucht des modernen Naturalismus;
gebändigt und erhöht durch eine bedeutende Phantcsie und ein
hohes plastisches Formengesühl. poWf
tr. Düsseldorf. Der Historienmaler Fritz Roeberhat
einen großen Cyklus von elf Bildern, darunter drei von großem
Umfange vollendet, welche dev „Untergang der nordischen Götter-
welt und das Erscheinen des Christentums aus der neuen Erde"
darstellt. Die Bilder sind für die neuerbaute Villa des Herrn
Karl von der Heydt in Godesberg bestimmt. Dieser Cyklus
ist eines der hervorragendsten Werke, die hier in neuerer Zeit
vollendet sind, und zeigt den ausgezeichneten Künstler auf der
Höhe seines Könnens. Die bildliche Darstellung der gewaltigen
Göttertragödie ist das Werk, mit dessen Schöpfung Fritz Roeber
sich seit Jahren trug. Ein Umstand, wie er nicht häufig im
Leben eines Künstlers spielt, der Wunsch, die Bilderreihe für
sein Haus zu haben und das volle, warmherzige Verständnis
eines für die Kunst begeisterten Mäcens traf hier in glücklichster
Weise zusammen mit der nach Gestaltung seines Lieblingsge-
dankeu ringenden Künstlerseele. In schönster Weise hat Fritz
Roeber die große Aufgabe gelöst. Im Gegensätze zu Richard
Wagners Tetralogie, an dessen „Götterdämmerung" man speziell
bei der Betrachtung der Roeberschen Bilder natürlich denkt, ist
die Gestalt Baldurs, des Schönen, Glänzenden und Kühnen, des
Sohnes Odins und der Frigga, der Mittel- und Kernpunkt
dieser gemalten Göttertragödie. In genialer und großgedachter
Weise ist der Untergang der nordischen Götterwelt dargestellt.
Wir sehen auf dem ersten Bilde, wie Odin die allwissende Wala
um die Zukunft befragt. Ihre Runen „Christus" kann er nicht
lösen und ahnt das nahende Verderben des Asengcschlechtes. Mit
diesem Küstern Bilde der Schicksalsbefragung beginnt die Reihe
der gewaltigen Darstellungen. Im weitern schildert Roeber, wie
die Eisriesen des Lichtgottes Baldur Braut, Nanna, geraubt
haben, wie er sie befreit und der Erde noch einmal Sonne und
Frühling bringt, wie er mit ihr im Brautschleier über die furcht-
bangende Erde zieht. Dann schildert Roeber in einer groß ge-
dachten und -ausgeführteu Komposition Baldurs Tod, den Hödur
mit dem von Loki zum Pfeil geschärften Mistelzweig tötet.
Im weitern stellen die Bilder des Cyklus Lokis Flucht, Ergreifung
und Bestrafung dar; dann die Bestattung von Baldurs Leiche,
die die Götter auf ein Schiff bringen, das sie zu Hel, der
Götter der Unterwelt trägt. Eine Prächtig wirkende Darstellung
ist das siebente Bild der Reihe, ein üppiges Bacchanal der
Götter darstellend, die in Wollust und Schwelgerei nach Baldurs
Tode versunken sind. Wir sehen, wie Freia, die Schöne, die
Götter und Göttinnen bethört mit dem unerschöpflichen Meth-
horn, und wie dann Odin zornig die Äsen zum letzten Kampfe
ruft. Dieses Bild stellt die Krisis der Göttertragödie dar. Loki
hat seine Fesseln gebrochen und er zieht mit dem Fenriswolf
und der Midgardschlange, seinen Kindern, zum Kampf gegen die
Äsen. Die Unterwelt thut sich auf und leistet ihm Hilfe. Das
Totenschiff Naglfar wird los. Die sterbenden Nornen künden
Kleine Ausstellungen, von kserman kselfericb. - Personal- und Ateliernachrichten.
jene jammervolle Aufmerksamkeit für die Art, wie man
etwas macht, wohl auch auf. Und gegenüber der großen
Welt voll Thaten, die sie in der Stadt und der elemen-
taren Macht der Ruhe in der Natur, die sie auf dem
Lande umgeben würde, mit ihrer Verfeinerung, die in-
dessen nicht ohne Inhalt ist, kommt ihnen die Würde,
Zwccksicherheit und das Schönheitsverlangen der Kunst
zurück, in der sie sich wie auch immer, meinetwegen so
wie die ersten Völkerschaften, wenn sie's können, ausdrücken
mögen. Denn jetzt fühle ich doch, daß eine ungemeine
Ungesnndheit und Spätkultur in der Auffassung liegt, nur
auf die Exekution komme etwas an. Unfern Malern
wünsche ich etwas von der Naivität, die der Greis Watts
hat, und von seiner strikten Neigung nach dem Schönen.
Personal- u. Melier-Nachrichten.
* Dresden. Professor Robert Diez in Dresden hat
soeben im Modell den zweiten der großen Brunnen vollendet,
die auf dem Albertplatze zu Dresden-Neustadt in Bronze gegossen
aufgestellt werden sollen. Der erste, früher schon beschriebene
Brunnen schildert das ruhige Wasser, auf dem zweiten ist das
bewegte Wasser dargestellt. Schon dem ersten Brunnen mußten
wir uneingeschränktes Lob spenden, in dem zweiten hat der Künstler,
was er damals geleistet, noch übertrofsen, wenn anders nicht die
überaus mächtige, hinreißende Wirkung auch schon im Stoffe liegt.
Diez hat hierin den herrlichsten großartigsten Brunnen geschaffen,
der in Deutschland existiert; ein Werk, welches als ein Markstein in
der Geschichte der Plastik dastehen wird. Elf überlebensgroße
Gestalten, die sich um den Brunnen herum gruppieren, verkörpern
den Eindruck, die Empfindungen, die das wild bewegte Meer in
dem empfänglichen Menschen Hervorrust. Da ist der Sturm,
der die Wolken scheucht und die Tiefen des Meeres aufwühlt,
wie er auf seinem Rosse dahinrast. Trotziges Selbstbewußtsein
thront auf den ehernen Zügen, unter dem zackigen Muschelhelm
— der Sturmhaube — quellen, das steinharte Antlitz umzüngelnd,
die Schlangenhaare hervor, in die wasscrlriefenden Strähne der
Mähne faßt mit festem Griffe die Linke, während die weitaus-
holende Rechte wild die Schlangenpeitsche schwingt. Weit vor-
gebeugt liegt er auf seinem Rosse, die Flügel schwingt er, der
Lu st geborene, uns mit gewaltigem Schenkeldrucke preßt er sein
Tier, wie eins sind Mann und Roß. Und das Roß streckt im
wütenden Jagen das Haupt weit vor, straff spannen sich die
Adern, die Augen quellen hervor, die Zunge hängt weit zum
Maule heraus, alle Fibern sind angespannt, die gebläheten
Nüstern schnauben, aber vorwärts gehts unaufhaltsam; weitaus
greisen die Schwimmhaut-beschwingten Beine, und der endlose
Drachenschwanz fährt pfeisend über die Wogen dahin. Was sich
chm entgegenstellt, der Sturm stürzt es darnieder: da liegt ein
Wellenmensch unterm Pferde, machtlos, ohne Halt; wie über den
gefallenen Streiter die Schlacht, braust der Sturm über ihn
weiter, unwiderstehlich, jäh, ohne Rast. Unter dem Manne aber
schaut der Kopf eines Knaben hervor, den des schweren Leibes
Wucht hinabdrückl in des Wassers Flut; nach Hilfe zuckend greift
er in die Arme eines Tintenfisches hinein, der gierig nach der
willkommenen Beute hascht. Die ganze Gruppe voll Feuer und
Leben ist eine großartige hinreißende Verkörperung der unwider-
stehlichen S urmesgewalt. Rechts davon sehen wir die tosende
Welle, wie sie frei emporschießt aus der Tiefe, ein Mann mit
Fischschwanz von kraftvoll wilder Mannesschönbeit, der mit starken
Armen zum verderblichen Wurfe bereit, eine einzige Muschel über
das Haupt emporhebt und aus mächtiger Brust zum Ufer hinüber
den Kampstuf erhebt. Auf der anderen Seite taucht ein riesiger
Wels senkrecht aus der Tiefe empor, weit reißt er das gewaltige
Maul aus und schnappt nach dem Gegner. Der aber geht dem
Ungeheuer furchtlos zu Leibe; auf ihm knieend, sticht er los mit
der spitzen Tritonsmuschel, schlägt er herunter mit der wuchtig
geballten Faust. Voll Angst ob des Schreckenskampfes hat sich
ein Knabe jäh zu Boden gestürzt; das Antlitz vorbeugend kriecht
er in sich hinein. Da hinten aber tobt der Streit um den See-
stern. Eine Welle hat ihn emporgetragen, den schönen idealen
Jüngling, dessen edle Züge der Schmerz verklärt. Mit sehnigem
Arm umfaßt ihn, den machtlosen, jener greise Fischmensch mit
dem kahlen Haupte; aber gierig greift ein Genosse nach der Beute;
halb unter ihm liegend, zaust er jenem den langen Bart, daß er
wild aufschreit, und mit nerviger Faust zieht er' den Jüngling zu
sich hernieder. Gewaltiges Leben geht durch diese stark bewegte
Gruppe, echte elementare Kampfesleidenschaft, wie sie das Meer
gebiert, gepeitscht vom Sturm, vereint mit dem Bilde machtlosen
Leidens im Jüngling, der willenlos dem Spiele der Wellen
preisgegeben ist. Noch mancherlei ist zwischen den großen Gruppen
zu sehen: hier kriecht ein Molch schwerfällig am Strande hin, da
taucht ein Stachelroche auf, hier ein Seeteufel, dort überfällt ein
Riesenfisch den Reiher, der sturmesfroh über den Wellen dahin-
flog und der tückischen Flut allzu nahe kam: ein Bild des alles
verzehrenden Meeres. — Echte Phantasieanschauung spricht aus
diesen gewaltigen Verkörperungen des sturmbewegten Meeres:
unwillkürlich denkt man an Böcklins Spiel der Wellen und ähnlicher
Darstellungen des großen Meisters der Slimmungsmalerei. Aber
während dieser wesentlich das südliche Meer meist mit barockem
Humor verkörpert, tritt uns in der Diezschen Komposition das
nördliche Meer in aller seiner Kraft und Wildheit entgegen, der
scharfe Luftzug germanischer Anschauung geht durch diese ge-
waltigen Gruppen und Gestalten. Die einzelnen Körper sind auf
das sorgfältigste anatomisch und rhythmisch durchgebildet; überall
hat die Natur als Vorbild gedient; ihre Formen aber sind zu
bedeutendem herrlichem Ausdruck gesteigert. Körper und Antlitz
sind in jeder Gestalt individuell gebildet und charakteristisch beseelt.
Kein Anklang findet sich an die längst schematisch und konventionell
gewordenen Tritonenbildungen gewöhnlicher Art, alles ist frisch
empsunden, selbständig erfunden, angeschaut und innerlich erlebt.
Das Werk ist eine herrliche Frucht des modernen Naturalismus;
gebändigt und erhöht durch eine bedeutende Phantcsie und ein
hohes plastisches Formengesühl. poWf
tr. Düsseldorf. Der Historienmaler Fritz Roeberhat
einen großen Cyklus von elf Bildern, darunter drei von großem
Umfange vollendet, welche dev „Untergang der nordischen Götter-
welt und das Erscheinen des Christentums aus der neuen Erde"
darstellt. Die Bilder sind für die neuerbaute Villa des Herrn
Karl von der Heydt in Godesberg bestimmt. Dieser Cyklus
ist eines der hervorragendsten Werke, die hier in neuerer Zeit
vollendet sind, und zeigt den ausgezeichneten Künstler auf der
Höhe seines Könnens. Die bildliche Darstellung der gewaltigen
Göttertragödie ist das Werk, mit dessen Schöpfung Fritz Roeber
sich seit Jahren trug. Ein Umstand, wie er nicht häufig im
Leben eines Künstlers spielt, der Wunsch, die Bilderreihe für
sein Haus zu haben und das volle, warmherzige Verständnis
eines für die Kunst begeisterten Mäcens traf hier in glücklichster
Weise zusammen mit der nach Gestaltung seines Lieblingsge-
dankeu ringenden Künstlerseele. In schönster Weise hat Fritz
Roeber die große Aufgabe gelöst. Im Gegensätze zu Richard
Wagners Tetralogie, an dessen „Götterdämmerung" man speziell
bei der Betrachtung der Roeberschen Bilder natürlich denkt, ist
die Gestalt Baldurs, des Schönen, Glänzenden und Kühnen, des
Sohnes Odins und der Frigga, der Mittel- und Kernpunkt
dieser gemalten Göttertragödie. In genialer und großgedachter
Weise ist der Untergang der nordischen Götterwelt dargestellt.
Wir sehen auf dem ersten Bilde, wie Odin die allwissende Wala
um die Zukunft befragt. Ihre Runen „Christus" kann er nicht
lösen und ahnt das nahende Verderben des Asengcschlechtes. Mit
diesem Küstern Bilde der Schicksalsbefragung beginnt die Reihe
der gewaltigen Darstellungen. Im weitern schildert Roeber, wie
die Eisriesen des Lichtgottes Baldur Braut, Nanna, geraubt
haben, wie er sie befreit und der Erde noch einmal Sonne und
Frühling bringt, wie er mit ihr im Brautschleier über die furcht-
bangende Erde zieht. Dann schildert Roeber in einer groß ge-
dachten und -ausgeführteu Komposition Baldurs Tod, den Hödur
mit dem von Loki zum Pfeil geschärften Mistelzweig tötet.
Im weitern stellen die Bilder des Cyklus Lokis Flucht, Ergreifung
und Bestrafung dar; dann die Bestattung von Baldurs Leiche,
die die Götter auf ein Schiff bringen, das sie zu Hel, der
Götter der Unterwelt trägt. Eine Prächtig wirkende Darstellung
ist das siebente Bild der Reihe, ein üppiges Bacchanal der
Götter darstellend, die in Wollust und Schwelgerei nach Baldurs
Tode versunken sind. Wir sehen, wie Freia, die Schöne, die
Götter und Göttinnen bethört mit dem unerschöpflichen Meth-
horn, und wie dann Odin zornig die Äsen zum letzten Kampfe
ruft. Dieses Bild stellt die Krisis der Göttertragödie dar. Loki
hat seine Fesseln gebrochen und er zieht mit dem Fenriswolf
und der Midgardschlange, seinen Kindern, zum Kampf gegen die
Äsen. Die Unterwelt thut sich auf und leistet ihm Hilfe. Das
Totenschiff Naglfar wird los. Die sterbenden Nornen künden