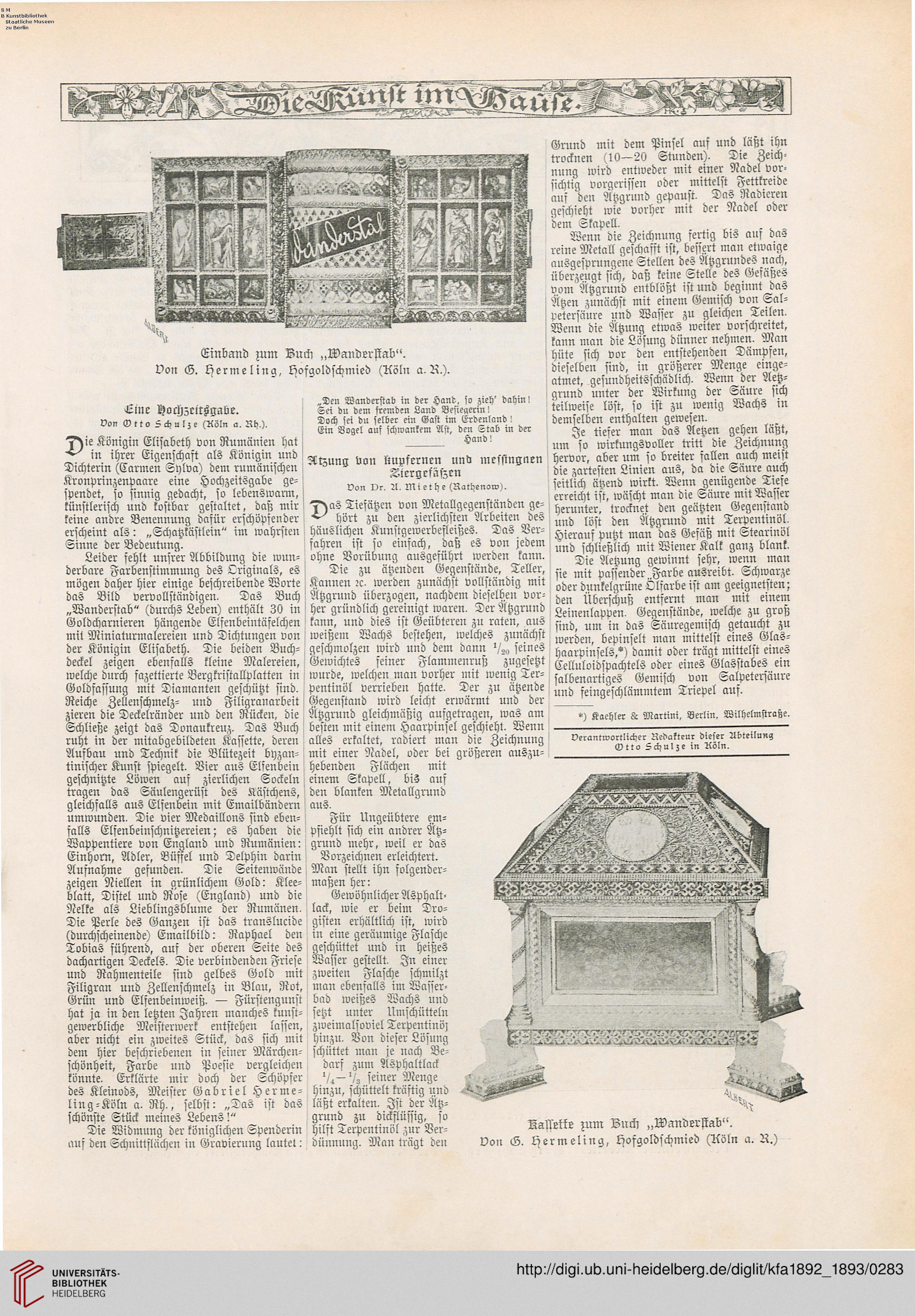von
Einband nun Buch „Wandrrstab".
G. Hermeling, Hofgoldschmied (Köln a. R.).
Line tzochzcirsgiibe.
Non Vtto Schulze (Köln a. Rh.).
7>ie Königin Elisabeth von Rumänien hat
^ in ihrer Eigenschaft als Königin und
Dichterin (Carmen Sylva) dem rumänischen
Kronprinzenpaare eine Hochzeilsgabe ge-
spendet, so sinnig gedacht, so lebenswarm,
„Den Wanderstab in der Hand, so zieh' dahin!
Sei du dem fremden Land Besiegerin!
Doch sei du selber ein Gast im Erdenland!
Ein Vogel auf schwankem Ast, den Stab in der
Hand!
Atzung von kupfernen und messingnen
Liergefäszen
von vr. A. Mi et h e (Rathenow).
künstlerisch und kostbar gestaltet, daß mir ^asTiesätzen von Metallgegenständcn ge
kein? oridvp Npripnniinfi dinsi'ir priednlitpndk'v dm'f ru dkN rikrlitdlten Ärsieiten
keine andre Benennung dafür erschöpfender
erscheint als: „Schatzkästlein" im wahrsten
Sinne der Bedeutung.
hört zu den zierlichsten Arbeiten des
häuslichen Kunstgewerbefleißes. Das Ver-
fahren ist so einfach, daß es von jedem
Leider fehlt unsrer Abbildung die wun- j ohne Vorübung ausgeführt werden kann.
Tie zu ätzenden Gegenstände, Teller,
Kannen w. werden zunächst vollständig mit
das Bild vervollständigen. Das Buch ! Ätzgrund überzogen, nachdem dieselben vor-
„Wanderstab" (durchs Leben) enthält 30 in her gründlich gereinigt waren. Der Ätzgrund
derbare Farbenstimmung des Originals, es !
mögen daher hier einige beschreibende Worte
Goldcharnieren hängende Elsenbeintäfelchen
mit Miniaturmalereien und Dichtungen von
der Königin Elisabeth. - - -- -
decket zeigen ebenfalls kleine Malereien,
welche durch fazettierte Bergkristallplatten in
Goldfassung mit Diamanten geschützt sind.
Reiche Zellenschmelz- und Filigranarbeit
zieren die Deckelränder und den Rücken, die
Schließe zeigt das Donaukreuz. Das Buch
ruht in der mitabgebildeten Kassette, deren
Aufbau und Technik die Blütezeit byzan-
tinischer Kunst spiegelt. Vier aus Elfenbein
geschnitzte Löwen auf zierlichen Sockeln
tragen das Säulengerüst des Kästchens,
gleichfalls aus Elfenbein mit Emailbändern
umwunden. Die vier Medaillons sind eben-
falls Elfenbeinschnitzereien; es haben die
Wappentiere von England und Rumänien:
Einhorn, Adler, Büffel und Delphin darin
Aufnahme gefunden. Die Seitenwände
zeigen Mellen in grünlichem Gold: Klee-
blatt, Distel und Rose (England) und die
Nelke als Lieblingsblume der Rumänen.
Die Perle des Ganzen ist das translucide
(durchscheinende) Emailbild: Raphael den
Tobias führend, auf der oberen Seite des
dachartigen Deckels. Die verbindenden Friese
und Rahmenteile sind gelbes Gold mit
Filigran und Zellenschmelz in Blau, Rot,
Grün und Elfenbeinweiß. — Fürstengunst
hat ja in den letzten Jahren manches kunst-
gewerbliche Meisterwerk entstehen lassen,
aber nicht ein zweites Stück, das sich mit
dem hier beschriebenen in seiner Märchen-
schönheit, Farbe und Poesie vergleichen
könnte. Erklärte mir doch der Schöpfer
des Kleinods, Meister Gabriel Herme-
ling-Köln a. Rh., selbst: „Das ist das
schönste Stück meines Lebens!"
Die Widmung der königlichen Spenderin
auf den Schnittflächen in Gravierung lautet:
kann, und dies ist Geübteren zu raten, aus
weißem Wachs bestehen, welches zunächst
Die beiden Buch- geschmolzen wird und dem dann '/s» seines
" ' - Gewichtes feiner Flammenruß zugesetzt
wurde, welchen man vorher mit wenig Ter-
pentinöl verrieben hatte. Ter zu ätzende
Gegenstand wird leicht erwärmt und der
Ätzgrund gleichmäßig aufgetragen, was am
besten mit einem Haarpinsel geschieht. Wenn
alles erkaltet, radiert man die Zeichnung
mit einer Nadel, oder bei größeren auszu-
hebenden Flächen mit
einem Skapell, bis auf
den blanken Metallgrund
aus.
Für Ungeübtere em-
pfiehlt sich ein andrer Ätz-
grund mehr, weil er das
Vorzeichnen erleichtert.
Man stellt ihn folgender-
maßen her:
Gewöhnlicher Asphalt-
lack, wie er beim Dro-
gisten erhältlich ist, wird
in eine geräumige Flasche
geschüttet und in heißes
Wasser gestellt. In einer
zweiten Flasche schmilzt
man ebenfalls im Wasser-
bad weißes Wachs und
setzt unter Umschütteln
zweimalsoviel Terpentinöl
hinzu. Von dieser Lösung
schüttet man je nach Be-
darf zum Asphaltlack
'/j—stz seiner Menge
hinzu, schüttelt kräftig und
läßt erkalten. Ist der Ätz-
grund zu dickflüssig, so
hilft Terpentinöl zur Ver-
dünnung. Man wägt den von
Grund mit dem Pinsel auf und läßt ihn
trocknen (10—20 Stunden). Die Zeich-
nung wird entweder mit einer Nadel vor-
sichtig vorgerissen oder mittelst Fettkreide
auf den Atzgrund gepaust. Das Radieren
geschieht wie vorher mit der Nadel oder
^ dem Skapell.
Wenn die Zeichnung fertig bis auf das
reine Metall geschafft ist, bessert man etwaige
ausgesprungene Stellen des Atzgrundes nach,
überzeugt sich, daß keine Stelle des Gesäßes
vom Ätzgrund entblößt ist und beginnt das
Ätzen zunächst mit einem Gemisch von Sal-
petersäure und Wasser zu gleichen Teilen.
Wenn die Ätzung etwas weiter vorschreitet,
kann man die Lösung dünner nehmen. Man
hüte sich vor den entstehenden Dämpfen,
. dieselben sind, in größerer Menge einge-
^ atmet, gesundheitsschädlich. Wenn der Aetz-
i grund unter der Wirkung der Säure sich
teilweise löst, so ist zu wenig Wachs in
demselben enthalten gewesen.
Je tiefer man das Aetzen gehen läßt,
, um so wirkungsvoller tritt die Zeichnung
hervor, aber um so breiter fallen auch meist
die zartesten Linien aus, da die Säure auch
seitlich ästend wirkt. Wenn genügende Tiefe
erreicht ist, wäscht man die Säure mit Wasser
herunter, trocknet den geätzten Gegenstand
und löst den Ätzgrund mit Terpentinöl.
Hierauf putzt man das Gesäß mit Stearinöl
und schließlich mit Wiener Kalk ganz blank.
Die Aetzung gewinnt sehr, wenn man
sie mit Paffender..Farbe ausreibt. Schwarze
oder dunkelgrüne Ölfarbe ist am geeignetsten;
den Überschuß entfernt man mit einem
. Gegenstände, welche zu groß
sind, um in das Säuregemisch getaucht zu
werden, bepinselt man mittelst eines Glas-
haarpinsels,*) damit oder trägt mittelst eines
Celluloidspachtels oder eines Glasstabes ein
salbenartiges Gemisch von Salpetersäure
und feingeschlämmtem Triepel auf.
«) Kaehler L Martini, Berlin, Wilhelmstraße.
Verantwortlicher Redakteur dieser Abteilung
Otto Schulze in Köln.
Kastelle nun Buch „Wandrrstab".
G. Hermeling, Hofgoldschmied (blöln a. R.)
Einband nun Buch „Wandrrstab".
G. Hermeling, Hofgoldschmied (Köln a. R.).
Line tzochzcirsgiibe.
Non Vtto Schulze (Köln a. Rh.).
7>ie Königin Elisabeth von Rumänien hat
^ in ihrer Eigenschaft als Königin und
Dichterin (Carmen Sylva) dem rumänischen
Kronprinzenpaare eine Hochzeilsgabe ge-
spendet, so sinnig gedacht, so lebenswarm,
„Den Wanderstab in der Hand, so zieh' dahin!
Sei du dem fremden Land Besiegerin!
Doch sei du selber ein Gast im Erdenland!
Ein Vogel auf schwankem Ast, den Stab in der
Hand!
Atzung von kupfernen und messingnen
Liergefäszen
von vr. A. Mi et h e (Rathenow).
künstlerisch und kostbar gestaltet, daß mir ^asTiesätzen von Metallgegenständcn ge
kein? oridvp Npripnniinfi dinsi'ir priednlitpndk'v dm'f ru dkN rikrlitdlten Ärsieiten
keine andre Benennung dafür erschöpfender
erscheint als: „Schatzkästlein" im wahrsten
Sinne der Bedeutung.
hört zu den zierlichsten Arbeiten des
häuslichen Kunstgewerbefleißes. Das Ver-
fahren ist so einfach, daß es von jedem
Leider fehlt unsrer Abbildung die wun- j ohne Vorübung ausgeführt werden kann.
Tie zu ätzenden Gegenstände, Teller,
Kannen w. werden zunächst vollständig mit
das Bild vervollständigen. Das Buch ! Ätzgrund überzogen, nachdem dieselben vor-
„Wanderstab" (durchs Leben) enthält 30 in her gründlich gereinigt waren. Der Ätzgrund
derbare Farbenstimmung des Originals, es !
mögen daher hier einige beschreibende Worte
Goldcharnieren hängende Elsenbeintäfelchen
mit Miniaturmalereien und Dichtungen von
der Königin Elisabeth. - - -- -
decket zeigen ebenfalls kleine Malereien,
welche durch fazettierte Bergkristallplatten in
Goldfassung mit Diamanten geschützt sind.
Reiche Zellenschmelz- und Filigranarbeit
zieren die Deckelränder und den Rücken, die
Schließe zeigt das Donaukreuz. Das Buch
ruht in der mitabgebildeten Kassette, deren
Aufbau und Technik die Blütezeit byzan-
tinischer Kunst spiegelt. Vier aus Elfenbein
geschnitzte Löwen auf zierlichen Sockeln
tragen das Säulengerüst des Kästchens,
gleichfalls aus Elfenbein mit Emailbändern
umwunden. Die vier Medaillons sind eben-
falls Elfenbeinschnitzereien; es haben die
Wappentiere von England und Rumänien:
Einhorn, Adler, Büffel und Delphin darin
Aufnahme gefunden. Die Seitenwände
zeigen Mellen in grünlichem Gold: Klee-
blatt, Distel und Rose (England) und die
Nelke als Lieblingsblume der Rumänen.
Die Perle des Ganzen ist das translucide
(durchscheinende) Emailbild: Raphael den
Tobias führend, auf der oberen Seite des
dachartigen Deckels. Die verbindenden Friese
und Rahmenteile sind gelbes Gold mit
Filigran und Zellenschmelz in Blau, Rot,
Grün und Elfenbeinweiß. — Fürstengunst
hat ja in den letzten Jahren manches kunst-
gewerbliche Meisterwerk entstehen lassen,
aber nicht ein zweites Stück, das sich mit
dem hier beschriebenen in seiner Märchen-
schönheit, Farbe und Poesie vergleichen
könnte. Erklärte mir doch der Schöpfer
des Kleinods, Meister Gabriel Herme-
ling-Köln a. Rh., selbst: „Das ist das
schönste Stück meines Lebens!"
Die Widmung der königlichen Spenderin
auf den Schnittflächen in Gravierung lautet:
kann, und dies ist Geübteren zu raten, aus
weißem Wachs bestehen, welches zunächst
Die beiden Buch- geschmolzen wird und dem dann '/s» seines
" ' - Gewichtes feiner Flammenruß zugesetzt
wurde, welchen man vorher mit wenig Ter-
pentinöl verrieben hatte. Ter zu ätzende
Gegenstand wird leicht erwärmt und der
Ätzgrund gleichmäßig aufgetragen, was am
besten mit einem Haarpinsel geschieht. Wenn
alles erkaltet, radiert man die Zeichnung
mit einer Nadel, oder bei größeren auszu-
hebenden Flächen mit
einem Skapell, bis auf
den blanken Metallgrund
aus.
Für Ungeübtere em-
pfiehlt sich ein andrer Ätz-
grund mehr, weil er das
Vorzeichnen erleichtert.
Man stellt ihn folgender-
maßen her:
Gewöhnlicher Asphalt-
lack, wie er beim Dro-
gisten erhältlich ist, wird
in eine geräumige Flasche
geschüttet und in heißes
Wasser gestellt. In einer
zweiten Flasche schmilzt
man ebenfalls im Wasser-
bad weißes Wachs und
setzt unter Umschütteln
zweimalsoviel Terpentinöl
hinzu. Von dieser Lösung
schüttet man je nach Be-
darf zum Asphaltlack
'/j—stz seiner Menge
hinzu, schüttelt kräftig und
läßt erkalten. Ist der Ätz-
grund zu dickflüssig, so
hilft Terpentinöl zur Ver-
dünnung. Man wägt den von
Grund mit dem Pinsel auf und läßt ihn
trocknen (10—20 Stunden). Die Zeich-
nung wird entweder mit einer Nadel vor-
sichtig vorgerissen oder mittelst Fettkreide
auf den Atzgrund gepaust. Das Radieren
geschieht wie vorher mit der Nadel oder
^ dem Skapell.
Wenn die Zeichnung fertig bis auf das
reine Metall geschafft ist, bessert man etwaige
ausgesprungene Stellen des Atzgrundes nach,
überzeugt sich, daß keine Stelle des Gesäßes
vom Ätzgrund entblößt ist und beginnt das
Ätzen zunächst mit einem Gemisch von Sal-
petersäure und Wasser zu gleichen Teilen.
Wenn die Ätzung etwas weiter vorschreitet,
kann man die Lösung dünner nehmen. Man
hüte sich vor den entstehenden Dämpfen,
. dieselben sind, in größerer Menge einge-
^ atmet, gesundheitsschädlich. Wenn der Aetz-
i grund unter der Wirkung der Säure sich
teilweise löst, so ist zu wenig Wachs in
demselben enthalten gewesen.
Je tiefer man das Aetzen gehen läßt,
, um so wirkungsvoller tritt die Zeichnung
hervor, aber um so breiter fallen auch meist
die zartesten Linien aus, da die Säure auch
seitlich ästend wirkt. Wenn genügende Tiefe
erreicht ist, wäscht man die Säure mit Wasser
herunter, trocknet den geätzten Gegenstand
und löst den Ätzgrund mit Terpentinöl.
Hierauf putzt man das Gesäß mit Stearinöl
und schließlich mit Wiener Kalk ganz blank.
Die Aetzung gewinnt sehr, wenn man
sie mit Paffender..Farbe ausreibt. Schwarze
oder dunkelgrüne Ölfarbe ist am geeignetsten;
den Überschuß entfernt man mit einem
. Gegenstände, welche zu groß
sind, um in das Säuregemisch getaucht zu
werden, bepinselt man mittelst eines Glas-
haarpinsels,*) damit oder trägt mittelst eines
Celluloidspachtels oder eines Glasstabes ein
salbenartiges Gemisch von Salpetersäure
und feingeschlämmtem Triepel auf.
«) Kaehler L Martini, Berlin, Wilhelmstraße.
Verantwortlicher Redakteur dieser Abteilung
Otto Schulze in Köln.
Kastelle nun Buch „Wandrrstab".
G. Hermeling, Hofgoldschmied (blöln a. R.)