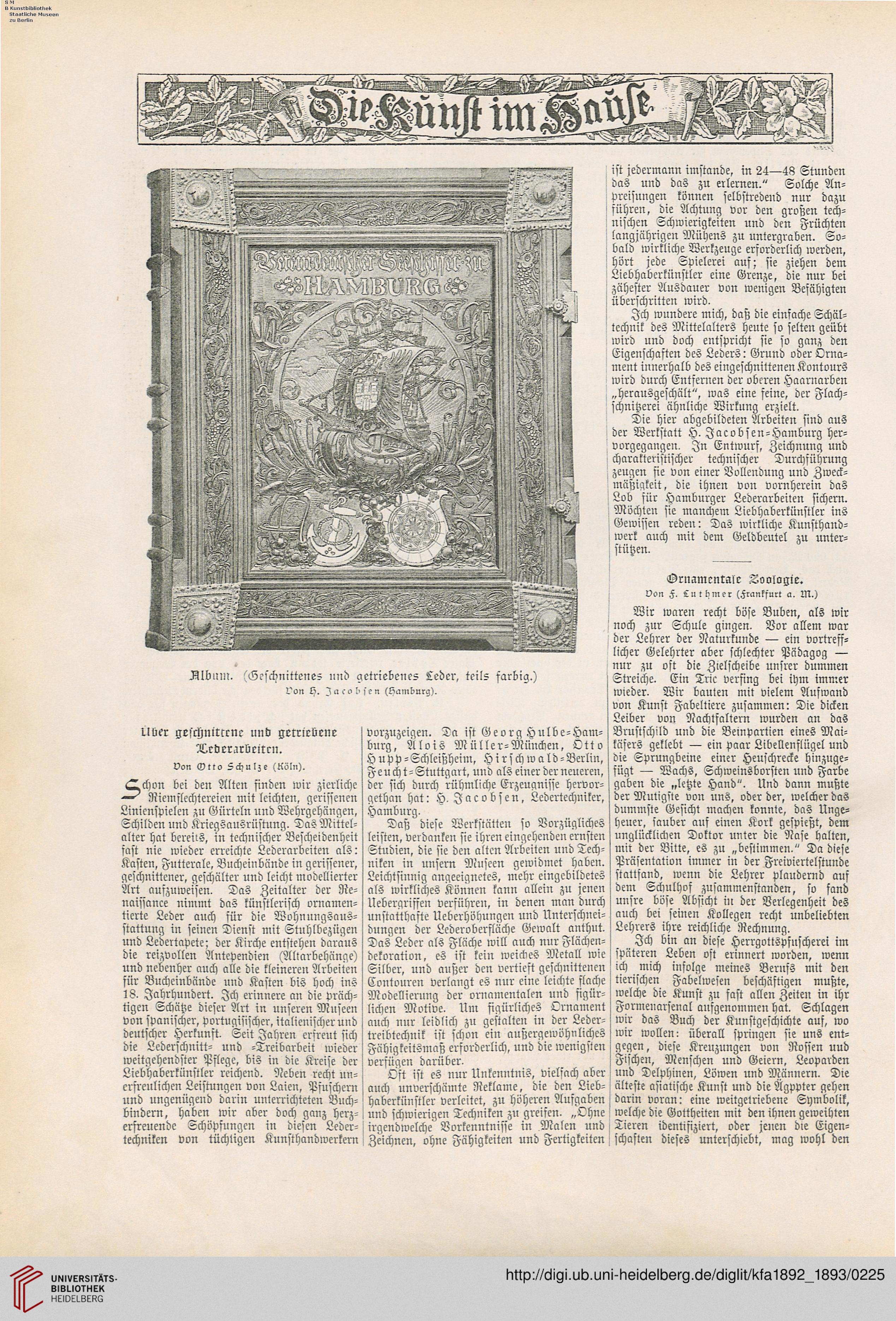HIbum. (Geschnittene; und getriebenes Leder, teils farbig.)
Über geschnttcrne und getriebene
Trd erarbeite».
von Dtto Schulze (tiöln).
chon bei den Alten finden wir zierliche
Riemflechtereien mit leichten, gerissenen
Linienspielen zu Gürteln und Wehrgehängen,
Schilden und Kriegsausrüstung. Das Mittel-
alter hat bereits, in technischer Bescheidenheit
säst nie wieder erreichte Lederarbeiten als:
Kasten, Futterale, Bucheinbände in gerissener,
geschnittener, geschälter und leicht modellierter
Art aufzuweisen. Das Zeitalter der Re-
naissance nimmt das künstlerisch ornamen-
tierte Leder auch sür die Wohnungsaus-
stattung in seinen Dienst mit Stuhlbezügen
und Ledertapete; der Kirche entstehen daraus
die reizvollen Antependien (Altarbehänge)
und nebenher auch alle die kleineren Arbeiten
für Bucheinbände und Kasten bis hoch ins
18. Jahrhundert. Ich erinnere an die Präch-
tigen Schätze dieser Art in unseren Museen
von spanischer, portugisischer, italienischer und
deutscher Herkunft. Seit Jahren erfreut sich
die Lederschnitt- und -Treibarbeit wieder
weitgehendster Pflege, bis in die Kreise der
Liebhaberkllnstler reichend. Neben recht un-
erfreulichen Leistungen von Laien, Pfuschern
und ungenügend darin unterrichteten Buch-
bindern, haben wir aber doch ganz herz-
erfreuende Schöpfungen in diesen Leder-
techniken von tüchtigen Kunsthandwerkern
vorzuzeigen. Da ist Georg Hulbe-Ham-
bnrg, Alois Müller-München, Otto
Hupp- Schleißheim, Hirschwald- Berlin,
Feuch t-Stuttgart, und als einer der neueren,
der sich durch rühmliche Erzeugnisse hervor-
gethan hat: H. Jacobsen, Ledertechniker,
Hamburg.
Daß diese Werkstätten so Vorzügliches
leisten, verdanken sie ihren eingehenden ernsten
Studien, die sie den alten Arbeiten und Tech-
niken in unfern Museen gewidmet haben.
Leichtsinnig angeeignetes, mehr eingebildetes
als wirkliches Können kann allein zu jenen
Uebergriffen verführen, in denen man durch
unstatthafte Ueberhöhungen und Unterschnei-
dungen der Lederoberfläche Gewalt anthut.
Das Leder als Fläche will auch nur Flächen-
dekoration, es ist kein weiches Metall wie
Silber, und außer den vertieft geschnittenen
Contouren verlangt es nur eine leichte flache
Modellierring der ornamentalen und figür-
lichen Motive. Um figürliches Ornament
auch nur leidlich zu gestalten in der Leder-
treibtechnik ist schon ein außergewöhnliches
Fähigkeitsmaß erforderlich, und die wenigsten
verfügen darüber.
Oft ist cs nur Unkenntnis, vielfach aber
auch unverschämte Reklame, die den Lieb-
haberkünstler verleitet, zu höheren Aufgaben
und schwierigen Techniken zu greifen. „Ohne
irgendwelche Vorkenntnisse in Malen und
Zeichnen, ohne Fähigkeiten und Fertigkeiten
ist jedermann imstande, in 24—48 Stunden
das und das zu erlernen." Solche An-
preisungen können selbstredend nur dazu
führen, die Achtung vor den großen tech-
nischen Schwierigkeiten und den Früchten
langjährigen Mühens zu untergraben. So-
bald wirkliche Werkzeuge erforderlich werden,
hört jede Spielerei auf; sie ziehen dem
Liebhaberkünstler eine Grenze, die nur bei
zähester Ausdauer von wenigen Befähigten
überschritten wird.
Ich wundere mich, daß die einfache Schäl-
tcchnik des Mittelalters heute so selten geübt
wird und doch entspricht sie so ganz den
Eigenschaften des Leders: Grund oder Orna-
ment innerhalb des eingeschnittenen Kontours
wird durch Entfernen der oberen Haarnarben
„herausgeschält", was eine feine, der Flach-
schnitzerei ähnliche Wirkung erzielt.
Die hier abgebildeten Arbeiten sind aus
der Werkstatt H. Jacobsen-Hamburg her-
vorgegangen. In Entwurf, Zeichnung und
charakteristischer technischer Durchführung
, zeugen sie von einer Vollendung und Zweck-
mäßigkeit, die ihnen von vornherein das
Lob für Hamburger Lederarbeilen sichern.
Möchten sie manchem Liebhaberkünstler ins
Gewissen reden: Das wirkliche Kunsthand-
! werk auch mit dem Geldbeutel zu unter-
stützen.
Grnsmcntsle Zoologie.
von F. Lutbmer (Frankfurt a. m.)
Wir waren recht böse Buben, als wir
noch zur Schule gingen. Bor allem war
der Lehrer der Naturkunde — ein vortreff-
licher Gelehrter aber schlechter Pädagog —
nur zu oft die Zielscheibe unsrer dummen
Streiche. Ein Tric verfing bei ihm immer
Mieder. Wir bauten mit vielem Aufwand
von Kunst Fabeltiere zusammen: Die dicken
Leiber von Nachtfaltern wurden an das
Brustschild und die Beinpartien eines Mai-
käfers geklebt — ein paar Libellenflügel und
die Sprungbeine einer Heuschrecke hinzuge-
sügt — Wachs, Schweinsborsten und Farbe
gaben die „letzte Hand". Und dann mußte
der Mutigste von uns, oder der, welcher das
dümmste Gesicht machen konnte, das Unge-
heuer, sauber auf einen Kork gespießt, dem
unglücklichen Doktor unter die Nase halten,
mit der Bitte, es zu „bestimmen." Da diese
Präsentation immer in der Freiviertelstunde
stattfand, wenn die Lehrer plaudernd auf
dem Schulhof zusammenstanden, so fand
unsre böse Absicht in der Verlegenheit des
auch bei seinen Kollegen recht unbeliebten
Lehrers ihre reichliche Rechnung.
Ich bin an diese Herrgottspfuscherei im
späteren Leben oft erinnert worden, wenn
ich mich infolge meines Berufs mit den
tierischen Fabelwesen beschäftigen mußte,
welche die Kunst zu fast allen Zeiten in ihr
Formenarsenal ausgenommen hat. Schlagen
wir das Buch der Kunstgeschichte auf, wo
wir wollen: überall springen sie uns ent-
gegen, diese Kreuzungen von Rossen uud
Fischen, Menschen und Geiern, Leoparden
und Delphinen, Löwen und Männern. Die
älteste asiatische Kunst und die Ägppter gehen
darin voran: eine weitgetriebene Symbolik,
welche die Gottheiten mit den ihnen geweihten
Tieren identifiziert, oder jenen die Eigen-
! schäften dieses unterschiebt, mag wohl den
Über geschnttcrne und getriebene
Trd erarbeite».
von Dtto Schulze (tiöln).
chon bei den Alten finden wir zierliche
Riemflechtereien mit leichten, gerissenen
Linienspielen zu Gürteln und Wehrgehängen,
Schilden und Kriegsausrüstung. Das Mittel-
alter hat bereits, in technischer Bescheidenheit
säst nie wieder erreichte Lederarbeiten als:
Kasten, Futterale, Bucheinbände in gerissener,
geschnittener, geschälter und leicht modellierter
Art aufzuweisen. Das Zeitalter der Re-
naissance nimmt das künstlerisch ornamen-
tierte Leder auch sür die Wohnungsaus-
stattung in seinen Dienst mit Stuhlbezügen
und Ledertapete; der Kirche entstehen daraus
die reizvollen Antependien (Altarbehänge)
und nebenher auch alle die kleineren Arbeiten
für Bucheinbände und Kasten bis hoch ins
18. Jahrhundert. Ich erinnere an die Präch-
tigen Schätze dieser Art in unseren Museen
von spanischer, portugisischer, italienischer und
deutscher Herkunft. Seit Jahren erfreut sich
die Lederschnitt- und -Treibarbeit wieder
weitgehendster Pflege, bis in die Kreise der
Liebhaberkllnstler reichend. Neben recht un-
erfreulichen Leistungen von Laien, Pfuschern
und ungenügend darin unterrichteten Buch-
bindern, haben wir aber doch ganz herz-
erfreuende Schöpfungen in diesen Leder-
techniken von tüchtigen Kunsthandwerkern
vorzuzeigen. Da ist Georg Hulbe-Ham-
bnrg, Alois Müller-München, Otto
Hupp- Schleißheim, Hirschwald- Berlin,
Feuch t-Stuttgart, und als einer der neueren,
der sich durch rühmliche Erzeugnisse hervor-
gethan hat: H. Jacobsen, Ledertechniker,
Hamburg.
Daß diese Werkstätten so Vorzügliches
leisten, verdanken sie ihren eingehenden ernsten
Studien, die sie den alten Arbeiten und Tech-
niken in unfern Museen gewidmet haben.
Leichtsinnig angeeignetes, mehr eingebildetes
als wirkliches Können kann allein zu jenen
Uebergriffen verführen, in denen man durch
unstatthafte Ueberhöhungen und Unterschnei-
dungen der Lederoberfläche Gewalt anthut.
Das Leder als Fläche will auch nur Flächen-
dekoration, es ist kein weiches Metall wie
Silber, und außer den vertieft geschnittenen
Contouren verlangt es nur eine leichte flache
Modellierring der ornamentalen und figür-
lichen Motive. Um figürliches Ornament
auch nur leidlich zu gestalten in der Leder-
treibtechnik ist schon ein außergewöhnliches
Fähigkeitsmaß erforderlich, und die wenigsten
verfügen darüber.
Oft ist cs nur Unkenntnis, vielfach aber
auch unverschämte Reklame, die den Lieb-
haberkünstler verleitet, zu höheren Aufgaben
und schwierigen Techniken zu greifen. „Ohne
irgendwelche Vorkenntnisse in Malen und
Zeichnen, ohne Fähigkeiten und Fertigkeiten
ist jedermann imstande, in 24—48 Stunden
das und das zu erlernen." Solche An-
preisungen können selbstredend nur dazu
führen, die Achtung vor den großen tech-
nischen Schwierigkeiten und den Früchten
langjährigen Mühens zu untergraben. So-
bald wirkliche Werkzeuge erforderlich werden,
hört jede Spielerei auf; sie ziehen dem
Liebhaberkünstler eine Grenze, die nur bei
zähester Ausdauer von wenigen Befähigten
überschritten wird.
Ich wundere mich, daß die einfache Schäl-
tcchnik des Mittelalters heute so selten geübt
wird und doch entspricht sie so ganz den
Eigenschaften des Leders: Grund oder Orna-
ment innerhalb des eingeschnittenen Kontours
wird durch Entfernen der oberen Haarnarben
„herausgeschält", was eine feine, der Flach-
schnitzerei ähnliche Wirkung erzielt.
Die hier abgebildeten Arbeiten sind aus
der Werkstatt H. Jacobsen-Hamburg her-
vorgegangen. In Entwurf, Zeichnung und
charakteristischer technischer Durchführung
, zeugen sie von einer Vollendung und Zweck-
mäßigkeit, die ihnen von vornherein das
Lob für Hamburger Lederarbeilen sichern.
Möchten sie manchem Liebhaberkünstler ins
Gewissen reden: Das wirkliche Kunsthand-
! werk auch mit dem Geldbeutel zu unter-
stützen.
Grnsmcntsle Zoologie.
von F. Lutbmer (Frankfurt a. m.)
Wir waren recht böse Buben, als wir
noch zur Schule gingen. Bor allem war
der Lehrer der Naturkunde — ein vortreff-
licher Gelehrter aber schlechter Pädagog —
nur zu oft die Zielscheibe unsrer dummen
Streiche. Ein Tric verfing bei ihm immer
Mieder. Wir bauten mit vielem Aufwand
von Kunst Fabeltiere zusammen: Die dicken
Leiber von Nachtfaltern wurden an das
Brustschild und die Beinpartien eines Mai-
käfers geklebt — ein paar Libellenflügel und
die Sprungbeine einer Heuschrecke hinzuge-
sügt — Wachs, Schweinsborsten und Farbe
gaben die „letzte Hand". Und dann mußte
der Mutigste von uns, oder der, welcher das
dümmste Gesicht machen konnte, das Unge-
heuer, sauber auf einen Kork gespießt, dem
unglücklichen Doktor unter die Nase halten,
mit der Bitte, es zu „bestimmen." Da diese
Präsentation immer in der Freiviertelstunde
stattfand, wenn die Lehrer plaudernd auf
dem Schulhof zusammenstanden, so fand
unsre böse Absicht in der Verlegenheit des
auch bei seinen Kollegen recht unbeliebten
Lehrers ihre reichliche Rechnung.
Ich bin an diese Herrgottspfuscherei im
späteren Leben oft erinnert worden, wenn
ich mich infolge meines Berufs mit den
tierischen Fabelwesen beschäftigen mußte,
welche die Kunst zu fast allen Zeiten in ihr
Formenarsenal ausgenommen hat. Schlagen
wir das Buch der Kunstgeschichte auf, wo
wir wollen: überall springen sie uns ent-
gegen, diese Kreuzungen von Rossen uud
Fischen, Menschen und Geiern, Leoparden
und Delphinen, Löwen und Männern. Die
älteste asiatische Kunst und die Ägppter gehen
darin voran: eine weitgetriebene Symbolik,
welche die Gottheiten mit den ihnen geweihten
Tieren identifiziert, oder jenen die Eigen-
! schäften dieses unterschiebt, mag wohl den