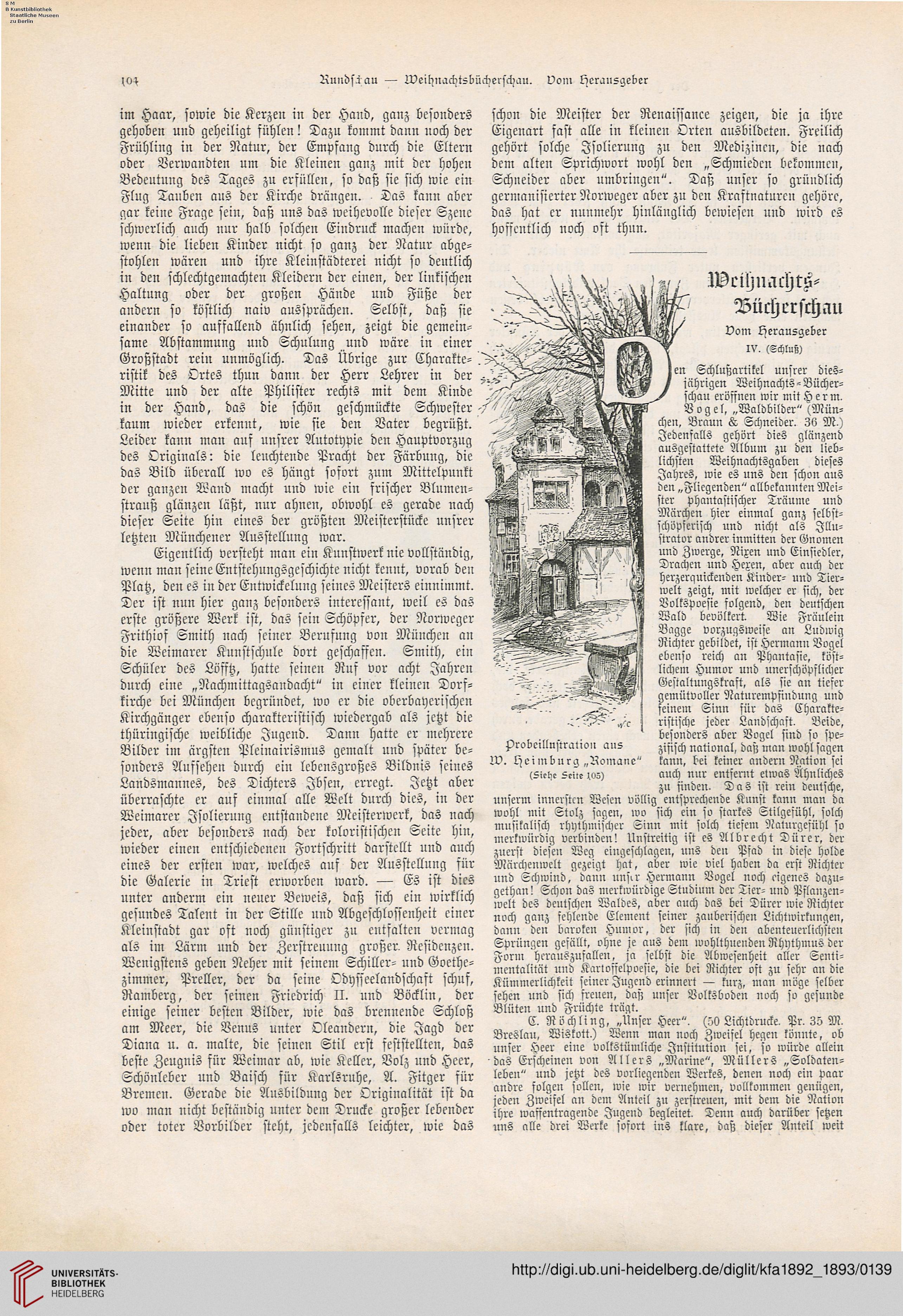Rundsä au — bveihnachtsbücherschau. vom Herausgeber
im Haar, sowie die Kerzen in der Hand, ganz besonders
gehoben und geheiligt fühlen! Dazu kommt dann noch der
Frühling in der Natur, der Empfang durch die Eltern
oder Verwandten um die Kleinen ganz mit der hohen
Bedeutung des Tages zu erfüllen, so daß sie sich wie ein
Flug Tauben aus der Kirche drängen. Das kann aber
gar keine Frage sein, daß uns das weihevolle dieser Szene
schwerlich auch nur halb solchen Eindruck machen würde,
wenn die lieben Kinder nicht so ganz der Natur abge-
stohlen wären und ihre Kleinstädterei nicht so deutlich
in den schlechtgemachten Kleidern der einen, der linkischen
Haltung oder der großen Hände und Füße der
andern so köstlich naiv aussprächen. Selbst, daß sie
einander so auffallend ähnlich sehen, zeigt die gemein-
same Abstammung und Schulung und wäre in einer
Großstadt rein unmöglich. Das Übrige zur Charakte-
ristik des Ortes thun dann der Herr Lehrer in der
Mitte und der alte Philister rechts mit dem Kinde
in der Hand, das die schön geschmückte Schwester
kaum wieder erkennt, wie sie den Vater begrüßt.
Leider kann man auf unsrer Autotypie den Hauptvorzug
des Originals: die leuchtende Pracht der Färbung, die
das Bild überall wo es hängt sofort zum Mittelpunkt
der ganzen Wand macht und wie ein frischer Blumen-
strauß glänzen läßt, nur ahnen, obwohl es gerade nach
dieser Seite hin eines der größten Meisterstücke unsrer
letzten Münchener Ausstellung war.
Eigentlich versteht man ein Kunstwerk nie vollständig,
wenn man seine Entstehungsgeschichte nicht kennt, vorab den
Platz, den es in der Entwickelung seines Meisters einnimmt.
Der ist nun hier ganz besonders interessant, weil es das
erste größere Werk ist, das sein Schöpfer, der Norweger
Frithiof Smith nach seiner Berufung von München an
die Weimarer Kunstschule dort geschaffen. Smith, ein
Schüler des Löfftz, hatte seinen Ruf vor acht Jahren
durch eine „Nachmittagsandacht" in einer kleinen Dorf-
kirche bei München begründet, wo er die oberbayerischen
Kirchgänger ebenso charakteristisch wiedergab als jetzt die
thüringische weibliche Jugend. Dann hatte er mehrere
Bilder im ärgsten Pleinairismus gemalt und später be-
sonders Aufsehen durch ein lebensgroßes Bildnis seines
Landsmannes, des Dichters Ibsen, erregt. Jetzt aber
überraschte er auf einmal alle Welt durch dies, in der
Weimarer Isolierung entstandene Meisterwerk, das nach
jeder, aber besonders nach der koloristischen Seite hin,
wieder einen entschiedenen Fortschritt darstellt und auch
eines der ersten war, welches ans der Ausstellung für
die Galerie in Triest erworben ward. — Es ist dies
unter anderm ein neuer Beweis, daß sich ein wirklich
gesundes Talent in der Stille und Abgeschlossenheit einer
Kleinstadt gar oft noch günstiger zu entfalten vermag
als im Lärm und der Zerstreuung großer. Residenzen.
Wenigstens geben Neher mit seinem Schiller- und Goethe-
zimmer, Preller, der da seine Odysseelandschaft schuf,
Ramberg, der seinen Friedrich II. und Böcklin, der
einige seiner besten Bilder, wie das brennende Schloß
am Meer, die Venus unter Oleandern, die Jagd der
Diana u. a. malte, die seinen Stil erst feststellten, das
beste Zeugnis für Weimar ab, wie Keller, Bolz und Heer,
Schönleber und Baisch für Karlsruhe, A. Fitger für
Bremen. Gerade die Ausbildung der Originalität ist da
wo man nicht beständig unter dem Drucke großer lebender
oder toter Vorbilder steht, jedenfalls leichter, wie das
schon die Meister der Renaissance zeigen, die ja ihre
Eigenart fast alle in kleinen Orten ausbildeten. Freilich
gehört solche Isolierung zu den Medizinen, die nach
dem alten Sprichwort wohl den „Schmieden bekommen,
Schneider aber umbringen". Daß unser so gründlich
germanisierter Norweger aber zu den Kraftnaturcn gehöre,
das hat er nunmehr hinlänglich bewiesen und wird cs
hoffentlich noch oft thun.
Wi'iljn.ichtü-
Büch erschau
Vom Herausgeber
IV. lSchluß)
!en Schlußartikel unsrer dies-
jährigen Weihnachls-Bücher-
schau eröffnen wir mit Herm.
Vogel, „Waldbilder" (Mün-
chen, Braun L Schneider. 36 M )
Jedenfalls gehört dies glänzend
ausgestattete Album zu den lieb-
lichsten Weihnachtsgaben dieses
Jahres, wie es uns den schon aus
den „Fliegenden" allbekannten Mei-
ster phantastischer Träume und
Märchen hier einmal ganz selbst-
schöpserisch und nicht als Illu-
strator andrer inmitten der Gnomen
und Zwerge, Nixen und Einsiedler,
Drachen und Hexen, aber auch der
herzerquickenden Kinder- und Tier-
welt zeigt, mit welcher er sich, der
Bolkspoesie folgend, den deutschen
Wald bevölkert. Wie Fräulein
Bagge vorzugsweise an Ludwig
Richter gebildet, ist Hermann Vogel
ebenso reich an Phantasie, köst-
lichem Humor und unerschöpflicher
Gestaltungskraft, als sie an tiefer
gemütvoller Naturempfindung und
feinem Sinn für das Charakte-
ristische jeder Landschaft. Beide,
besonders aber Vogel sind so spe-
zifisch national, daß man wohl sagen
kann, bei keiner andern Nation sei
auch nur entsernt etwas Ähnliches
zu finden. Das ist rein deutsche,
unserm innersten Weien völlig entsprechende Kunst kann man da
wohl mit Stolz sagen, wo sich ein so starkes Stilgesühl, solch
musikalisch rhythmischer L>inn mit solch tiefem Naturgefühl so
merkwürdig verbinden! Unstreitig ist es Albrecht Dürer, der
zuerst diesen Weg eiugeschlagen, uns den Psad in diese holde
Märchenwelt gezeigt hat, aber wie viel haben da erst Richter
und Schwind, dann unfir Hermann Vogel noch eigenes dazu-
gethan! Schon das merkwürdige Studium der Tier- und Pflanzen-
welt des deutschen Waldes, aber auch das bei Dürer wie Richter
noch ganz fehlende Element seiner zauberischen Lichtwirknngen,
dann den baroken Humor, der sich in den abenteuerlichsten
Sprüngen gesällt, ohne je aus dem wohlthuenden Rhythmus der
Form hcrauszufallen, ja selbst die Abwesenheit aller Senti-
mentalität und Karlosfelpoesie, die bei Richter oft zu sehr an die
Kümmerlichkeit seiner Jugend erinnert — kurz, man möge selber
sehen und sich freuen, daß unser Volksboden noch so gesunde
Blüten und Früchte trägt.
C. Röchling, „Unser Heer". (50 Lichtdrucke. Pr. 35 M.
Breslau, Wiskott.) Wenn man noch Zweifel hegen könnte, ob
unser Heer eine volkstümliche Institution sei, so würde allein
das Erscheinen von Allers „Marine", Müllers „Soldaten-
leben" und jetzt des vorliegenden Werkes, denen noch ein paar
andre folgen sollen, wie wir vernehmen, vollkommen genügen,
jeden Zweifel an dem Anteil zu zerstreuen, mit dem die Nation
ihre waffentragende Jugend begleitet. Denn auch darüber setzen
uns alle drei Werke sofort ins klare, daß dieser Anteil weit
Probcillnstralion aus
lv. Heimburg „Romane"
(Siehe Seite (05)
im Haar, sowie die Kerzen in der Hand, ganz besonders
gehoben und geheiligt fühlen! Dazu kommt dann noch der
Frühling in der Natur, der Empfang durch die Eltern
oder Verwandten um die Kleinen ganz mit der hohen
Bedeutung des Tages zu erfüllen, so daß sie sich wie ein
Flug Tauben aus der Kirche drängen. Das kann aber
gar keine Frage sein, daß uns das weihevolle dieser Szene
schwerlich auch nur halb solchen Eindruck machen würde,
wenn die lieben Kinder nicht so ganz der Natur abge-
stohlen wären und ihre Kleinstädterei nicht so deutlich
in den schlechtgemachten Kleidern der einen, der linkischen
Haltung oder der großen Hände und Füße der
andern so köstlich naiv aussprächen. Selbst, daß sie
einander so auffallend ähnlich sehen, zeigt die gemein-
same Abstammung und Schulung und wäre in einer
Großstadt rein unmöglich. Das Übrige zur Charakte-
ristik des Ortes thun dann der Herr Lehrer in der
Mitte und der alte Philister rechts mit dem Kinde
in der Hand, das die schön geschmückte Schwester
kaum wieder erkennt, wie sie den Vater begrüßt.
Leider kann man auf unsrer Autotypie den Hauptvorzug
des Originals: die leuchtende Pracht der Färbung, die
das Bild überall wo es hängt sofort zum Mittelpunkt
der ganzen Wand macht und wie ein frischer Blumen-
strauß glänzen läßt, nur ahnen, obwohl es gerade nach
dieser Seite hin eines der größten Meisterstücke unsrer
letzten Münchener Ausstellung war.
Eigentlich versteht man ein Kunstwerk nie vollständig,
wenn man seine Entstehungsgeschichte nicht kennt, vorab den
Platz, den es in der Entwickelung seines Meisters einnimmt.
Der ist nun hier ganz besonders interessant, weil es das
erste größere Werk ist, das sein Schöpfer, der Norweger
Frithiof Smith nach seiner Berufung von München an
die Weimarer Kunstschule dort geschaffen. Smith, ein
Schüler des Löfftz, hatte seinen Ruf vor acht Jahren
durch eine „Nachmittagsandacht" in einer kleinen Dorf-
kirche bei München begründet, wo er die oberbayerischen
Kirchgänger ebenso charakteristisch wiedergab als jetzt die
thüringische weibliche Jugend. Dann hatte er mehrere
Bilder im ärgsten Pleinairismus gemalt und später be-
sonders Aufsehen durch ein lebensgroßes Bildnis seines
Landsmannes, des Dichters Ibsen, erregt. Jetzt aber
überraschte er auf einmal alle Welt durch dies, in der
Weimarer Isolierung entstandene Meisterwerk, das nach
jeder, aber besonders nach der koloristischen Seite hin,
wieder einen entschiedenen Fortschritt darstellt und auch
eines der ersten war, welches ans der Ausstellung für
die Galerie in Triest erworben ward. — Es ist dies
unter anderm ein neuer Beweis, daß sich ein wirklich
gesundes Talent in der Stille und Abgeschlossenheit einer
Kleinstadt gar oft noch günstiger zu entfalten vermag
als im Lärm und der Zerstreuung großer. Residenzen.
Wenigstens geben Neher mit seinem Schiller- und Goethe-
zimmer, Preller, der da seine Odysseelandschaft schuf,
Ramberg, der seinen Friedrich II. und Böcklin, der
einige seiner besten Bilder, wie das brennende Schloß
am Meer, die Venus unter Oleandern, die Jagd der
Diana u. a. malte, die seinen Stil erst feststellten, das
beste Zeugnis für Weimar ab, wie Keller, Bolz und Heer,
Schönleber und Baisch für Karlsruhe, A. Fitger für
Bremen. Gerade die Ausbildung der Originalität ist da
wo man nicht beständig unter dem Drucke großer lebender
oder toter Vorbilder steht, jedenfalls leichter, wie das
schon die Meister der Renaissance zeigen, die ja ihre
Eigenart fast alle in kleinen Orten ausbildeten. Freilich
gehört solche Isolierung zu den Medizinen, die nach
dem alten Sprichwort wohl den „Schmieden bekommen,
Schneider aber umbringen". Daß unser so gründlich
germanisierter Norweger aber zu den Kraftnaturcn gehöre,
das hat er nunmehr hinlänglich bewiesen und wird cs
hoffentlich noch oft thun.
Wi'iljn.ichtü-
Büch erschau
Vom Herausgeber
IV. lSchluß)
!en Schlußartikel unsrer dies-
jährigen Weihnachls-Bücher-
schau eröffnen wir mit Herm.
Vogel, „Waldbilder" (Mün-
chen, Braun L Schneider. 36 M )
Jedenfalls gehört dies glänzend
ausgestattete Album zu den lieb-
lichsten Weihnachtsgaben dieses
Jahres, wie es uns den schon aus
den „Fliegenden" allbekannten Mei-
ster phantastischer Träume und
Märchen hier einmal ganz selbst-
schöpserisch und nicht als Illu-
strator andrer inmitten der Gnomen
und Zwerge, Nixen und Einsiedler,
Drachen und Hexen, aber auch der
herzerquickenden Kinder- und Tier-
welt zeigt, mit welcher er sich, der
Bolkspoesie folgend, den deutschen
Wald bevölkert. Wie Fräulein
Bagge vorzugsweise an Ludwig
Richter gebildet, ist Hermann Vogel
ebenso reich an Phantasie, köst-
lichem Humor und unerschöpflicher
Gestaltungskraft, als sie an tiefer
gemütvoller Naturempfindung und
feinem Sinn für das Charakte-
ristische jeder Landschaft. Beide,
besonders aber Vogel sind so spe-
zifisch national, daß man wohl sagen
kann, bei keiner andern Nation sei
auch nur entsernt etwas Ähnliches
zu finden. Das ist rein deutsche,
unserm innersten Weien völlig entsprechende Kunst kann man da
wohl mit Stolz sagen, wo sich ein so starkes Stilgesühl, solch
musikalisch rhythmischer L>inn mit solch tiefem Naturgefühl so
merkwürdig verbinden! Unstreitig ist es Albrecht Dürer, der
zuerst diesen Weg eiugeschlagen, uns den Psad in diese holde
Märchenwelt gezeigt hat, aber wie viel haben da erst Richter
und Schwind, dann unfir Hermann Vogel noch eigenes dazu-
gethan! Schon das merkwürdige Studium der Tier- und Pflanzen-
welt des deutschen Waldes, aber auch das bei Dürer wie Richter
noch ganz fehlende Element seiner zauberischen Lichtwirknngen,
dann den baroken Humor, der sich in den abenteuerlichsten
Sprüngen gesällt, ohne je aus dem wohlthuenden Rhythmus der
Form hcrauszufallen, ja selbst die Abwesenheit aller Senti-
mentalität und Karlosfelpoesie, die bei Richter oft zu sehr an die
Kümmerlichkeit seiner Jugend erinnert — kurz, man möge selber
sehen und sich freuen, daß unser Volksboden noch so gesunde
Blüten und Früchte trägt.
C. Röchling, „Unser Heer". (50 Lichtdrucke. Pr. 35 M.
Breslau, Wiskott.) Wenn man noch Zweifel hegen könnte, ob
unser Heer eine volkstümliche Institution sei, so würde allein
das Erscheinen von Allers „Marine", Müllers „Soldaten-
leben" und jetzt des vorliegenden Werkes, denen noch ein paar
andre folgen sollen, wie wir vernehmen, vollkommen genügen,
jeden Zweifel an dem Anteil zu zerstreuen, mit dem die Nation
ihre waffentragende Jugend begleitet. Denn auch darüber setzen
uns alle drei Werke sofort ins klare, daß dieser Anteil weit
Probcillnstralion aus
lv. Heimburg „Romane"
(Siehe Seite (05)